Die Folklore Südosteuropas. Eine Komparative Übersicht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lirikat E Fjetura
Mehmet Bislimi LIRIKAT E FJETURA Mehmet Bislimi LIRIKAT E FJETURA Redaktor: Prof. Dr. Begzad Baliu Lektor: Emin Halimi Recensent: Adnan Asllani Kopertina dhe faqosja: Sabir Krasniqi Punimi në ballinë: Bryce Botues: PPG “Shkrola Print” Prishtinë Copyright & 2013 Autori Mehmet Bislimi LIRIKAT E FJETURA POEZI ... «Bota femërore» është frymëmarrje e kësaj jete e megjithatë ngulfaten të drejtat e saj! Ajo i jep nuanca shumëngjyrëshe përditshmërisë sonë dhe përjetëson jetën mbi glob e megjithatë globalisht jetën ia errësojnë! Më shumë këngë, më shumë respekt, më shumë liri, më shumë përkushtim, më shumë dashuri... për botën femërore. - autori FJALA E REDAKTORIT Ironia e tekstit Mehmet Bislimi, Lirikat e fjetura, Prishtinë, 2013. Dy dekadat e fundit letërsia shqiptare ka pasur prurje të pazakonshme në fushë të saj, si me numrin e autorëve ashtu edhe me numrin e veprave të shkruara dhe, madje edhe me numrin e veprave të përkthyera. Arsyet e këtyre prurje janë thënë jo njëherë dhe mund të tipologjizohen edhe më tej, si për modelin e ardhur nga radhët e shkrimtarëve ashtu edhe për prirjen semantike të veprave të shkruara a të përkthyera. Shkrimtari Mehmet Bislimi është njëri prej krijuesve të dekadës së fundit, i cili shquhet për trashëgiminë jetësore të biografisë së tij, për modelin se si ka hyrë në letrat shqipe dhe për prurjet estetike të krijimtarisë së tij. Në letërsinë shqipe ai hyn me konceptet intelektuale të krijuesit, që në shoqërinë shqiptare ka sjellë më parë se sa mendimin kritik për letërsinë, mendimin kritik për lirinë e të qenit shqiptar. Duke i takuar radhës së atyre krijuesve që mendimin dhe angazhimin e tyre jetësor e 7 konsideronin mision, ai la mënjanë për shumë vjet anën shpirtërore subjektive deri në fund të Luftës çlirimtare të Kosovës. -

Pralla Popvllore Shqiptare
INSTITUTI I SHKENCAVE PRALLA POPVLLORE SHQIPTARE TIRANË, 1954 INSTITUTI I SHKENC4VE PRALLA POPULLORE SHQIPTARE TIRAME, 1954 Redaktuar nga Komisjoni i folklorit nën drejtimin e Zihni Sakos. STASH 2204 — 52 Tirazhi : 6000 copë N. SH. B. Stabilimenti «Mihal Duri» - Tiranë PRALLA Peihkëtari dhe e bukura e dheut Qe një peshkëtar, kish edhe të shoqen. Një ditë i thotë e shoqja atij: «ore burrë, ti ngaherë shet peshk, nuk do të na sjellç edhe neve njëherë ndonjë»? Edhe ay vate nesret të gjuanjë për në shtëpi edhe tek hodh i mërezhën, zuri një peshk të mirë. Po ay peshk i tha peshkëtarit: «mos më trazo mue, se s'jam fati yt, po lëshomë mua, pa eja nesër të zësh një tjetër, që do të jetë për ty». Edhe ay e lëshoi, e vate zbrazur në shtëpi ku e shoqja po priste peshk me tiganë në zjarr. E pyeti e shoqja: "përse nuk solle peshk, 0 burre» ? Ay i th a se, kështu e kështu më ngjau, o grua. Të nesërmen vajti përsëri ay, edhe zu një ueshk të math, i cili i tha atij: «mirë më zure, po të më bësh tetë fela, dy nga ato t'i shtjesh në portë tënde, dy t'ja shtjesh pelës, dy bushtrës, edhe dy tja japësh s'at shoqe». Edhe ay me të vajtur në shtëpi, e ndau atë me vërtet ashtu siç ish porositur prej sij, E paditur fare gjë ay namëtë te porta mbinë dy selvi, pelëza polli dy hamëshorë të mirë pa anë, bushtra polli dy luanë të çudiçim, edhe e shoqja lindi dy djema trima, edhe të bukur shumë. -

The Rise of Bulgarian Nationalism and Russia's Influence Upon It
University of Louisville ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository Electronic Theses and Dissertations 5-2014 The rise of Bulgarian nationalism and Russia's influence upon it. Lin Wenshuang University of Louisville Follow this and additional works at: https://ir.library.louisville.edu/etd Part of the Arts and Humanities Commons Recommended Citation Wenshuang, Lin, "The rise of Bulgarian nationalism and Russia's influence upon it." (2014). Electronic Theses and Dissertations. Paper 1548. https://doi.org/10.18297/etd/1548 This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository. This title appears here courtesy of the author, who has retained all other copyrights. For more information, please contact [email protected]. THE RISE OF BULGARIAN NATIONALISM AND RUSSIA‘S INFLUENCE UPON IT by Lin Wenshuang B. A., Beijing Foreign Studies University, China, 1997 M. A., Beijing Foreign Studies University, China, 2002 A Dissertation Submitted to the Faculty of the College of Arts and Sciences of the University of Louisville in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Humanities University of Louisville Louisville, Kentucky May 2014 Copyright © 2014 by Lin Wenshuang All Rights Reserved THE RISE OF BULGARIAN NATIONALISM AND RUSSIA‘S INFLUENCE UPON IT by Lin Wenshuang B. A., Beijing Foreign Studies University, China, 1997 M. A., Beijing Foreign Studies University, China, 2002 A Dissertation Approved on April 1, 2014 By the following Dissertation Committee __________________________________ Prof. -

Monograph with Memories – Album About the Village German – Prespa Region
Monograph with Memories – Album About the Village German – Prespa Region By The Organising Committee for the Residents of the Village German Translated By Elizabeth Kolupacev Stewart 1 Publisher – The organising committee for the residents of the village German: 1. Mitre J Kajchevski 2. Aleksandar G Karlovski, professor 3. Risto N Maljanovski 4. Pando K Kajchevski [Extract from Foreword] The editors, with the help of oral history from villagers, have assembled this book. The Monograph is dedicated to the 30th anniversary and the 5th traditional celebration of German villagers held in Trnovo on 20/5/79. Translator – Monograph with Memories – Album About the Village German – Prespa Region was translated from the Macedonian by Elizabeth Kolupacev Stewart. 2 A Short Historical Sketch of German From as early as the 7th century slavs settled the Balkan Peninsula and a part of them settled in Macedonia. Beautiful Macedonia with its many passes, river plains, and four big rivers: Vardar, Struma, Bistrica and Mesta, beautiful mountains and lakes, attracted the families: Brsjaci, Sagurati, Velegeziti, Rinhini, Strumjani, Smoljani etc to settle this beautiful Macedonian land and they took up agriculture, raising livestock, hunting and fishing in the abundant rivers and many lakes. Macedonia is the only Balkan country with so many lakes so it is no surprise that they called it a lake‐country. It is historically recognised that a part of the large Brsjak tribe settled Prespa, that tame, beautiful and bountiful part which mother nature richly bestowed with many mountains, green pastures, flower covered meadows, varied forests and clear mountain springs. Nature determined the future occupation of the residents – agriculture, livestock raising, forestry and fishing. -

Bulgarian Teachers of the Liberation Age
News, Announcements and Resources Biomath Communications 3 (2016) Biomath Communications www.biomathforum.org/biomath/index.php/conference Bulgarian teachers of the liberation age Maria K. Lovdjieva Museum \Petko and Pencho Slaveikovi", Sofia email: [email protected] Dedicated to the memory of Nestor Markov on the occasion of his 180th birthday anniversary Abstract When browsing through the biographies of the generation of Bulgarian teachers who lived and worked in the years around the liberation-bringing Russo-Turkish war (1877{1878), we see the clear outlines of the impediments blocking the education and development endeavors of the young Bulgarian state. Five centuries after it had been engulfed by the Ottoman empire and severed from European cul- ture, Bulgaria was far behind the times. In this article we review the activities of eleven Bulgarian teachers who lived and worked around the time of liberation from the Ottoman rule. Their lives and activi- ties on the borderline of two epochs strike us with their self-sacrificial efforts to overcome the enormous backwardness of the Bulgarian na- tion. We point out their contribution in the spheres of education and science. The biographies of these Bulgarian teachers present a vivid picture of the times and are an edifying subject to study and remem- ber. Introduction The history of the Bulgarian state, stretching from its establishment Citation: Maria K. Lovdjieva, Bulgarian teachers of the liberation age, http://dx.doi.org/10.11145/bmc.2016.12.237 in the seventh century to the present day, is a chain of upheavals and downfalls. Bulgaria, of all modern European states, is the oldest coun- try to have preserved its name. -

2014-2024 Management Plan Prespa National Park in Albania
2014-2024 Management Plan Prespa National Park in Albania MANAGEMENT PLAN of the PRESPA NATIONAL PARK IN ALBANIA 2014-2024 1 2014-2024 Management Plan Prespa National Park in Albania ABBREVIATIONS ALL Albanian Lek a.s.l. Above Sea Level BCA Biodiversity Conservation Advisor BMZ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany CDM Clean Development Mechanism Corg Organic Carbon DCM Decision of Council of Ministers DFS Directorate for Forestry Service, Korca DGFP Directorate General for Forestry and Pastures DTL Deputy Team Leader EUNIS European Union Nature Information System GEF Global Environment Facility GFA GFA Consulting Group, Germany GNP Galicica National Park GO Governmental Organisation GTZ/GIZ German Agency for Technical Cooperation, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Name changed to GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations IUCN International Union for Conservation of Nature The World Conservation Union FUA Forest User Association Prespa KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau - Entwicklungsbank/German Development Bank LMS Long Term Monitoring Sites LSU Livestock Unit MC Management Committee of the Prespa National Parkin Albania METT Management Effectiveness Tracking Tool MoE Ministry of Environment of Albania MP Management Plan NGO Non-Governmental Organisation NP National Park NPA National Park Administration NPD National Park Director (currently Chief of Sector of Directorate for Forestry Service, Korca) PNP National -
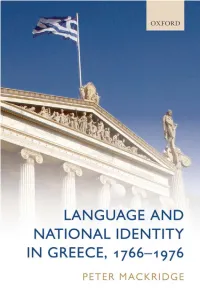
93323765-Mack-Ridge-Language-And
Language and National Identity in Greece 1766–1976 This page intentionally left blank Language and National Identity in Greece 1766–1976 PETER MACKRIDGE 1 3 Great Clarendon Street, Oxford ox2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York © Peter Mackridge 2009 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2009 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Mackridge, Peter. -

ABSTRACT of the Dissertation for Acquiring the Scientific Degree "Doctor of Science" Professional Field 3.1
SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI " FACULTY OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF SOCIOLOGY ABSTRACT of the dissertation for acquiring the scientific degree "Doctor of Science" Professional field 3.1. Sociology, Anthropology and Cultural Sciences (Sociology) Assoc. Prof. Dr Martin Ivanov Sofia, 2021 1 This dissertation was discussed and presented for public defence at a meeting of the Department of Sociology at the Faculty of Philosophy of Sofia University "St. Kliment Ohridski”, held on February 10th, 2021 and approved by a decision of the Faculty Council of the Faculty of Philosophy on March 2nd, 2021. It consists of an introduction, three chapters, a conclusion, twelve appendices and a bibliography with a total volume of 502 pages. The public defence of the dissertation will take place on July 7th, 2021 at 2 pm in at an public on-line session of the scientific jury composed of: Assoc. Prof. D.Sc. Milena Yakimova Assoc. Prof. Dr. Petya Slavova Assoc. Prof. Dr. Rumen Avramov Prof. D.Sc. Ivan Rusev Prof. D.Sc. Milko Palangurski Prof. Dr. Sc. Rumen Daskalov Prof. Dr. Sc. Pepka Boyadzhieva and spare members: Prof. D.Sc. Tanya Chavdarova Prof. Dr. Daniel Vachkov 2 INTRODUCTION This dissertation is about the long and difficult first meeting of Bulgarians with modernity. In our literature, this period is known as the National Revival (Vazrajdane), a powerful impetus to break with the old and turn to new, "European" role models. According to a tradition established by generations of researchers, the story of Vazrajdane so far has gone almost exclusively through the struggle for the national liberation, for the autocephalic church, and for the modern Bulgarian education and culture. -
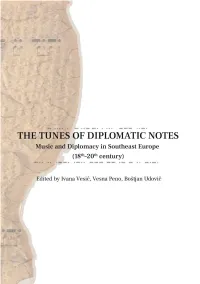
Bitstream 42365.Pdf
THE TUNES OF DIPLOMATIC NOTES Music and Diplomacy in Southeast Europe (18th–20th century) *This edited collection is a result of the scientific projectIdentities of Serbian Music Within the Local and Global Framework: Traditions, Changes, Challenges (No. 177004, 2011–2019), funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, and implemented by the Institute of Musicology SASA (Belgrade, Serbia). It is also a result of work on the bilateral project carried out by the Center for International Relations (Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana) and the Institute of Musicology SASA (Belgrade, Serbia) entitled Music as a Means of Cultural Diplomacy of Small Transition Countries: The Cases of Slovenia and Serbia(with financial support of ARRS). The process of its publishing was financially supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. THE TUNES OF DIPLOMATIC NOTES MUSIC AND DIPLOMACY IN SOUTHEAST EUROPE (18th–20th CENTURY) Edited by Ivana Vesić, Vesna Peno, Boštjan Udovič Belgrade and Ljubljana, 2020 CONTENTS Acknowledgements ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7 1. Introduction ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 Ivana Vesić, Vesna Peno, Boštjan Udovič Part I. Diplomacy Behind the Scenes: Musicians’ Contact With the Diplomatic Sphere 2. The European Character of Dubrovnik and the Dalmatian Littoral at the End of the Enlightenment Period: Music and Diplomatic Ties of Luka and Miho Sorkočević, Julije Bajamonti and Ruđer Bošković ��������������������������������������������������������������������������������17 Ivana Tomić Ferić 3. The Birth of the Serbian National Music Project Under the Influence of Diplomacy ���������37 Vesna Peno, Goran Vasin 4. Petar Bingulac, Musicologist and Music Critic in the Diplomatic Service ������������������53 Ratomir Milikić Part II. -
![Keqkuptimi I Arshi Pipes Mbi Mitologjine Shqiptare - Arshi Pipa Misunderstanding on Albanian Mythology] English|Page 11](https://docslib.b-cdn.net/cover/5169/keqkuptimi-i-arshi-pipes-mbi-mitologjine-shqiptare-arshi-pipa-misunderstanding-on-albanian-mythology-english-page-11-1975169.webp)
Keqkuptimi I Arshi Pipes Mbi Mitologjine Shqiptare - Arshi Pipa Misunderstanding on Albanian Mythology] English|Page 11
[Keqkuptimi i Arshi Pipes mbi mitologjine shqiptare - Arshi Pipa misunderstanding on Albanian mythology] English|Page 11 1 e nje kryeveper mbi mitologjite e ndryshme te botes printuar ne 1981 ne Paris, akademiku i famshem anti-komunist Arshi Pipa N shkruajti nje artikull per mitologjine shqiptare. Ai shpjegon se si nje nga tiparet me unike te saj eshte mungesa e zotave apo hyjnive. Fale zbulimeve ne fushat e linguistikes, mitologjise komparative, arkeologjise etj, e dime sot qe kjo deklarate e Pipes nuk ka qene fort e sakte, por sidoqofte, ai vuri re dicka qe duhet sqaruar me tej, pasi mund te coje, dhe ka cuar, ne keqkuptime. Ndoshta i influencuar nga ateizmi i kohes, Arshi Pipa pa nje lloj ateizmi apo nje shenjterim te thjeshte te natyres tek mungesa e zotave ne mitologjine shqiptare. Te thuash qe zotat ne mitologjine shqiptare jane vetem nje koncept me shume se sa qenie fizike, si ne mitologjite e tjera, do te ishte nje keq- interpretim tjeter. Pipa mund ta kete menduar dicka te tille, por ai po kerkonte per hyjni me personalitete dhe role specifike dhe te mire- percaktuara, te cilat, ndryshe nga cka thone stereotipet, nuk ishin gjithnje te pranishme tek mitologjite e lashta Indo-Evropiance. Julius Evola pershkruan tek kapitulli 7 i kryevepres se tij, Revolta kunder botes moderne, se si shume kultura Indo-Evropiane i perfytyronin fillimisht zotat e tyre jo si qenie te ngjashme me njeriun dhe me personalitet, por si forca te mbinatyrshme pa emer, te cilat nuk portretizoheshin permes ikonave. Duke perdorur romaket e lashte si shembull, ai pershkruan se si ne fillim te historise se tyre, Romaket i shikonin zotat si numina apo numen (forca te mbinatyrshme), kurse me vone i shihnin si deus (zota te ngjashem me njerezit ne pamje dhe ne personalitet). -

Redevelopment Projects in Authoritarian and Hybrid Regimes
Journal of Urban Affairs ISSN: 0735-2166 (Print) 1467-9906 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ujua20 Cities as story: Redevelopment projects in authoritarian and hybrid regimes Dorina Pojani To cite this article: Dorina Pojani (2017): Cities as story: Redevelopment projects in authoritarian and hybrid regimes, Journal of Urban Affairs, DOI: 10.1080/07352166.2017.1360737 To link to this article: https://doi.org/10.1080/07352166.2017.1360737 Published online: 22 Nov 2017. Submit your article to this journal View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ujua20 Download by: [UQ Library] Date: 24 November 2017, At: 23:27 JOURNAL OF URBAN AFFAIRS https://doi.org/10.1080/07352166.2017.1360737 Cities as story: Redevelopment projects in authoritarian and hybrid regimes Dorina Pojani The University of Queensland ABSTRACT In the past decade, so-called hybrid regimes—authoritarian regimes in the guise of democracy—have emerged in Europe. Similar to the authoritarian or totalitarian regimes of 20th-century Europe, the association between urban design and politics is evident in the capital cities of hybrid regimes. This article recounts the stories of the recently proposed and/or completed redevelopment projects in the centers of Istanbul (Turkey), Skopje (Macedonia), and Tirana (Albania). In all 3 capitals, the interventions have been rather contentious, and have produced violent protests in the case of Turkey and Macedonia. The author has collected and presented the stories of the users of these three city centers and their reactions to these spaces before and after redevelopment. -

Musical Practices in the Balkans: Ethnomusicological Perspectives
MUSICAL PRACTICES IN THE BALKANS: ETHNOMUSICOLOGICAL PERSPECTIVES МУЗИЧКЕ ПРАКСЕ БАЛКАНА: ЕТНОМУЗИКОЛОШКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ НАУЧНИ СКУПОВИ Књига CXLII ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ Књига 8 МУЗИЧКЕ ПРАКСЕ БАЛКАНА: ЕТНОМУЗИКОЛОШКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА ОДРЖАНОГ ОД 23. ДО 25. НОВЕМБРА 2011. Примљено на X скупу Одељења ликовне и музичке уметности од 14. 12. 2012, на основу реферата академикâ Дејана Деспића и Александра Ломе У р е д н и ц и Академик ДЕЈАН ДЕСПИЋ др ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ др ДАНКА ЛАЈИЋ-МИХАЈЛОВИЋ БЕОГРАД 2012 МУЗИКОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS ACADEMIC CONFERENCES Volume CXLII DEPARTMENT OF FINE ARTS AND MUSIC Book 8 MUSICAL PRACTICES IN THE BALKANS: ETHNOMUSICOLOGICAL PERSPECTIVES PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE HELD FROM NOVEMBER 23 TO 25, 2011 Accepted at the X meeting of the Department of Fine Arts and Music of 14.12.2012., on the basis of the review presented by Academicians Dejan Despić and Aleksandar Loma E d i t o r s Academician DEJAN DESPIĆ JELENA JOVANOVIĆ, PhD DANKA LAJIĆ-MIHAJLOVIĆ, PhD BELGRADE 2012 INSTITUTE OF MUSICOLOGY Издају Published by Српска академија наука и уметности Serbian Academy of Sciences and Arts и and Музиколошки институт САНУ Institute of Musicology SASA Лектор за енглески језик Proof-reader for English Јелена Симоновић-Шиф Jelena Simonović-Schiff Припрема аудио прилога Audio examples prepared by Зоран Јерковић Zoran Jerković Припрема видео прилога Video examples prepared by Милош Рашић Милош Рашић Технички