„Sieben Berge, Vorberge“- LSG HI 059
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bodenbewohnende Spinnen Und Weberknechte in Den Sieben Bergen Und Vorbergen (Arachnida: Araneida, Opilionida)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Göttinger Naturkundliche Schriften Jahr/Year: 2005 Band/Volume: 6 Autor(en)/Author(s): Sührig Alexander Artikel/Article: Bodenbewohnende Spinnen und Weberknechte in den Sieben Bergen und Vorbergen (Arachnida: Araneida, Opilionida) 91- 106 Göttinger Naturkundliche Schriften 6, 2005: 91-106 © 2005 Biologische Schutzgemeinschaft Göttingen Bodenbewohnende Spinnen und Weberknechte in den Sieben Bergen und Vorbergen (Arachnida: Araneida, Opilionida) A lexander Sührig In a faunistic study in the „Sieben Berge und Vorberge“ (rural district of Hildes- heim, Southern Lower Saxony) 58 species of spiders (Araneida) and seven (ten) species (taxa) of harvestmen (Opilionida) were detected. In 1999 from April until November the arachnofauna was sampled by means of pitfall traps (n = 18) at three study sites („Horzen“, „Osten-“ and „Drohnenberg“). Dominant (s. 1.) forest-floor spiders were Pardosa saltans (39.0%), Coelotes terrestris (14.0%), Diplocephaluspicinus (7.8%), Lepthyphantes flavipes (4.3%), Apostenus fuscus (3.8%), Coelotes inermis (3.7%), and Histopona torpida (3.5%). The following harvestmen species were at least dominant (s.s.): Rilaena triangularis (39.0%), Anelasmocephalus camhridgei (22.8%), and Trogulus closanicus (21.1%). In the „Sieben Berge und Vorberge“ 60 species of spiders and seven (ten) species (taxa) of harvestmen have been recorded to date. 1 Einleitung 2001). In Niedersachsen sind die im Rahmen ökosystemarer Ansätze am besten untersuch Bisher sind aus den südlich des Mittellandka ten Wälder der Solling (E llen b er g et al. 1986) nals gelegenen Teilen Niedersachsens (=„Süd- und der Göttinger Wald (S c h a e f e r 1989, Niedersachsen“) 550 Spinnenarten bekannt S c h a efer & S c h a u er m a n n 1990). -

Die Berge Und Wir Heft 1/2017
Deutscher Alpenverein Sektion Hannover e. V. Die Berge und wir Ausgabe 1/2017 | Januar - April Der Vorstand informiert MitgliederversammlungFreitag 28. April, 18 Uhr alpenverein-hannover.de 2 VORWORT Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem Heft ist die Veränderung nun nicht mehr zu übersehen. Wir haben das Design vollständig überarbeitet und hoffen, dass es Ihnen genauso gut gefällt wie uns! Wir setzen unsere Vorstellungsreihe der Ehrenämter fort und haben dieses Mal mit un- serem EDV-Beauftragten gesprochen, der uns seine Aufgaben geschildert und uns von seinem Wunsch nach Unterstützung in diesem Amt erzählt hat (S. 52). Vielleicht wäre das etwas für Sie? Wie wäre es mit einem unserer Kurse aus dem Ausbildungsprogramm 2017 (S. 44). Was Sie dort unter anderem erleben können, erfahren Sie im Bericht über die Familien-Ausbil- dungswoche auf Seite 72. Unsere Gruppen waren sehr aktiv und nehmen Sie mit auf eine Wanderung ins Altvater- Gebirge (S. 66), zur Zugspitze (S. 74), auf Fototour nach Bad Zwischenahn (S. 77) und auf die Jubiläumswanderung der Trekkinggruppe (S. 70). Außerdem erfahren Sie mehr über den Anstieg zur Hildesheimer Hütte (S. 68), finden eine Wanderempfehlung am Königssee (S. 75) und können nachlesen, wie der Arbeitseinsatz „Wiese mähen 2016“ an der Kansteinhütte abgelaufen ist (S. 65). Sie können sich auf Seite 54 über die Entwicklung auf der Baustelle unseres Sektionszen- trums informieren und erhalten erste Informationen zu unserer neuen Kletterhalle und den angebotenen Kursen (S. 57). Und natürlich lösen wir das Rätsel um den Namen unserer Jugendseiten und stellen Ihnen die Gewinner vor (S. 10). Auch im nächsten Heft drucken wir gerne Ihre Beiträge und Fotos ab und freuen uns, wenn Sie uns diese bis zum 06. -

B96-2 Flächenstillegung Und Extensivierung in Der Agrarlandschaft
Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz Berichte 9. Jahrgang, Heft 2, 1996 Flächenstillegung und Extensivierung in der Agrarlandschaft-Auswirkungen auf die Agrarbiozönose Niedersächsisches Hannover Landesamt für Ökologie P ) Niedersachsen NNABer. 9. Jg. H. 2 73 S. Schneverdingen 1996 ISSN: 0935-1450 Flächenstillegung und Extensivierung in der Agrarlandschaft-Auswirkungen auf die Agrarbiozönose Herausgeber und Bezug: Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz Hof Möhr, D-29640 Schneverdingen, Telefon (051 99) 989-0, Telefax (0 51 99) 989-46 Für die einzelnen Beiträge zeichnen die jeweiligen Autorinnen und Autoren verantwortlich. Schriftleitung: Dr. Renate Strohschneider ISSN 0935-1450 Titelbild: Sommeraspekt eines Roggenackers von der Wernershöhe (Landkreis Hildesheim). Foto: H. Hofmeister Gedruckt auf Recyclingpapier (aus 100 % Altpapier) NNA-Berichte 9. Jahrgang/1996, Heft 2 Flächenstillegung und Extensivierung in der Agrarlandschaft - Auswirkungen auf die Agrarbiozönose 5. Tagung des Arbeitskreises „Naturschutz in der Agrarlandschaft" vom 22.-24. Juni 1995 in Hildesheim, in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesamt für Ökologie - Naturschutz und der Universität Hannover Leitung: Dipl.-Biol. Gisela Wicke (NLÖ-Ffn), Dr. Joachim Hüppe, Dr. Heinrich Hofmeister (Universität Hannover), Dr. Renate Strohschneider (NNA) Inhalt Vorwort der Niedersächsischen Umweltministerin Monika Griefahn 2 G rußw orte 2 G. W icke: Was bringen dem Naturschutz Flächenstillegung und Extensivierung in der Landwirtschaft- Tagungsergebnisse 4 H. M ühle: Vorschläge -

Organigramm Des Kirchenamtes Hildesheim Telefon: 05121 100-0 Telefax: 05121 100-999 (Sekretariat OG)
Verwaltungsleitung Jens Stöber, Tel. -600 Querschnittsaufgaben Organigramm des Kirchenamtes Hildesheim Monika Reicke*) / Andrea Hildebrandt / Sabine Reich-Meyer*) Stand: 01.01.2018 · Leitung Kirchenamt Tel. -601 / -603 / -601 Telefon: 05121 100-0 · Betreuung Verbandsvorstand · Postausgang / · Posteingang Telefax: 05121 100-999 (Sekretariat OG) · Erteilung von Genehmigungen nach KGO und KKO sowie · Registratur/Archiv / · Sitzungsdienst Beanstandung von Beschlüssen · Telefonzentrale · Budgetplanung Datenschutzbeauftragte: Elke Schünemann * -106 · Betreuung Kirchenkreisverband Hildesheim Fachbereich I Fachbereich II Fachbereich III Fachbereich IV Fachbereich V - Finanz- und Bauwesen - Rechnungswesen – - Liegenschaften / Friedhöfe / EDV / - Personalwesen – - Diakonie - Fachbereichsleiter: Hartmut Haase Meldewesen Fachbereichsleiter: Helmut Jost Tel. -200 Fachbereichsleiter: Matthias Wehling Fachbereichsleiter: Sven Böning Fachbereichsleiterin: Cordula Stepper Tel. -100 · Leitung des Fachbereiches Tel. -300 Tel. -400 Tel. -500 · stellvertretende Verwaltungsleitung · Verwaltung Rücklagen- u. Darlehensfonds (RDF) · Leitung des Fachbereiches · Leitung des Fachbereiches · stellvertretende Verwaltungsleitung · Leitung des Fachbereiches · Disposition der Geldanlagen · Generalia Liegenschaften und · grundsätzliche Fragen des · Leitung des Fachbereiches · Finanzplanung/Gesamtzuweisung Kirchenkreisverband · Aufsicht über Zahlstellen Ersatzlanderwerbe, EDV, Meldewesen Arbeits- und Dienstrechtes · Betreuung · Betreuung Kirchenkreisvorstand und FiPla-Ausschuss -

Die Waldgesellschaften Des Hildeheimer Waldes
The electronic publication Die Waldgesellschaften des Hildeheimer Waldes (Hofmeister 1990) has been archived at http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/ (repository of University Library Frankfurt, Germany). Please include its persistent identifier urn:nbn:de:hebis:30:3-396225 whenever you cite this electronic publication. Tuexenia 10: 443-473. Göttingen 1990. Die Waldgesellschaften des Hildeheimer Waldes — Heinrich Hofmeister — Zusammenfassung Der Hildesheimer Wald als Höhenzug des südniedersächsischen Berg- und Hügellandes zeichnet sich auf Grund seines geologischen Aufbaus (Buntsandstein, Muschelkalk, Löß), seines vielgestaltigen Reliefs und Kleinklimas sowie der unterschiedlichen Bewirtschaftungsweise durch eine große Vegetationsvielfalt aus. Das Waldbild wird in erster Linie durch Buchenwälder Carici-Fagetum, Hordelymo-Fagetum, Galio odorati-Fagetum) und bodensaure Laubmischwälder (Luzulo-Fagetum, Luzulo-Quercetum) bestimmt. Demgegenüber treten Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum, Stellario-Carpinetum), bachbeglei tende Auenwälder (Carici rem otae-Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae) und Bruchwälder (Carici elongatae-Alnetum glutinosae) flächenmäßig zurück. Abstract The hills of the Hildesheimer Wald (southern Lower Saxony) are marked by the presence of various geo logical formations (red sandstone, limestone, loess), diverse relief and microclimate, and a different practice of cultivation. Consequently the area contains many deciduous forest communities. Forests with beech and oak (Carici-Fagetum , Hordelymo-Fagetum, -

Hohe Tafel / Sieben Berge
Wandern Hohe Tafel / Sieben Berge Länge: 12,58 km Start: Wanderparkplatz Brüggen,Kirschweg ,Waldrand Steigung:+ 534 m / - 365 m Verlauf: Hohe Tafel Binnewiesturm Dauer: ca 3,5 Stunden Ziel: Wanderparkplatz Brüggen,Kirschweg ,Waldrand Hörzenhütte Überblick ins Leinetal schauen kann. Rundwanderung Der Binnewiesturm in den Sieben Bergen bei Brüggen. Die Brüggen-Kirschweg- Höchste Erhebung der Sieben Berge, die Hohe Tafel (395 m Waldrand-hörzenhütte-Tafelbergturm-Rennstieg-Heinumer-Sp ü. NN). Der erste Aussichtsturm auf dem Sieben Bergen war ortplatz -Fluggelände-Rhedener Wald -Waldrandweg zum ein von Rhedenern gebauter Holzturm. Dieser entstand in der Ausgangspunkt Zeit 1880 – 1890. 1926 wurde durch den Alfelder Verschönerungsverein der heutige Turm errichtet. Über den historichen Rennstieg geht es ein Stück in Richtung Eberholzen/Hildesheim. Dann biegen wir links ab am Nußberg entlang Richtung Heinumer Sportplatz. Weiter am Waldrand entlang Richtung Rheden vorbei am Flugplatz. Dann links am Waldrand zurück zur Hörzenhütte. Copyright: Günter Lampe, Delligsen [email protected] Binnewiesturm auf der Hohen Tafel Tourbeschreibung Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Brüggen,Kirschweg am Waldrand Holzer Schleie Holzer Schleie, Nesselberg, Waldweg rauf zur Hohen Tafel (395 m) Die Sieben Berge, deren höchster Berg die Hohe Tafel (395 m) ist, sind in Nord-Süd-Richtung: Blick von der Hohen Tafel * Hörzen (364,1 m) – östlich von Brüggen Schwierigkeit * Hohe Tafel (395 m; auch Tafelberg) – ost-südöstlich v. Brüggen – mit Ernst-Binnewies-Turm (Volksmund: Einige Höhenmeter zu überwinden. Tafelbergturm, Aussichtsturm) von Höhe 128 m auf 397 m Hohe Tafel * Saalberg (313,2 m) – südöstlich von Brüggen Belohnung :Schöne Aussichten * Ostenberg (359,8 m) – östlich von Dehnsen (OT Alfelds) * Lauensberg (333,4 m) – nord-nordöstlich von Eimsen (OT Barrierefreiheit Alfelds) * Heimberg (316,3 m) – nordöstlich von Eimsen Die Tour ist nicht barrierefrei. -

Der April Verzaubert Frühlingsmarkt · Autoschau · Kreative Freizeitideen SIEBEN: April Monatlich Unabhängig Unbezahlbar 2016 2 Editorial
Jahre April 2016 20. Jahrgang www.sieben-regional.de Der April verzaubert Frühlingsmarkt · Autoschau · kreative Freizeitideen SIEBEN: April monatlich unabhängig unbezahlbar 2016 2 Editorial Aus dem Inhalt Rückblick auf die Zukunft Jahre Liebe Leserinnen und Leser, ten Minute noch gewonnen hatten. Somit konn- 20 Jahre SIEBEN: 4 – 5 ten sie die Liga halten. Der amtierende Meister irgendwie ist dieses Jahr 2016 noch verbesse- stammt somit auch nicht aus der Bayerischen Lan- rungsfähig. Wo man hinhört, klagen die Menschen deshauptstadt. oder haben Angst, und die Gründe dafür sind nicht Frühlingsmarkt 6 – 7 zu übersehen. Man denke nur an den Terrorismus, Beim Eurovision Song Contest in Stockholm am 14. der längst in Europa angekommen ist, die theoreti- Mai war Deutschland übrigens nicht letzter gewor- schen und praktischen Schwierigkeiten bei der In- den. Der Sommer kam gänzlich ohne Bombenat- tegration neuer und alter Mitbürger, die Wahlerfol- tentate aus, und Pyrotechnik beschränkte sich auf ge der AfD und die Kriege überall auf der Welt… die Open Airs in Scheeßel (24.–26. Juni) oder Wa- Garten 8 cken (4.–6. August). Aber vielleicht sollte man einfach einmal positiver denken, alles aus der Positiv-Perspektive betrach- Auch beim Oktoberfest in München gab es keine ten. Mit einem Rückblick auf die nähere Zukunft. Personenschäden zu beklagen sondern nur die im- Stellen wir uns vor, wir schauten Ende 2016 auf ei- mer noch ungebremste Niederlagenserie der Bay- Gesundheit 9 – 12 nige Ereignisse des laufendes Jahres: Bei den Wah- ern. Und die Feierlichkeiten zum Tag der Deut- len in Meck-Pomm (4. September), Niedersach- schen Einheit (1.–3. Oktober) in Dresden führten sen (11. -

Kalkhalbtrockenrasen Im Mittelleine-Innerste-Bergland Ein Bericht Des Ornithologischen Vereins Zu Hildesheim E.V
ISSN 0947-9503 Naturschutzverband Niedersachsen Norddeutsche N N Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems Ornithologischer Verein zu Hildesheim Biotope unterstützt durch das Naturschutzforum Deutschland Schutz und Entwicklung Juli 2005 20 OVH Kalkhalbtrockenrasen im Mittelleine-Innerste-Bergland Ein Bericht des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim e.V. (OVH) von Bernd Galland und Heinrich Hofmeister URGDORF : M.B OTO F Naturschutzgebiet (NSG) „Steinberg bei Wesseln“ mit ausgedehnten Kalkhalbtrockenrasen agerrasen zeichnen sich durch einen schwelle im südlichen Niedersachsen ihre baulich genutzten Täler der Innerste und Mgroßen Arten- und Strukturreichtum nördliche Verbreitungsgrenze erreichen. Leine ausdehnen. Die bis zu 400m hohen aus und gehören zu den schützenswerte- Höhenzüge sind durch zahlreiche Quer- sten Lebensräumen Mitteleuropas. Dem- Das Mittelleine- täler zergliedert und mit stark exponierten entsprechend ziehen sie immer wieder die Innerste-Bergland Hangstufen ausgestattet. Am geologi- Aufmerksamkeit von Botanikern, Ornitho- schen Aufbau der Gebirgslandschaft sind logen, Entomologen und Naturliebhabern Das Landschaftsbild des Mittelleine-Inner- die Formationen der Trias (Buntsandstein, auf sich und regen zu mannigfaltigen ste-Berglandes wird durch bewaldete Muschelkalk, Keuper), der Kreide und des floristischen und faunistischen Beobach- Höhenzüge wie den Hildesheimer Wald Jura beteiligt. tungen an. Das gilt auch für die Kalkhalb- und das Alfelder Bergland mit den Sieben Klimatisch liegt das Mittelleine-Inners- trockenrasen, die im Mittelleine-Innerste- Bergen geprägt, zwischen denen sich die te-Bergland im Übergangsbereich vom Bergland am Rande der Mittelgebirgs- dicht besiedelten und vorwiegend acker- subkontinentalen zum subatlantischen 1 NVN/BSH 2/05 URGDORF OFMEISTER :H.H :M.B OTO OTO F F Wacholdertrift im NSG „Wernershöhe“ Dornige Hauhechel (Ononis spinosa) – Mittelleine-Bergland Zeiger für längere Beweidung Klima, wobei der subatlantische Einfluss hinein weitgehend waldfrei, da sie als deutlich überwiegt. -

Das Naturschutzgebiet „Karlsberg” Bei Hildesheim — Flora1, Vegetation, Zustand Und Entwicklungsmöglichkeiten — 177- 201 Ber
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover Jahr/Year: 1991 Band/Volume: 133 Autor(en)/Author(s): Pardey Andreas Artikel/Article: Das Naturschutzgebiet „Karlsberg” bei Hildesheim — Flora1, Vegetation, Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten — 177- 201 Ber. naturhist. Ges. Hannover 133 177-201 Hannover 1991 Das Naturschutzgebiet „Karlsberg” bei Hildesheim — Flora1, Vegetation, Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten — von A ndreas Pardey mit 2 Abbildungen und 7 Tabellen2 Zusammenfassung: In der vorliegenden für die Bezirksregierung Hannover er stellten Arbeit werden die Ergebnisse der vegetationskundlichen Untersuchung des Natur schutzgebietes „Karlsberg“ am Osthang des Landschaftsschutzgebietes „Sieben Berge, Vorberge und Sackwald“ in den Jahren 1988/1989 vorgestellt. Nach einem kurzen geschicht lichen Abriss folgt eine ausführliche Beschreibung der Flora des Gebietes insbesondere der zahlreichen gefährdeten Arten mit einem Vergleich zu früheren Erhebungen. Anhand pflan zensoziologischer Aufnahmen werden die wesentlichen Vegetationstypen der Gehölz-, Saum- und Kalkmagerrasengesellschaften erläutert und den regional typischen Vegetations ausbildungen gegenübergestellt. Abschließend wird auf der Basis des aktuellen Zustandes das landschaftsökologische Potential und die arealkundliche Bedeutung dieses Gebietes be schrieben und ein überregionales Schutz- und Pflegekonzept gefordert. Summary: -
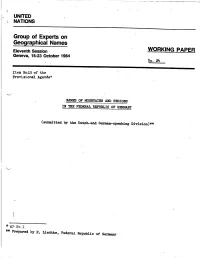
Group of Experts on Geographical Names Z Te^ WORKING PAPER
UNITED NATIONS Group of Experts on Geographical Names ZElevent Teh Sessio^ n WORKING PAPER Geneva, 15-23 October 1984 No. 2U Item NoJ.5 of the Provisional Agenda* . NAMES OF MQUITTAINS AND REGIONS IH THE FEDERAL REPUBLIC OP GERMAHY (submitted by the Butciv-and German-speaking Division)** •* W? Ifo. I ** Prepared by H. Liedtke, Federal Republic of Germany - 2 - GEOGRAPHICAL NAMES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ACCORDING TO THE OFFICIAL GENERAL MAP (UBERSICHTSKARTE) 1:500,000, WORLD MAP SERIE 1404. Compiled by the Permanent Committee on Geographical -Names in the Federal Republic of Germany and prepared for publication by its chairman Prof. Dr. Herbert Liedtke, Geography Department, Ruhr-University, Bochum. Frankfurt am Main May 1984 Adresses; Standiger AusschuB fur Geographische Namen (Permanent Committee on Geographical Names) Institut fiir Angewandte Geodasie Richard-StrauB-Allee 11 D 6000 Frankfurt am Main Prof. Dr. H. Liedtke Ruhr-Universitac Bochum Geographisches Institut Postfach 102148 D 4630 Bochum HOW TO USE THE LIST OF GEOGRAPHICAL NAMES Alphabetical order; A a, A a H h Q o, 6 o U u, U ii B b I i Pp V v Co" J j Q q W w Dd Kk R r • X x Ee LI S s Y y F f . Mm T t Z z G g N n Annotation: A a, Q a £ U ii are handled as a, o & u. 3 can be handled as ss. Examples;_ Breisgau; Underlined names are printed in the Ubersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:500 000. Abteiland: Names not underlined are not printed in the above-mentioned map but are hereby recommended for consideration in a new edition. -

A M T S B L a T T Für Den LANDKREIS HILDESHEIM
A M T S B L A T T für den LANDKREIS HILDESHEIM 2017 Herausgegeben in Hildesheim am 27. Dezember 2017 Nr. 53 Inhalt Seite 04.12.2017 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und Verkündung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sibbesse für das Haushaltsjahr 2017 976 04.12.2017 - Haushaltssatzung und Verkündung der Haushaltssatzung der Gemeinde Sibbesse für das Haushaltsjahr 2018 979 11.12.2017 - Haushaltssatzung und Verkündung der Haushaltssatzung der Stadt Bockenem für das Haushaltsjahr 2018 982 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in den Feuerwehrhäusern Adenstedt, Eberhol- zen, Grafelde, Segeste und Sellenstedt, Gemeinde Sibbesse 985 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in Westfeld und Wrisbergholzen, Gemeinde Sibbesse 988 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Hellmut-Schneider-Mehrzweckhalle im Ortsteil Hönze, Gemeinde Sib- besse 991 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung des Dorfgemeinschaftsraumes im Feuerwehrhaus Petze, Gemeinde Sibbesse 994 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung sowie die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Grillhütte in Sibbesse 997 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in den Feuer- wehrhäusern Adenstedt, Eberholzen, Grafelde, Segeste und Sellenstedt, Gemeinde Sibbesse 999 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in Westfeld und Wrisbergholzen, Gemeinde Sibbesse 1001 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Hellmut-Schneider-Mehrzweckhalle im Ortsteil Hönze, Gemeinde Sibbesse 1003 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftsraumes im Feuer- wehrhaus Petze, Gemeinde Sibbesse 1005 04.12.2017 - Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sibbesse, Landkreis Hildesheim 1006 12.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Gemeinde Algermissen 1016 15.12.2017 - 2. -

Salt in the Neolithic of Central Europe: Production and Distribution
Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe 1 Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa Akten der internationaler Fachtagung (Humboldt-Kolleg) in Provadia, Bulgarien 30 September – 4 October 2010 Herausgegeben von Vassil Nikolov und Krum Bacvarov Provadia • Veliko Tarnovo 2012 2 Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe Proceedings of the International Symposium (Humboldt-Kolleg) in Provadia, Bulgaria 30 September – 4 October 2010 Edited by Vassil Nikolov and Krum Bacvarov Provadia • Veliko Tarnovo 2012 3 Gedruckt mit Unterstützung der Alexander von Humboldt-Stiftung Bonn, Deutschland Printed with the support of the Alexander von Humboldt Foundation Bonn, Germany Sprachredaktion: Krum Bacvarov (Englisch), Tabea Malter (Deutsch), Gassia Artin (Französisch) Grafikdesign: Elka Anastasova © Vassil Nikolov, Krum Bacvarov (Hrsg.) © Verlag Faber, Veliko Tarnovo ISBN 978-954-400-695-2 4 Inhalt / Contens List of Contributors ................................................................................................................................ 7 Vorwort der Herausgeber / Editorial ..................................................................................................... 9 Vassil Nikolov Salt, early complex society, urbanization: Provadia-Solnitsata (5500-4200 BC) ................................. 11 Olivier Weller La production chalcolithique du sel à Provadia-Solnitsata : de la technologie céramique aux implications socio-économiques