B96-2 Flächenstillegung Und Extensivierung in Der Agrarlandschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bodenbewohnende Spinnen Und Weberknechte in Den Sieben Bergen Und Vorbergen (Arachnida: Araneida, Opilionida)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Göttinger Naturkundliche Schriften Jahr/Year: 2005 Band/Volume: 6 Autor(en)/Author(s): Sührig Alexander Artikel/Article: Bodenbewohnende Spinnen und Weberknechte in den Sieben Bergen und Vorbergen (Arachnida: Araneida, Opilionida) 91- 106 Göttinger Naturkundliche Schriften 6, 2005: 91-106 © 2005 Biologische Schutzgemeinschaft Göttingen Bodenbewohnende Spinnen und Weberknechte in den Sieben Bergen und Vorbergen (Arachnida: Araneida, Opilionida) A lexander Sührig In a faunistic study in the „Sieben Berge und Vorberge“ (rural district of Hildes- heim, Southern Lower Saxony) 58 species of spiders (Araneida) and seven (ten) species (taxa) of harvestmen (Opilionida) were detected. In 1999 from April until November the arachnofauna was sampled by means of pitfall traps (n = 18) at three study sites („Horzen“, „Osten-“ and „Drohnenberg“). Dominant (s. 1.) forest-floor spiders were Pardosa saltans (39.0%), Coelotes terrestris (14.0%), Diplocephaluspicinus (7.8%), Lepthyphantes flavipes (4.3%), Apostenus fuscus (3.8%), Coelotes inermis (3.7%), and Histopona torpida (3.5%). The following harvestmen species were at least dominant (s.s.): Rilaena triangularis (39.0%), Anelasmocephalus camhridgei (22.8%), and Trogulus closanicus (21.1%). In the „Sieben Berge und Vorberge“ 60 species of spiders and seven (ten) species (taxa) of harvestmen have been recorded to date. 1 Einleitung 2001). In Niedersachsen sind die im Rahmen ökosystemarer Ansätze am besten untersuch Bisher sind aus den südlich des Mittellandka ten Wälder der Solling (E llen b er g et al. 1986) nals gelegenen Teilen Niedersachsens (=„Süd- und der Göttinger Wald (S c h a e f e r 1989, Niedersachsen“) 550 Spinnenarten bekannt S c h a efer & S c h a u er m a n n 1990). -

Die Berge Und Wir Heft 1/2017
Deutscher Alpenverein Sektion Hannover e. V. Die Berge und wir Ausgabe 1/2017 | Januar - April Der Vorstand informiert MitgliederversammlungFreitag 28. April, 18 Uhr alpenverein-hannover.de 2 VORWORT Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem Heft ist die Veränderung nun nicht mehr zu übersehen. Wir haben das Design vollständig überarbeitet und hoffen, dass es Ihnen genauso gut gefällt wie uns! Wir setzen unsere Vorstellungsreihe der Ehrenämter fort und haben dieses Mal mit un- serem EDV-Beauftragten gesprochen, der uns seine Aufgaben geschildert und uns von seinem Wunsch nach Unterstützung in diesem Amt erzählt hat (S. 52). Vielleicht wäre das etwas für Sie? Wie wäre es mit einem unserer Kurse aus dem Ausbildungsprogramm 2017 (S. 44). Was Sie dort unter anderem erleben können, erfahren Sie im Bericht über die Familien-Ausbil- dungswoche auf Seite 72. Unsere Gruppen waren sehr aktiv und nehmen Sie mit auf eine Wanderung ins Altvater- Gebirge (S. 66), zur Zugspitze (S. 74), auf Fototour nach Bad Zwischenahn (S. 77) und auf die Jubiläumswanderung der Trekkinggruppe (S. 70). Außerdem erfahren Sie mehr über den Anstieg zur Hildesheimer Hütte (S. 68), finden eine Wanderempfehlung am Königssee (S. 75) und können nachlesen, wie der Arbeitseinsatz „Wiese mähen 2016“ an der Kansteinhütte abgelaufen ist (S. 65). Sie können sich auf Seite 54 über die Entwicklung auf der Baustelle unseres Sektionszen- trums informieren und erhalten erste Informationen zu unserer neuen Kletterhalle und den angebotenen Kursen (S. 57). Und natürlich lösen wir das Rätsel um den Namen unserer Jugendseiten und stellen Ihnen die Gewinner vor (S. 10). Auch im nächsten Heft drucken wir gerne Ihre Beiträge und Fotos ab und freuen uns, wenn Sie uns diese bis zum 06. -

Kalkhalbtrockenrasen Im Mittelleine-Innerste-Bergland Ein Bericht Des Ornithologischen Vereins Zu Hildesheim E.V
ISSN 0947-9503 Naturschutzverband Niedersachsen Norddeutsche N N Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems Ornithologischer Verein zu Hildesheim Biotope unterstützt durch das Naturschutzforum Deutschland Schutz und Entwicklung Juli 2005 20 OVH Kalkhalbtrockenrasen im Mittelleine-Innerste-Bergland Ein Bericht des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim e.V. (OVH) von Bernd Galland und Heinrich Hofmeister URGDORF : M.B OTO F Naturschutzgebiet (NSG) „Steinberg bei Wesseln“ mit ausgedehnten Kalkhalbtrockenrasen agerrasen zeichnen sich durch einen schwelle im südlichen Niedersachsen ihre baulich genutzten Täler der Innerste und Mgroßen Arten- und Strukturreichtum nördliche Verbreitungsgrenze erreichen. Leine ausdehnen. Die bis zu 400m hohen aus und gehören zu den schützenswerte- Höhenzüge sind durch zahlreiche Quer- sten Lebensräumen Mitteleuropas. Dem- Das Mittelleine- täler zergliedert und mit stark exponierten entsprechend ziehen sie immer wieder die Innerste-Bergland Hangstufen ausgestattet. Am geologi- Aufmerksamkeit von Botanikern, Ornitho- schen Aufbau der Gebirgslandschaft sind logen, Entomologen und Naturliebhabern Das Landschaftsbild des Mittelleine-Inner- die Formationen der Trias (Buntsandstein, auf sich und regen zu mannigfaltigen ste-Berglandes wird durch bewaldete Muschelkalk, Keuper), der Kreide und des floristischen und faunistischen Beobach- Höhenzüge wie den Hildesheimer Wald Jura beteiligt. tungen an. Das gilt auch für die Kalkhalb- und das Alfelder Bergland mit den Sieben Klimatisch liegt das Mittelleine-Inners- trockenrasen, die im Mittelleine-Innerste- Bergen geprägt, zwischen denen sich die te-Bergland im Übergangsbereich vom Bergland am Rande der Mittelgebirgs- dicht besiedelten und vorwiegend acker- subkontinentalen zum subatlantischen 1 NVN/BSH 2/05 URGDORF OFMEISTER :H.H :M.B OTO OTO F F Wacholdertrift im NSG „Wernershöhe“ Dornige Hauhechel (Ononis spinosa) – Mittelleine-Bergland Zeiger für längere Beweidung Klima, wobei der subatlantische Einfluss hinein weitgehend waldfrei, da sie als deutlich überwiegt. -

Das Naturschutzgebiet „Karlsberg” Bei Hildesheim — Flora1, Vegetation, Zustand Und Entwicklungsmöglichkeiten — 177- 201 Ber
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover Jahr/Year: 1991 Band/Volume: 133 Autor(en)/Author(s): Pardey Andreas Artikel/Article: Das Naturschutzgebiet „Karlsberg” bei Hildesheim — Flora1, Vegetation, Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten — 177- 201 Ber. naturhist. Ges. Hannover 133 177-201 Hannover 1991 Das Naturschutzgebiet „Karlsberg” bei Hildesheim — Flora1, Vegetation, Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten — von A ndreas Pardey mit 2 Abbildungen und 7 Tabellen2 Zusammenfassung: In der vorliegenden für die Bezirksregierung Hannover er stellten Arbeit werden die Ergebnisse der vegetationskundlichen Untersuchung des Natur schutzgebietes „Karlsberg“ am Osthang des Landschaftsschutzgebietes „Sieben Berge, Vorberge und Sackwald“ in den Jahren 1988/1989 vorgestellt. Nach einem kurzen geschicht lichen Abriss folgt eine ausführliche Beschreibung der Flora des Gebietes insbesondere der zahlreichen gefährdeten Arten mit einem Vergleich zu früheren Erhebungen. Anhand pflan zensoziologischer Aufnahmen werden die wesentlichen Vegetationstypen der Gehölz-, Saum- und Kalkmagerrasengesellschaften erläutert und den regional typischen Vegetations ausbildungen gegenübergestellt. Abschließend wird auf der Basis des aktuellen Zustandes das landschaftsökologische Potential und die arealkundliche Bedeutung dieses Gebietes be schrieben und ein überregionales Schutz- und Pflegekonzept gefordert. Summary: -
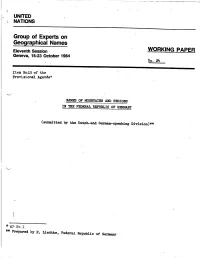
Group of Experts on Geographical Names Z Te^ WORKING PAPER
UNITED NATIONS Group of Experts on Geographical Names ZElevent Teh Sessio^ n WORKING PAPER Geneva, 15-23 October 1984 No. 2U Item NoJ.5 of the Provisional Agenda* . NAMES OF MQUITTAINS AND REGIONS IH THE FEDERAL REPUBLIC OP GERMAHY (submitted by the Butciv-and German-speaking Division)** •* W? Ifo. I ** Prepared by H. Liedtke, Federal Republic of Germany - 2 - GEOGRAPHICAL NAMES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ACCORDING TO THE OFFICIAL GENERAL MAP (UBERSICHTSKARTE) 1:500,000, WORLD MAP SERIE 1404. Compiled by the Permanent Committee on Geographical -Names in the Federal Republic of Germany and prepared for publication by its chairman Prof. Dr. Herbert Liedtke, Geography Department, Ruhr-University, Bochum. Frankfurt am Main May 1984 Adresses; Standiger AusschuB fur Geographische Namen (Permanent Committee on Geographical Names) Institut fiir Angewandte Geodasie Richard-StrauB-Allee 11 D 6000 Frankfurt am Main Prof. Dr. H. Liedtke Ruhr-Universitac Bochum Geographisches Institut Postfach 102148 D 4630 Bochum HOW TO USE THE LIST OF GEOGRAPHICAL NAMES Alphabetical order; A a, A a H h Q o, 6 o U u, U ii B b I i Pp V v Co" J j Q q W w Dd Kk R r • X x Ee LI S s Y y F f . Mm T t Z z G g N n Annotation: A a, Q a £ U ii are handled as a, o & u. 3 can be handled as ss. Examples;_ Breisgau; Underlined names are printed in the Ubersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:500 000. Abteiland: Names not underlined are not printed in the above-mentioned map but are hereby recommended for consideration in a new edition. -

A M T S B L a T T Für Den LANDKREIS HILDESHEIM
A M T S B L A T T für den LANDKREIS HILDESHEIM 2017 Herausgegeben in Hildesheim am 27. Dezember 2017 Nr. 53 Inhalt Seite 04.12.2017 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und Verkündung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sibbesse für das Haushaltsjahr 2017 976 04.12.2017 - Haushaltssatzung und Verkündung der Haushaltssatzung der Gemeinde Sibbesse für das Haushaltsjahr 2018 979 11.12.2017 - Haushaltssatzung und Verkündung der Haushaltssatzung der Stadt Bockenem für das Haushaltsjahr 2018 982 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in den Feuerwehrhäusern Adenstedt, Eberhol- zen, Grafelde, Segeste und Sellenstedt, Gemeinde Sibbesse 985 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in Westfeld und Wrisbergholzen, Gemeinde Sibbesse 988 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Hellmut-Schneider-Mehrzweckhalle im Ortsteil Hönze, Gemeinde Sib- besse 991 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung des Dorfgemeinschaftsraumes im Feuerwehrhaus Petze, Gemeinde Sibbesse 994 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung sowie die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Grillhütte in Sibbesse 997 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in den Feuer- wehrhäusern Adenstedt, Eberholzen, Grafelde, Segeste und Sellenstedt, Gemeinde Sibbesse 999 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in Westfeld und Wrisbergholzen, Gemeinde Sibbesse 1001 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Hellmut-Schneider-Mehrzweckhalle im Ortsteil Hönze, Gemeinde Sibbesse 1003 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftsraumes im Feuer- wehrhaus Petze, Gemeinde Sibbesse 1005 04.12.2017 - Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sibbesse, Landkreis Hildesheim 1006 12.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Gemeinde Algermissen 1016 15.12.2017 - 2. -

Jakobsweg Freden (L.) - Bad Gandersheim
Wandern Jakobsweg Freden (L.) - Bad Gandersheim Länge: 13,27 km Start: Bahnhof Freden (Leine) Steigung:+ 206 m / - 206 m Verlauf: Freibad, Schildhorst, Helleberg, Clusturm, Bad Dauer: ca. 3 Stunden Gandersheim Ziel: Parkplatz Kurhaus Bad Gandersheim Überblick Bad Gandersheim zum Kurhaus. Bahnhof Freden , Freibad Freden, Schildhorst, Besuchen Sie : Die Klosterkiche Clus, das Kloster Kammweg Helleberg, Bad Gandersheim Brunshausen und den Dom von Bad Gandersheim. INFOS www.bad-gandersheim-online.de/stadtrundgang.cfm Mit dem Bus können wir nach Kreiensen fahren. Hier hält auch der Metronom mit dem wir wieder in Richtung Hannover oder Göttingen fahren können. Urheber: © Günter Lampe , Verkehrsverein Südlicher Sackwald Schild Pilgerweg Tourbeschreibung Start Bahnhof Freden (Leine). Vom Bahnhof Freden (Leine) geht es durch die Bahn-Unterführung auf die andere Seite der Bahnstrecke Hannover-Göttingen. Entlang der Alfelder Straße an der Apotheke vorbei wandern wir auf dem Gehweg entlang Freibad Freden (Leine) der Winzenburger Straße in Richtung Winzenburg. Dann biegen wir nach rechts ab, in die Schildhorster Straße, Schwierigkeit kommen am Freibad Freden (Leine) vorbei und haben auf der folgenden Anhöhe eine schöne Sicht ins Leintal. In Schildhorst Keine großen Steigungen , Feld- und Waldwege gehen wir auf der Durchgangsstraße fast durch den ganzen Ort. Kurz vor dem Ortsende kreuzt der Europa-Weg 11 und Barrierefreiheit der Jakobsweg die Hauptstraße. Dieser Wanderweg Diese Tour ist mit Einschränkungen barrierefrei. verschwindet rechts im Wald. Wir folgen der Ausschilderung der beiden Wanderwege auf den Kammweg des Helleberges. Beschilderung Jetzt geht es auf Wald-, Wiesen und Feldwegen einige Kilometer geradeaus auf Bad Gandersheim zu. Nicht weit vom Die Tour ist ausgeschildert. Wanderweg liegt der Waldfriedhof der Familie Pferdmenge Ab Schildhorst E 11 und Muschel des Jakobsweges (Hilprechtshausen) oder befinden sich Hügelgräber (in der Nähe von Hechenbeck). -

Hydrogeologische Räume Und Teilräume in Niedersachsen
GeoBerichte 3 LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE Hydrogeologische Räume und Teilräume in Niedersachsen Niedersachsen GeoBerichte 3 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Hydrogeologische Räume und Teilräume in Niedersachsen JÖRG ELBRACHT, RENATE MEYER & EVELIN REUTTER Hannover 2016 Impressum Herausgeber: © Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Stilleweg 2 30655 Hannover Tel. (0511) 643-0 Fax (0511) 643-2304 Download unter www.lbeg.niedersachsen.de 3. Auflage. Version: 04.05.2017 Redaktion: Ricarda Nettelmann e-mail: [email protected] Titelbild: Falschfarbenbild des Harlinger Landes und der Ostfriesischen Inseln zwischen Emsmündung und Jadebusen (Foto: Satellitenbild Landsat TM, zur Verfügung gestellt von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Fachbe- reich B 4.4). ISSN 1864–6891 (Print) ISSN 1864–7529 (digital) DOI 10.48476/geober_3_2016 GeoBer. 3 S. 3 – 118 42 Abb. Hannover 2016 Hydrogeologische Räume und Teilräume in Niedersachsen JÖRG ELBRACHT, RENATE MEYER & EVELIN REUTTER mit Beiträgen von BERND LINDER & CHRISTINA MAI Kurzfassung Im Zuge der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) wurde eine Be- schreibung der Grundwasserleiter und ihrer Eigenschaften erarbeitet. Dazu haben die Staatlichen Geologischen Dienste Deutschlands ein hierarchisches System von Hydrogeologischen Großräu- men, Räumen und Teilräumen entwickelt, mit dem Gebiete mit vergleichbaren geologischen und hydrogeologischen Eigenschaften nach einem bundesweit einheitlichen Verfahren beschrieben wer- den. Mit dem GeoBericht „Hydrogeologische Räume und Teilräume in Niedersachsen“ wird ein flächen- deckender Überblick der hydrogeologischen Verhältnisse in Niedersachsen vorgelegt. Dabei werden durch die Darstellung der elf Hydrogeologischen Räume zunächst die wesentlichen hydrogeologi- schen Gegebenheiten vermittelt. Die elf Hydrogeologischen Räume wurden weiter untergliedert in 81 Hydrogeologische Teilräume, die sich ganz oder teilweise in Niedersachsen erstrecken. -

Tabelle FFH-Gebiete
Aktuelle Schutzgebiete / FFH-Gebiete in Bearbeitung Nr. Name Vorhandene Status des Arbeitstandes nach Verfahrensablauf Betroffenen Gemeinde/n Schutzgebiete (s. Schaubild) 114 Ith NSG + LSG Ithwiesen abgegeben an LK Hameln -Pyrmont Samtgemeinde Leinebergland 115 Haseder Busch NSG Haseder Busch Schritt 1 Giesen Giesener Wald LSG Giesener Berge und Schritt 1 Giesen 115 Teiche 115 Osterberg - Schritt 2 Giesen Sieben Berge, Vorberge ; NSGs Wernershöhe, Schritt 2 abgeschlossen; Schritt 3 Stadt Alfeld, Gemeinde Sibesse Trockenlebensräume (Unterer Unterer Lauensberg, abgeschlossen, Schritt 4 wird vorbereitet Lauensberg, Schiefer Holzer Karlsberg, Schieferholzer 117 Berg, Karlsberg, Wernershöhe, Berg, Ortsberg) ND Abbenser Berg, LSG Sieben Berge und Vorberge Sieben Berge, Vorberge; LSG Sieben Berge und geplant Stadt Alfeld, Gemeinde Sibesse + 117 Waldbereiche Vorberge Samtgemeinde Leinebergland 118 Duinger Wald NSG Duinger Wald Schritt 3 Samtgemeinde Leinebergland Amphibienbiotop Weenzer Bruch - Behandlung im Rahmen des Life -Antrages LIFE Samtgemeinde Leinebergland 118 BOVAR Amphibienbiotope an der Hohen - abgegeben an LK Holzminden Samtgemeinde Leinebergland 119 Warte Laubwälder und Klippenbereiche LSG Selter abgegeben an LK Northeim Gemeinde Freden 169 im Selter, Hils und Greener Wald Mausohr-Wochenstubengebiet - nicht erforderlich 341 Hildesheimer Bergland Leineaue zwischen Hannover NSG Leineaue zwischen Abgegeben an Region Hannover Sarstedt 344 und Ruthe Ruthe und Kolding, LSG Bodenabbau bei Heisede Hallerburger Holz LSG Limberg, Schritt 1 -

Wandern Im Südlichen Sackwald Bei Freden (Leine)
Wandern Wandern im südlichen Sackwald bei Freden (Leine) Länge: 12,72 km Start: Bahnhof Freden (Leine) Steigung:+ 302 m / - 144 m Verlauf: Winzenburg, Südlicher Sackwald, Everode, Freden (L.) Ziel: Freden (Leine) Überblick Bahnhof Freden (Leine) - Radweg nach Winzenburg- Apenteichquelle- Ahnewelle- Burkhardtshöhe - Rüstiberg- Sportplatz Everode- Everode- Meierbachtal- Klärteiche- Mittelberg- Reihersnest-Steinkampstraße- Eisenbahnfußgängerbrücke- Sportzentrum - Masch- Bahnhof. Grillhütte Apenteich Rathaus Freden Schwierigkeit Tourbeschreibung Mäßige Steigungen im südlichen Sackwald und zurück über den Mittelberg. Die Tour beginnt am Bahnhof Freden (Leine). Anfahrt Durch die Bahnunterführung zur Alfelder Straße. Anreise mit der Bahn: Nachdem sie die Bahnunterführung passiert haben, geht es weiter , am Hotel heipke vorbei, die Winzenburger Str. Freden (Leine) liegt an der Nord-Süd-Strecke entlang, Richtung winzenburg. Hannover-Göttingen, hier hält stündlich der Metronom. Nun gelangen sie auf den Radweg nach Klump. In diesem Anreise mit dem Auto: Abschnitt der Strecke wird sie der Winzenburger Bach ein Stück weit begleiten. Vorbei an Teich- und Sägemühle weiter Über die A 7 kommend bis Ausfahrt Rhüden, dann über in Richtung Winzenburg zur Apenteichquelle. Dort Lamspringe, Winzenburg angekommen folgen sie dem Waldweg hinauf, bis kurz vor die nach Freden (Leine). Feldmark von Hornsen. Sie wandern dann in Richtung Rennstieg, vorbei an der Burkhardtshöhe am Rüstiberg direkt Position zum Sportplatz Everode. Nun durchqueren sie den Ort in Richtung Meimerhausen und das Tal des Meierbaches. Vor N 51° 55.67234', E 009° 53.95064' den Klärteichen biegen sie links in ein Wäldchen ein und folgen dem Pfad den Mittelberg hinauf. Nun nähert sich Kontakt und Infos unsere Tour dem Ende, es geht zurück Richtung Freden Verkehrsverein Südlicher Sackwald e.V. -

Urlaubs- Magazin 2021
Urlaubs- magazin 2021 www.leinebergland-tourismus.de Herzlich Willkommen im Leinebergland Themenseiten Wandern ......................................................................4 Unberührte Natur mit sanften Hügeln und weiten Buchenwäldern, idyllische Felder, traditionelle Ursprünglichkeit und gemütliche Orte mit Fachwerkcharme – entdecken Sie das Leinebergland im Radfahren ....................................................................8 Weserbergland! Weitere Aktivitäten ................................................. 10 Hier können Sie entspannen und den Alltag hinter sich lassen. Sie möchten in Ihrem Urlaub lieber aktiv Entdeckertipps ..........................................................12 sein? Wie wäre es mit einer ausgiebigen Wanderung oder einer Radtour auf dem Leine-Heide-Radweg? Oder erkunden Sie das Leinebergland bei einer Kanutour auf der Leine vom Wasser aus. Spüren Sie die Historisches Weserbergland ................................. 19 Idylle im Leinebergland, tauchen Sie ein in unsere Region und erleben Sie viele verborgene Schätze. Regionalmarke Leinebergland pur ..................... 27 Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Tourist-Information im Regionalbüro Marktstraße 1 31061 Alfeld (Leine) Ihre Ferienorte Tel.: 0 51 81 / 8 06 68 09 Alfeld (Leine) ............................................................. 14 Fax: 0 51 81 / 8 06 68 10 [email protected] Elze ...............................................................................20 www.leinebergland-tourismus.de Freden (Leine) -

Rennstieg - Alter Kurierweg- Hildesheim-Winzenburg
Rennstieg - Alter Kurierweg- Hildesheim-Winzenburg Streckenverlauf Hildesheim-Domhof, Hildesheimer Dom- Eberholzen 17, 5 km; Eberholzen-Wernershöhe 11 km; Wernershöhe, Winzenburg 17 km, Länge 42,0 km Anfahrtsbeschreibung Hildesheim Hbf Bushaltestellen in Eberholzen, auf Wernershöhe und in Winzenburg. Wanderparkplätze in Eberholzen, Winzenburg und auf Wernerhöhe. Schwierigkeit der Tour Leicht bis mittelschwer. Kontaktmöglichkeit Verkehrsverein Freden (Leine) www.verkehrsverein-freden.de [email protected] Weitere Informationen Beschilderung Diese Tour ist ausgeschildert. Weißes "R" "Königskrone " "K" und Gelbe Jacobsmuschel auf blauem Grund" Kartenmaterial Für diese Tour ist Kartenmaterial erhältlich. Wander- und Freizeitkarte- Region Hildesheim mit Leinebergland ISBN 978-3-00-002124-4 Link zum Kartenmaterial: www.hi-reg.de Geolife | das Freizeitportal Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen Podbielskistraße 331, D-30659 Hannover Telefon: +49 - 05 11 - 6 46 09 - 0 | Telefax: +49 - 05 11 - 6 46 09 - 1 65 [email protected] | www.geolife.de | www.lgn.de Rennstieg - Alter Kurierweg- Hildesheim-Winzenburg Tourenbeschreibung Vom Dom in Hildesheim geht es durch die Stadt über die Steinbergstraße in Richtung Hildesheimer Wald. Erste Station zur Rast und zur Besichtigung ist das Kloster Marienrode. Von hieraus geht es in den Hildesheimer Wald - die Firma Bosch-Blaupunkt - lassen wir Rechts liegen. Weiter geht es über den Kammweg nach Diekholzen. Am Krankenhaus und Kaliwerk vorbei ins Beustertal. Wir sehen die ICE-Strecke, die dann unter uns im Tunnel (Eichbergtunnel) weiterführt. Zwischen dem Haiberg und Linkberg, sowie dem Hainholzberg gelangen wir durch ein kleines Bachtal nach Nienstedt. Weiter geht es über die L 482 durch den Ort Nienstedt und durch die Feldmarkt in den Ort Eberholzen. >Busanschluss RVHI Linie 51 nach Gronau (L.) und weiter nach Hildesheim< Bei Eberholzen am Waldrand befindet sich ein Wanderparkplatz.