Die Waldgesellschaften Des Hildeheimer Waldes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bodenbewohnende Spinnen Und Weberknechte in Den Sieben Bergen Und Vorbergen (Arachnida: Araneida, Opilionida)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Göttinger Naturkundliche Schriften Jahr/Year: 2005 Band/Volume: 6 Autor(en)/Author(s): Sührig Alexander Artikel/Article: Bodenbewohnende Spinnen und Weberknechte in den Sieben Bergen und Vorbergen (Arachnida: Araneida, Opilionida) 91- 106 Göttinger Naturkundliche Schriften 6, 2005: 91-106 © 2005 Biologische Schutzgemeinschaft Göttingen Bodenbewohnende Spinnen und Weberknechte in den Sieben Bergen und Vorbergen (Arachnida: Araneida, Opilionida) A lexander Sührig In a faunistic study in the „Sieben Berge und Vorberge“ (rural district of Hildes- heim, Southern Lower Saxony) 58 species of spiders (Araneida) and seven (ten) species (taxa) of harvestmen (Opilionida) were detected. In 1999 from April until November the arachnofauna was sampled by means of pitfall traps (n = 18) at three study sites („Horzen“, „Osten-“ and „Drohnenberg“). Dominant (s. 1.) forest-floor spiders were Pardosa saltans (39.0%), Coelotes terrestris (14.0%), Diplocephaluspicinus (7.8%), Lepthyphantes flavipes (4.3%), Apostenus fuscus (3.8%), Coelotes inermis (3.7%), and Histopona torpida (3.5%). The following harvestmen species were at least dominant (s.s.): Rilaena triangularis (39.0%), Anelasmocephalus camhridgei (22.8%), and Trogulus closanicus (21.1%). In the „Sieben Berge und Vorberge“ 60 species of spiders and seven (ten) species (taxa) of harvestmen have been recorded to date. 1 Einleitung 2001). In Niedersachsen sind die im Rahmen ökosystemarer Ansätze am besten untersuch Bisher sind aus den südlich des Mittellandka ten Wälder der Solling (E llen b er g et al. 1986) nals gelegenen Teilen Niedersachsens (=„Süd- und der Göttinger Wald (S c h a e f e r 1989, Niedersachsen“) 550 Spinnenarten bekannt S c h a efer & S c h a u er m a n n 1990). -

Organigramm Des Kirchenamtes Hildesheim Telefon: 05121 100-0 Telefax: 05121 100-999 (Sekretariat OG)
Verwaltungsleitung Jens Stöber, Tel. -600 Querschnittsaufgaben Organigramm des Kirchenamtes Hildesheim Monika Reicke*) / Andrea Hildebrandt / Sabine Reich-Meyer*) Stand: 01.01.2018 · Leitung Kirchenamt Tel. -601 / -603 / -601 Telefon: 05121 100-0 · Betreuung Verbandsvorstand · Postausgang / · Posteingang Telefax: 05121 100-999 (Sekretariat OG) · Erteilung von Genehmigungen nach KGO und KKO sowie · Registratur/Archiv / · Sitzungsdienst Beanstandung von Beschlüssen · Telefonzentrale · Budgetplanung Datenschutzbeauftragte: Elke Schünemann * -106 · Betreuung Kirchenkreisverband Hildesheim Fachbereich I Fachbereich II Fachbereich III Fachbereich IV Fachbereich V - Finanz- und Bauwesen - Rechnungswesen – - Liegenschaften / Friedhöfe / EDV / - Personalwesen – - Diakonie - Fachbereichsleiter: Hartmut Haase Meldewesen Fachbereichsleiter: Helmut Jost Tel. -200 Fachbereichsleiter: Matthias Wehling Fachbereichsleiter: Sven Böning Fachbereichsleiterin: Cordula Stepper Tel. -100 · Leitung des Fachbereiches Tel. -300 Tel. -400 Tel. -500 · stellvertretende Verwaltungsleitung · Verwaltung Rücklagen- u. Darlehensfonds (RDF) · Leitung des Fachbereiches · Leitung des Fachbereiches · stellvertretende Verwaltungsleitung · Leitung des Fachbereiches · Disposition der Geldanlagen · Generalia Liegenschaften und · grundsätzliche Fragen des · Leitung des Fachbereiches · Finanzplanung/Gesamtzuweisung Kirchenkreisverband · Aufsicht über Zahlstellen Ersatzlanderwerbe, EDV, Meldewesen Arbeits- und Dienstrechtes · Betreuung · Betreuung Kirchenkreisvorstand und FiPla-Ausschuss -

Hohe Tafel / Sieben Berge
Wandern Hohe Tafel / Sieben Berge Länge: 12,58 km Start: Wanderparkplatz Brüggen,Kirschweg ,Waldrand Steigung:+ 534 m / - 365 m Verlauf: Hohe Tafel Binnewiesturm Dauer: ca 3,5 Stunden Ziel: Wanderparkplatz Brüggen,Kirschweg ,Waldrand Hörzenhütte Überblick ins Leinetal schauen kann. Rundwanderung Der Binnewiesturm in den Sieben Bergen bei Brüggen. Die Brüggen-Kirschweg- Höchste Erhebung der Sieben Berge, die Hohe Tafel (395 m Waldrand-hörzenhütte-Tafelbergturm-Rennstieg-Heinumer-Sp ü. NN). Der erste Aussichtsturm auf dem Sieben Bergen war ortplatz -Fluggelände-Rhedener Wald -Waldrandweg zum ein von Rhedenern gebauter Holzturm. Dieser entstand in der Ausgangspunkt Zeit 1880 – 1890. 1926 wurde durch den Alfelder Verschönerungsverein der heutige Turm errichtet. Über den historichen Rennstieg geht es ein Stück in Richtung Eberholzen/Hildesheim. Dann biegen wir links ab am Nußberg entlang Richtung Heinumer Sportplatz. Weiter am Waldrand entlang Richtung Rheden vorbei am Flugplatz. Dann links am Waldrand zurück zur Hörzenhütte. Copyright: Günter Lampe, Delligsen [email protected] Binnewiesturm auf der Hohen Tafel Tourbeschreibung Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Brüggen,Kirschweg am Waldrand Holzer Schleie Holzer Schleie, Nesselberg, Waldweg rauf zur Hohen Tafel (395 m) Die Sieben Berge, deren höchster Berg die Hohe Tafel (395 m) ist, sind in Nord-Süd-Richtung: Blick von der Hohen Tafel * Hörzen (364,1 m) – östlich von Brüggen Schwierigkeit * Hohe Tafel (395 m; auch Tafelberg) – ost-südöstlich v. Brüggen – mit Ernst-Binnewies-Turm (Volksmund: Einige Höhenmeter zu überwinden. Tafelbergturm, Aussichtsturm) von Höhe 128 m auf 397 m Hohe Tafel * Saalberg (313,2 m) – südöstlich von Brüggen Belohnung :Schöne Aussichten * Ostenberg (359,8 m) – östlich von Dehnsen (OT Alfelds) * Lauensberg (333,4 m) – nord-nordöstlich von Eimsen (OT Barrierefreiheit Alfelds) * Heimberg (316,3 m) – nordöstlich von Eimsen Die Tour ist nicht barrierefrei. -

Der April Verzaubert Frühlingsmarkt · Autoschau · Kreative Freizeitideen SIEBEN: April Monatlich Unabhängig Unbezahlbar 2016 2 Editorial
Jahre April 2016 20. Jahrgang www.sieben-regional.de Der April verzaubert Frühlingsmarkt · Autoschau · kreative Freizeitideen SIEBEN: April monatlich unabhängig unbezahlbar 2016 2 Editorial Aus dem Inhalt Rückblick auf die Zukunft Jahre Liebe Leserinnen und Leser, ten Minute noch gewonnen hatten. Somit konn- 20 Jahre SIEBEN: 4 – 5 ten sie die Liga halten. Der amtierende Meister irgendwie ist dieses Jahr 2016 noch verbesse- stammt somit auch nicht aus der Bayerischen Lan- rungsfähig. Wo man hinhört, klagen die Menschen deshauptstadt. oder haben Angst, und die Gründe dafür sind nicht Frühlingsmarkt 6 – 7 zu übersehen. Man denke nur an den Terrorismus, Beim Eurovision Song Contest in Stockholm am 14. der längst in Europa angekommen ist, die theoreti- Mai war Deutschland übrigens nicht letzter gewor- schen und praktischen Schwierigkeiten bei der In- den. Der Sommer kam gänzlich ohne Bombenat- tegration neuer und alter Mitbürger, die Wahlerfol- tentate aus, und Pyrotechnik beschränkte sich auf ge der AfD und die Kriege überall auf der Welt… die Open Airs in Scheeßel (24.–26. Juni) oder Wa- Garten 8 cken (4.–6. August). Aber vielleicht sollte man einfach einmal positiver denken, alles aus der Positiv-Perspektive betrach- Auch beim Oktoberfest in München gab es keine ten. Mit einem Rückblick auf die nähere Zukunft. Personenschäden zu beklagen sondern nur die im- Stellen wir uns vor, wir schauten Ende 2016 auf ei- mer noch ungebremste Niederlagenserie der Bay- Gesundheit 9 – 12 nige Ereignisse des laufendes Jahres: Bei den Wah- ern. Und die Feierlichkeiten zum Tag der Deut- len in Meck-Pomm (4. September), Niedersach- schen Einheit (1.–3. Oktober) in Dresden führten sen (11. -

Das Naturschutzgebiet „Karlsberg” Bei Hildesheim — Flora1, Vegetation, Zustand Und Entwicklungsmöglichkeiten — 177- 201 Ber
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover Jahr/Year: 1991 Band/Volume: 133 Autor(en)/Author(s): Pardey Andreas Artikel/Article: Das Naturschutzgebiet „Karlsberg” bei Hildesheim — Flora1, Vegetation, Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten — 177- 201 Ber. naturhist. Ges. Hannover 133 177-201 Hannover 1991 Das Naturschutzgebiet „Karlsberg” bei Hildesheim — Flora1, Vegetation, Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten — von A ndreas Pardey mit 2 Abbildungen und 7 Tabellen2 Zusammenfassung: In der vorliegenden für die Bezirksregierung Hannover er stellten Arbeit werden die Ergebnisse der vegetationskundlichen Untersuchung des Natur schutzgebietes „Karlsberg“ am Osthang des Landschaftsschutzgebietes „Sieben Berge, Vorberge und Sackwald“ in den Jahren 1988/1989 vorgestellt. Nach einem kurzen geschicht lichen Abriss folgt eine ausführliche Beschreibung der Flora des Gebietes insbesondere der zahlreichen gefährdeten Arten mit einem Vergleich zu früheren Erhebungen. Anhand pflan zensoziologischer Aufnahmen werden die wesentlichen Vegetationstypen der Gehölz-, Saum- und Kalkmagerrasengesellschaften erläutert und den regional typischen Vegetations ausbildungen gegenübergestellt. Abschließend wird auf der Basis des aktuellen Zustandes das landschaftsökologische Potential und die arealkundliche Bedeutung dieses Gebietes be schrieben und ein überregionales Schutz- und Pflegekonzept gefordert. Summary: -

A M T S B L a T T Für Den LANDKREIS HILDESHEIM
A M T S B L A T T für den LANDKREIS HILDESHEIM 2017 Herausgegeben in Hildesheim am 27. Dezember 2017 Nr. 53 Inhalt Seite 04.12.2017 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und Verkündung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sibbesse für das Haushaltsjahr 2017 976 04.12.2017 - Haushaltssatzung und Verkündung der Haushaltssatzung der Gemeinde Sibbesse für das Haushaltsjahr 2018 979 11.12.2017 - Haushaltssatzung und Verkündung der Haushaltssatzung der Stadt Bockenem für das Haushaltsjahr 2018 982 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in den Feuerwehrhäusern Adenstedt, Eberhol- zen, Grafelde, Segeste und Sellenstedt, Gemeinde Sibbesse 985 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in Westfeld und Wrisbergholzen, Gemeinde Sibbesse 988 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Hellmut-Schneider-Mehrzweckhalle im Ortsteil Hönze, Gemeinde Sib- besse 991 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung des Dorfgemeinschaftsraumes im Feuerwehrhaus Petze, Gemeinde Sibbesse 994 04.12.2017 - Satzung über die Benutzung sowie die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Grillhütte in Sibbesse 997 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in den Feuer- wehrhäusern Adenstedt, Eberholzen, Grafelde, Segeste und Sellenstedt, Gemeinde Sibbesse 999 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Dorfgemeinschaftsräume in Westfeld und Wrisbergholzen, Gemeinde Sibbesse 1001 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Hellmut-Schneider-Mehrzweckhalle im Ortsteil Hönze, Gemeinde Sibbesse 1003 04.12.2017 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftsraumes im Feuer- wehrhaus Petze, Gemeinde Sibbesse 1005 04.12.2017 - Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sibbesse, Landkreis Hildesheim 1006 12.12.2017 - Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Gemeinde Algermissen 1016 15.12.2017 - 2. -

Salt in the Neolithic of Central Europe: Production and Distribution
Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe 1 Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa Akten der internationaler Fachtagung (Humboldt-Kolleg) in Provadia, Bulgarien 30 September – 4 October 2010 Herausgegeben von Vassil Nikolov und Krum Bacvarov Provadia • Veliko Tarnovo 2012 2 Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe Proceedings of the International Symposium (Humboldt-Kolleg) in Provadia, Bulgaria 30 September – 4 October 2010 Edited by Vassil Nikolov and Krum Bacvarov Provadia • Veliko Tarnovo 2012 3 Gedruckt mit Unterstützung der Alexander von Humboldt-Stiftung Bonn, Deutschland Printed with the support of the Alexander von Humboldt Foundation Bonn, Germany Sprachredaktion: Krum Bacvarov (Englisch), Tabea Malter (Deutsch), Gassia Artin (Französisch) Grafikdesign: Elka Anastasova © Vassil Nikolov, Krum Bacvarov (Hrsg.) © Verlag Faber, Veliko Tarnovo ISBN 978-954-400-695-2 4 Inhalt / Contens List of Contributors ................................................................................................................................ 7 Vorwort der Herausgeber / Editorial ..................................................................................................... 9 Vassil Nikolov Salt, early complex society, urbanization: Provadia-Solnitsata (5500-4200 BC) ................................. 11 Olivier Weller La production chalcolithique du sel à Provadia-Solnitsata : de la technologie céramique aux implications socio-économiques -
![Important Bird Areas (Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland 17 ]](https://docslib.b-cdn.net/cover/2616/important-bird-areas-bedeutende-vogelschutzgebiete-in-deutschland-17-2272616.webp)
Important Bird Areas (Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland 17 ]
[ SUDFELDT, C. et al.: Important Bird Areas (Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland 17 ] CHRISTOPH SUDFELDT und DANIEL DOER (Dachverband Deutscher Avifaunisten) HERMANN HÖTKER, CLAUS MAYR und CHRISTIAN UNSELT (NABU-Naturschutzbund Deutschland) ANDREAS VON LINDEINER (Landesbund für Vogelschutz Bayern) HANS-GÜNTHER BAUER (AG „IBA“ im Deutschen Rat für Vogelschutz) Important Bird Areas (Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland - überarbeitete und aktualisierte Gesamtliste (Stand 01.07.2002) - Abstract Sudfeldt, C., D. Doer, H. Hötker, C. Mayr, C. Unselt, A.v. Lindeiner & H.-G. Bauer: Important Bird Areas in Germany – revised updated and completed list (state of 1st July 2002). Ber. Vogelschutz 38: 17-109. BirdLife International’s publications on IBAs in 1989 and in 2000 mentioned 107 sites and 285 sites resp. in Germany. Meanwhile, through recent intensive investigations, the list of German IBAs has been completed and now contains 542 sites which are named and briefly characterized in this publication. IBAs cover an area of 56.509 km² in Germany, equal to a share of 15.8 of land surface. IBAs were selected in accordance with internatio- nal criteria which are specified for Germany by DOER et al. (2002) in this issue. Data collection and site selection have been performed by the federal branches of NABU (BirdLife partner Germany) and regional ornithological societies under the umbrella of Dachverband Deutscher Avifaunisten. The procedure of site selection in different federal states is detailed in separate chapters. The list of IBAs is sorted by federal states and shows names, national and international codes, geographical coordinates, size, and criteria used for selection. For IBAs which have been designated as SPAs, SPA codes are given. -

Strategie Zum Biotopschutz in Niedersachsen
Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz Vollzugshinweise zum Schutz der FFH-Lebensraumtypen sowie weiterer Biotoptypen mit landesweiter Bedeutung in Niedersachsen Teil 2: FFH-Lebensraumtypen und Biotoptypen mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (9170) (abgestimmte Fassung, Stand Oktober 2020) Inhalt 1 Kennzeichnung 3.2 Besondere Ziele des Artenschutzes 1.1 Lebensraum- und Vegetationstypen 3.3 Mögliche Zielkonflikte 1.2 Ausprägung und Standortbedingungen 4 Maßnahmen 1.3 Wichtige Kontaktbiotope 4.1 Schutzmaßnahmen (Vermeidung von 1.4 Lebensraumtypische Arten Beeinträchtigungen) 1.5 Entstehung und Nutzung 4.2 Pflege- und Entwicklungshinweise 2 Aktuelle Situation in Niedersachsen 4.3 Spezielle Pflege- und Entwicklungs- 2.1 Verbreitung maßnahmen 2.2 Wichtigste Vorkommen 5 Instrumente 2.3 Schutzstatus 5.1 Schutzgebiete, gesetzlicher 2.4 Bestandsentwicklung und Biotopschutz Erhaltungszustand 5.2 Investive Maßnahmen 2.5 Mögliche Beeinträchtigungen 5.3 Vertragsnaturschutz 3 Schutzziele 5.4 Kooperationen 3.1 Erhaltungsziele für den 6 Literatur Lebensraumtyp Abb. 1: Eichen-Hainbuchenwald mit gut erhaltener Mittelwaldstruktur auf mäßig trockenem Kalkstandort am Elber Berg im LK Wolfenbüttel (Foto: O. v. Drachenfels) Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – NLWKN 1 Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz – Vollzugshinweise Lebensraum- und Biotoptypen, Teil 2 – 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 1 Kennzeichnung 1.1 Lebensraum- und Vegetationstypen FFH-Lebensraumtyp (LRT): 9170 „Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)“ Biotoptypen (Kartierschlüssel, v. DRACHENFELS 2020): . 1.1.2 Eichenmischwald trockenwarmer Kalkstandorte (WTE) . 1.2.1 Laubwald trockenwarmer Silikathänge (WDB) . 1.2.2 Eichenmischwald trockenwarmer Sandstandorte (WDT) Zum LRT 9170 zählen jeweils nur Eichen-Hainbuchenwälder dieser beiden Untertypen (mit Nebencode WCE). 1.7.4 Eichen- und Hainbuchenmischwald mittlerer Kalkstandorte (WCK) . -

L 11 Journal Officiel
ISSN 1977-0693 Journal officiel L 11 de l’Union européenne e 55 année Édition de langue française Législation 13 janvier 2012 Sommaire II Actes non législatifs DÉCISIONS 2012/13/UE: ★ Décision d’exécution de la Commission du 18 novembre 2011 arrêtant une cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique [notifiée sous le numéro C(2011) 8203] . 1 2012/14/UE: ★ Décision d’exécution de la Commission du 18 novembre 2011 arrêtant une cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique continentale [notifiée sous le numéro C(2011) 8278] . 105 Prix: 10 EUR Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. FR 13.1.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 11/1 II (Actes non législatifs) DÉCISIONS DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 18 novembre 2011 arrêtant une cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique [notifiée sous le numéro C(2011) 8203] (2012/13/UE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, 92/43/CEE ont été arrêtées respectivement par les déci sions de la Commission 2004/813/CE ( 2 ), 2008/23/CE ( 3 ), 2009/96/CE ( 4), 2010/43/UE ( 5) et 2011/63/UE ( 6). Conformément à l’article 4, paragraphe vu le traité sur le fonctionnement -

Die Hütte" Jährlich Im Herbst 1600 Stück
Nr. 168 | November 2019 dieHütteDas Magazin der Sektion Hildesheim des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V. • 150 Jahre Deutscher Alpenverein • 130 Jahre Sektion Hildesheim • Renovierung Hildesheimer Hütte 1 Inhaltsverzeichnis Termine, Spenden, Impressum ................................................ 2 Vorwort ................................................................................... 3 Wirtschafliche Lage ................................................................. 4 Mitgliederversammlung & Beirat ............................................ 5 Tourengruppe ......................................................................... 6 Vortragsreferat 2019/2020 ................................................... 10 Familiengruppe ..................................................................... 12 hiclimb .................................................................................. 14 hiclimb – Handicap-Gruppe .................................................. 16 hiclimb – Olympiacamp ......................................................... 18 hiclimb – Weiterbau des Kletter- und Vereinszentrum ........... 20 hiclimb – Kletterstützpunkt ................................................... 22 DAV feiert Geburtstag ........................................................... 24 Klettergruppe ........................................................................ 26 Wir stellen vor ... .................................................................... 28 Aufnahmeantrag .................................................................. -
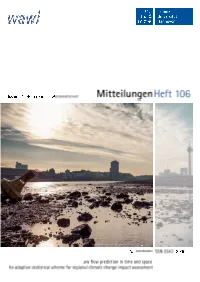
Low Flow Prediction in Time and Space
Low flow prediction in time and space An adaptive statistical scheme for regional climate change impact assessment Von der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zur Erlangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieurin - Dr.-Ing. - genehmigte Dissertation von Anne Fangmann, M.Sc. geboren am 26.07.1986 in Lohne 2017 Referent: Prof. Dr.-Ing. Uwe Haberlandt Korreferent: Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gregor Laaha Tag der Promotion: 01.12.2017 Danksagung Mein Dank richtet sich vor allem an Prof. Dr.-Ing. Uwe Haberlandt. Ohne seine Ideen, sein Wissen und die gute Betreuung während meiner Zeit am Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen. Vielen Dank für die Unterstützung, die ständige Motivation und neuen Anregungen, und dafür, dass ich so viel bei Ihnen lernen durfte. Außerdem möchte ich mich bei den Mitgliedern meiner Promotionskommission bedanken: bei Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gregor Laaha für die Übernahme des Korreferats, sowie bei Prof. Dr. rer. nat. Insa Neuweiler und Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Rosenwinkel als Mitglieder des Promotionskollegiums. Ein großer Dank gilt außerdem Hannes Müller und Bastian Heinrich, die bei allen arbeitsbezogenen und privaten Sorgen zur Stelle waren und mir von Anfang an eine äußerst angenehme Zeit am Institut beschert haben. i Erklärung Hiermit versichere ich eidesstattlich, dass ich 1. die Regeln der geltenden Promotionsordnung kenne und eingehalten habe und mit einer Prüfung nach den Bestimmungen der Promotionsordnung einverstanden bin, 2. die Dissertation selbst verfasst habe, keine Textabschnitte von Dritten oder eigener Prüfungsarbeiten ohne Kennzeichnung übernommen und alle von mir benutzten Hilfsmittel und Quellen in meiner Arbeit angegeben habe, 3.