Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
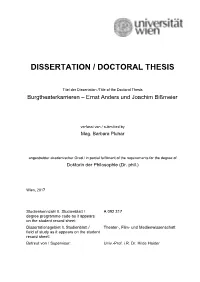
Dissertation / Doctoral Thesis
DISSERTATION / DOCTORAL THESIS Titel der Dissertation /Title of the Doctoral Thesis Burgtheaterkarrieren – Ernst Anders und Joachim Bißmeier verfasst von / submitted by Mag. Barbara Pluhar angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 092 317 degree programme code as it appears on the student record sheet: Dissertationsgebiet lt. Studienblatt / Theater-, Film- und Medienwissenschaft field of study as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Univ.-Prof. i.R. Dr. Hilde Haider 2 Inhaltsverzeichnis 0. Vorwort 4 1. Das Wiener Burgtheater nach 1945 zwischen Tradition und Aufbruch 8 2. Das Prinzip der Rollenfächer 15 3. Das zeitliche Umfeld: Das Burgtheater von Adolf Rott bis Claus Peymann 17 3.1. Die Direktion Adolf Rott (1954 - 1959) 17 3.2. Die Direktion Ernst Haeusserman (1959 - 1968) 20 3.3. Die Direktion Paul Hoffmann (1968 - 1971) 22 3.4. Die Direktion Gerhard Klingenberg (1971 - 1976) 24 3.5. Die Direktion Achim Benning (1976 - 1986) 26 3.6. Die Direktion Claus Peymann (1986 - 1999) 29 4. Ernst Anders 31 4.1. Biographisches und Werdegang 31 4.2. Schauspielerische Charakteristik 34 4.2.1. Rollengebiete und -gestaltung 34 4.2.2. Charakteristik der Ausdruckmittel 42 4.3. Analyse der Rollen 45 4.3.1 Komödien 45 4.3.1.1. Shakespeare 48 4.3.1.2. Nestroy und Raimund 55 4.3.1.3. Schwänke 66 4.3.1.4. Weitere wichtige Rollen 72 4.3.1.5. Zusammenfassung 86 4.3.2. Ernste Rollen/Moderne und zeitgenössische Literatur 88 4.3.2.1. -

Nie Am Ziel Helmuth Lohner
Eva Maria Klinger Nie am Ziel Helmuth Lohner EVA MARIA KLINGER Nie am Ziel Helmuth Lohner DIE BIOGRAFIE Mit 82 Abbildungen AMALTHEA Besuchen Sie uns im Internet unter www.amalthea.at © 2015 by Amalthea Signum Verlag, Wien Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT Umschlagfotos: © Ullstein-Timpe/Ullstein Bild/picturedesk.com (vorne), © Ali Schafler/First Look/picturedesk.com (hinten) Lektorat: Martin Bruny Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten Gesetzt aus der 11,5/15 pt Minion Printed in the EU ISBN 978-3-99050-022-4 e-ISBN 978-3-903083-09-7 Inhalt Die wichtigsten Fragen beantwortet man immer mit seinem ganzen Leben 7 Das Spiel beginnt · 1933 bis 1965 22 Nie am Ziel · 1965 bis 1980 56 Schubumkehr · 1980 bis 1990 104 Heimkehr · 1990 bis 1997 142 Die Mühen der Ebene · 1997 bis 2006 159 Die große Freiheit · 2006 bis 2015 191 Rollenverzeichnis 224 Bild- und Textnachweis 248 Quellen 249 Danksagung 250 Personenregister 251 Heimkehr · 1990 bis 1997 Am 1. Januar 1988 hat Otto Schenk mit Robert Jungbluth als Co-Direktor das Theater in der Josefstadt übernommen, und von da an laufen die geheimen Versöhnungsversuche, um Lohner zumindest Stück für Stück heimzuholen. Jungbluth tele- foniert mit Lohner in Zürich, trifft ihn, wenn er in Wien ist, trifft ihn bei den Salzburger Festspielen, Schenk schmollt weiterhin trotzig: »Wenn er bei mir an der Josefstadt spielt, dann soll’s gut sein« – und erteilt Felix Mitterer den Stückauftrag, einen moder- nen Jedermann zu schreiben. Erwin Steinhauer, der Mitterers Stück inszenieren soll, kapri- ziert sich darauf, dass der aktuelle Salzburger Jedermann, Hel- muth Lohner, die Titelrolle auch in der Josefstadt spielen soll. -

Das Projekt Kinderoper Der Institution Wiener Sängerknaben“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Das Projekt Kinderoper der Institution Wiener Sängerknaben“ Verfasserin Claudia Bischof angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 316 Studienrichtung lt. Studienblatt: Musikwissenschaft Betreuerin: Ao. Univ.-Prof. Dr. Margareta Saary Danksagung Ein herzliches Dankeschön meiner Betreuerin Ao. Univ.-Prof. Dr. Margareta Saary für die gute Betreuung über die örtliche Distanz hinweg. Mein Dank gilt Dr. Tina Breckwoldt von der Institution Wiener Sängerknaben, die mir als Leiterin des Archivs und kreative Gestalterin vieler Kinderopern (Ideen und Libretti) Quellenmaterial zukommen ließ. Ich bedanke mich bei Gerald Wirth, dem künstlerischen Leiter der Wiener Sängerknaben und Komponist eigener Kinderopern für das zur Verfügung gestellte Notenmaterial. Sehr zu Dank verpflichtet für die Zusendung von Kritiken und Informationsmaterial bin ich Mag. Franz Farnberger, dem Künstlerischen Leiter der St. Florianer Sängerknaben, Maria Wiesinger vom Pressezentrum der Wiener Staatsoper, Mag. Eva Wopmann vom Pressezentrum der Wiener Volksoper, Lina Maria Zangerl vom Archiv der Salzburger Festspiele und Dr. Desiree Hornek, der Organisatorin von Kinderprojekten im Wiener Musikverein. Herzlich danke ich dem Dirigenten Gillay András für seine Unterstützung in musikalischen Belangen. Für das Lektorat danke ich Frau Renate Simsic. Wertvolle Dienste erwies mir Mezö András, der unzählige Botengänge zu diversen Bibliotheken in Wien absolvierte. Ich danke meiner Mutter Erika Bischof, dass sie meinen Sohn betreute. Dadurch schenkte sie mir die Zeit zum Schreiben dieser Diplomarbeit. Meine Schwester Frau Martina Bischof hat als Grafikerin die Formatierung des Layouts übernommen. 2 Inhaltsverzeichnis: Vorwort 6 Einführung 8 1. Die Wiener Sängerknaben 11 1.1. Der künstlerische Leiter: Gerald Wirth 11 1.2. Die Zielsetzung 13 1.3. -

Helmuth Lohner Ehemaliger Intendant Theater in Der Josefstadt Im Gespräch Mit Isabella Schmid
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0305/20030523.shtml Sendung vom 23.05.2003, 20.15 Uhr Helmuth Lohner Ehemaliger Intendant Theater in der Josefstadt im Gespräch mit Isabella Schmid Schmid: Herzlich willkommen zu Alpha-Forum. Unser Gast heute ist Helmuth Lohner, Schauspieler, Regisseur und Intendant. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Als Sie 1997 das Theater in der Josefstadt übernommen haben, sind damit auch ganz neue Aufgaben auf Sie zugekommen. Als Schauspieler beschäftigt man sich ja nur mit der reinen Kunst, da aber ging es nun plötzlich um Finanzen, um Verwaltung usw. Warum haben Sie gesagt, "Das tue ich mir noch einmal an"? Lohner: Nun, das kam recht plötzlich. Ich war in Hamburg und bei mir waren freie Tage immer schon verhängnisvoll: Da hat es immer schon so furchtbare Entschlüsse gegeben. Ich bin ja zeitlebens ein ziemlicher Frühaufsteher und ich ging damals ziemlich in der Früh rund um die Alster in Hamburg und dachte ein wenig nach. Plötzlich kam mir in den Sinn, dass nun alle Kollegen in meiner Generation ein Theater leiten: der Jürgen Flimm, der Peter Stein, der Klaus Peymann usw. Ich dachte mir also, dass ich das doch auch mal machen könnte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits erfahren, dass der Otto Schenk die Josefstadt verlassen wird. Ich habe daraufhin also ein Brieflein an den Wiener Bürgermeister geschrieben, dass ich das gerne machen würde. Ich hatte diesen ganzen Brief aber am nächsten Tag schon wieder vergessen. An einem der nächsten Tage stand dann aber plötzlich am Abend nach der Vorstellung ein Blumenstrauß vor meiner Tür mit einem "Einverstanden". -

Geschäftsbericht 2013 | 2014
GESCHÄFTSBERICHT 2013 | 2014 www.wiener-staatsoper.at INHALT VORWORT ..........................................................................................................................4 OPER Premieren, Wiederaufnahmen, Musikalische Neueinstudierung ..................................8 Repertoire ........................................................................................................................26 BALLETT Premieren, Wiederaufnahmen .......................................................................................30 Repertoire ........................................................................................................................41 KINDEROPER ..................................................................................................................42 KONZERTE ......................................................................................................................46 GASTSPIELE ....................................................................................................................52 WIENER OPERNBALL ......................................................................................................54 MATINEEN .......................................................................................................................56 SONSTIGE VERANSTALTUNGEN ...................................................................................65 SONDERPUBLIKATIONEN .............................................................................................69 BALLETTAKADEMIE -

Otto Schenk Aus Wikipedia, Der Freien Enzyklopädie
Otto Schenk aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Otto Schenk (* 12. Juni 1930 in Wien) ist ein österreichischer Schauspieler, Kabarettist, Regisseur und Intendant. Nach seiner Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar begann er seine Karriere am Theater in der Josefstadt und am Wiener Volkstheater. Ab 1953 führte er bei verschiedenen Aufführungen in Wiener Theatern Regie. 1957 inszenierte er seine erste Oper (Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart) am Salzburger Landestheater. Schenk spielte und inszenierte an den bedeutendsten Schauspiel- und Opernhäusern der Welt, darunter am Wiener Burgtheater, den Münchner Kammerspielen, der Wiener Staatsoper, der New Yorker Metropolitan Opera, der Mailänder Scala und dem Royal Opera House in Covent Garden, London. Weitere Operninszenierungen erarbeite er für die Deutsche Oper Berlin, die Bayerische Staatsoper oder die Hamburgische Staatsoper. Von 1986 bis 1988 fungierte Schenk als Direktoriumsmitglied der Salzburger Festspiele, von 1988 bis 1997 war Otto Schenk Direktor des Theaters in der Josefstadt (gemeinsam mit Robert Jungbluth). 1999 wurde er in „Club Carriere - Enzyklopädie des Erfolges“ aufgenommen. Als Kabarettist trat Schenk schon in den 1950er-Jahren im Simpl auf, jedoch in den letzten Jahrzehnten begeisterte er sein Publikum im gesamten deutschen Sprachraum mit seinen Leseabenden unter dem Motto „Sachen zum Lachen“. Zahlreiche Schallplatten begleiten diese Tätigkeit. Dabei spielt er immer die selbe Rolle - den Schenk. Schenk hat die österreichische Schauspielszene als Schauspieler, Kabarettist -

Inge Konradi
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Inge Konradi. Ein Wiener Bühnenleben“ Verfasserin Regina Paril-Fellner angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2015 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Diplomstudium Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Univ. Prof. Dr. Brigitte Marschall 2 DANKSAGUNG Allen voran danke ich Frau Univ. Prof. Dr. Brigitte Marschall, welche die Entstehung meiner Diplomarbeit mit Rat und Tat begleitete. Für Materialien, Hinweise, Informationen und Geduld danke ich Mag. Rita Czapka (Archiv des Burgtheaters), Dr. Julia Danielczyk und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Lesesaal der Handschriftensammlung der Wienbibliothek im Rathaus, Paulus Manker, weiters Univ. Prof. Dr. Peter Roessler und Mag. Susanne Gföller (Max Reinhardt Seminar) sowie Dr. Waltraud Bertoni. Bei meiner Familie bedanke ich mich für dringend benötigte Aufmunterung und Ermutigung. Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Mann Peter, ohne dessen Unterstützung mir der Abschluß des Studiums nicht möglich gewesen wäre. Danke! 3 Vorwort 4 1. Einleitung 5 2. Biographisches 7 3. Engagement am Volkstheater 10 3.1. Das Deutsche Volkstheater Wien in den Jahren 1938 - 1945 10 3.2. Inge Konradis Rollen am Volkstheater 1940 – 1944 12 3.3. Rollen am Volkstheater ab 1945 19 3.3.1. Direktion Günther Haenel 1945 – 1948 20 3.3.2. Direktion Paul Barnay 1948 – 1952 34 3.3.3. Von der Anfängerin zur jungen Volksschauspielerin 50 4. Engagement am Burgtheater 53 4.1. Das Burgtheater im Ronacher 53 4.2. Inge Konradis Anfänge am Burgtheater 54 4.3. Rollen ab 1955 57 4.4. Direktion Ernst Haeusserman 1959 – 1968 60 4.5. Teilnahme an der Welttournee des Burgtheaters 70 4.6 Von 1968 zu Inge Konradis späten Rollen 74 5. -

Joint Statement Page 2
2nd follow up to Contribution ID: 0871af7d-aa10-474f-8c9f-7eb359c11696 Call by Entertainment lighting sector for a continued exemption Austria, Belgium, France, Germany, Netherlands, Sweden, United Kingdom* May 7th 2018 Executive Summary We call on EU regulators on a continuing exemption for professional entertainment lighting: “Light sources for theatrical, live entertainment and studio lighting applications, where the spectral distribution of the light is adjusted to the specific needs of particular technical equipment, in addition to making the scene or object visible for humans” Executive Summary page 1 Joint Statement page 2 German translation page 3 Initiating Associations page 4-5 Supporters Theatres page 6-13 Supporters Studios page 14 Supporters Live Entertainment page 15-17 Manufacturers, Consultants, etc. page 18-20 * Supported by related associations form the countries mentioned above page 1 JOINT STATEMENT Protecting the entertainment industry from unintended consequences of the proposed EcoDesign regulations The signatories of this statement are committed to the goals of the EU in relation to climate change and support a review of the EcoDesign Directive by the Commission. Increasing energy efficiency is part of the major objective to make theatres, live entertainment and studios all over Europe more sustainable. In this context, products designed with LED technology can be beneficial supplements to existing full spectrum theatrical light sources. At present, there are no suitable LED replacements for the vast majority of entertainment luminaires. A strict implementation of the new regulation (according to the current draft) would result in a lack of availability of existing light sources in the market and would result in the disposal (and replacement) of more than 5 million (>5.000.000) fully functional theatrical spotlights. -
LIEBE MÖGLICHERWEISE Presseheft Neu
FILMLADEN FILMVERLEIH präsentiert eine Wega Film Produktion LIEBE MÖGLICHERWEISE Ein Film von Michael Kreihsl KINOSTART: 2. Dezember 2016 Pressebetreuung: Susanne Auzinger PR [email protected] Mobil: +43 664 263 9228 Marketing: Maxie Klein [email protected] Tel.: +43 1 523 43 62 44 Produktion: Wega Film Vienna Hägelingasse 13, 1140 Wien [email protected] Website: http://liebemoeglicherweise.at Pressematerial: www.filmladen.at/presse INHALT Besetzung, Stab, technische Daten ..................................................................... 3 Kurzinhalt und Synopsis ....................................................................................... 4 Regiestatement ...................................................................................................... 5 Biografien Michael Kreihsl ........................................................................................................ 6 Devid Striesow ......................................................................................................... 8 Silke Bodenbender ................................................................................................. 10 Norman Hacker ...................................................................................................... 11 Edita Malovcic ........................................................................................................ 12 Gerti Drassl ............................................................................................................ 13 Jana Naomi McKinnon .......................................................................................... -

* Stand 12.04.2017* Die Mit Einem Asterisk (*) Versehenen Titel Sind
Die im Arthur Schnitzler-Archiv der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg vorhandenen Filme und Hörspiele sind grau hinterlegt. * Stand 12.04.2017* Die mit einem Asterisk (*) versehenen Titel sind nicht in der Auswahl von Ballhausen vermerkt. Die Filmografie verzeichnet die (Kino-)Film-, Theater- und Fernsehadaptionen von literarischen Werken Arthur Schnitzlers, die in den Kategorien Kino- und Fernsehfilme, Bühnenproduktionen, Dokumentationen und Lesungen in chronologischer Reihenfolge erfasst werden. Benutzerhinweise: Die Jahresangaben bei Kinofilmen beziehen sich auf das Produktionsjahr (Jahr der Fertigstellung). Die Jahresangaben bei Fernsehfilmen und ausgestrahlten Theateraufzeichnungen beziehen sich auf den Termin der Erstausstrahlung. In der Auflistung über die Produktion genannt wurden nur Personen, deren Beteiligung am Projekt verifizert werden konnte. 1 I. VERFILMUNGEN 1.1 Kino- und Fernsehfilme in chronologischer Reihenfolge Titel Land Jahr Beteiligte Personen Länge Signatur 1. Elskovsleg Dänemark 1914 Regie: Holger Madsen, August Blom. 1.380 m– F 023 [Liebelei] Drehbuch: Holger Madsen, Arthur Schnitzler. 1.500 m. (ungeschnitten); Kamera: Marius Clausen, Johan Ankerstjerne. Produktion: Nordisk Film Compagnie. F 023 b Darsteller: Carl Alstrup, Oluf Billesborg, Valdemar Psylander, Holger Reenberg, (geschnitten) Christel Holch, Frederik Jacobsen, Johanne Fritz-Petersen, Carl Lauritzen, Augusta Blad, Carl Schenstrøm, Ingeborg Olsen, Birger von Cotta-Schönberg, Majar Bjerre-Lind. Uraufführung: 22. Januar 1914, Kopenhagen. Stummfilm. -

Opera | Concert | Ballet
ARTHAUS MUSIK GMBH Main Office Arthaus Musik GmbH Große Brauhausstraße 8 D–06108 Halle/Saale CATALOGUE Tel +49 345 2 99 89 49 50 Fax +49 345 2 99 89 49 99 [email protected] www.arthaus-musik.com Catalogue realisation: Arthaus Musik Design: Monarda Publishing House Ltd. Dies ist ein internationaler Katalog. Es ist daher möglich, dass nicht alle aufgeführten Titel in jedem Land erhältlich sind. In PAL-Regionen sollten Sie beim Kauf einer NTSC-DVD sicherstellen, dass sowohl der DVD-Player 2015 / 2016 als auch das TV-Gerät PAL/NTSC kompatibel ist. This is an international catalogue. Therefore, it is possible that certain titles may not be available in every country. When buying an NTSC-DVD in PAL regions, please ensure that both player and TV set are compatible to PAL/NTSC. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Subject to changes. Arthaus and the Arthaus-Logo are registered Trademarks of STUDIOCANAL GmbH. CATALOGUE 2015/2016 Photo (cover) © Marco Brescia / Teatro alla Scala WWW.ARTHAUS-MUSIK.COM 104503 OPERA | CONCERT | BALLET 104503 8 07280 45039 2 DOCUMENTARY | COLLECTIONS | ART S HOSTAKOV IC H Complete Symphonies & Concertos DVD and BLU-RAY VALERY CATALOGUECATALOGUE GERGIEV First audio-visual Sibelius Cycle featuring all 7 Symphonies on DVD or Blu-ray Orchestra and Chorus of the Total Running time: 584 mins MARIINSKY THEATRE Includes introductions by Finnish conductor Hannu Lintu as well as the short film series Sort“ of Sibelius“ OPERA Edition celebrating2 Jean Sibelius‘ OVER 16 HOURS 150th birthday 107551 (DVD) / 107552 (BD) OF MUSIC BALLET 70 + Introductions by Valery Gergiev + Deluxe Book Cat. -

Catalogue 2018
CATALOGUE 2018 Cast The Arthaus Musik classical music catalogue features more than 400 productions from the beginning of the 1990s until today. Outstanding conductors, such as Claudio Abbado, Lorin Maazel, Giuseppe Sinopoli and Sir Georg Solti, as well as world-famous singers like Placido Domingo, Brigitte Fassbaender, Marylin Horne, Eva Marton, Luciano Pavarotti, Cheryl Studer and Dame Joan Sutherland put their stamp on this voluminous catalogue. The productions were recorded at the world’s most renowned opera houses, among them Wiener Staatsoper, San Francisco Opera House, Teatro alla Scala, the Salzburg Festival and the Glyndebourne Festival. Unitel and Arthaus Musik are proud to announce a new partnership according to which the prestigious Arthaus Musik catalogue will now be distributed by Unitel, hence also by Unitel’s distribution partner C Major Entertainment. World Sales: All rights reserved · credits not contractual · Different territories · Photos: © Arthaus · Flyer: luebbeke.com Tel. +49.30.30306464 [email protected] Unitel GmbH & Co. KG, Germany · Tel. +49.89.673469-630 · [email protected] www.unitel.de OPERA ................................................................................................................................. 3 OPERETTA ......................................................................................................................... 35 BALLET ............................................................................................................................... 36 CONCERT...........................................................................................................................