Maßgebliche Bestandteile Eines Bewirtschaftungsplans
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Appendix: Supplementary Tables and Raw Data
Appendix: Supplementary tables and raw data Evolutionary genetic analysis of an invasive population of sculpins in the Lower Rhine I n a u g u r a l - D i s s e r t a t i o n zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln vorgelegt von Arne W. Nolte aus Oldenburg Köln, 2005 Data formats and access: According to the guidelines of the University of Cologne, electronic publication of PhD Theses requires compound documents in PDF–format. On the other hand a simple file format, as for instance ascii-text files, are desirable to have an easy access to datasets. In this appendix, data are formatted as simle text documents and then transformed into PDF format. Thus, one can easily use the “Select Text” option in a PDF viewer (adobe acrobat reader) to copy datasets and paste them into text files. Tables are saved row by row with fields separated by semicolons. Ends of rows are marked by the insertion of “XXX”. Note: In order to recreate a comma separated file (for import into Microsoft Excel) from the texts saved here: 1) all line breaks have to be removed and then 2) the triple XXX has to be replaced by a line break (can be done in a text editor). Otherwise, datasets are composed as indicated in the individual descriptions. Chapter 1 - Supplementary Table 1: Sampled Populations, localities with coordinate data, river basins and references to other studies. Drainage No. Locality GIS References System Volckaert et al. 50°47′N 4°30′ 1 River Neet, S. -

Pastports, Vol. 3, No. 8 (August 2010). News and Tips from the Special Collections Department, St. Louis County Library
NEWS AND TIPS FROM THE ST. LOUIS COUNTY LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS DEPARTMENT VOL. 3, No. 8—AUGUST 2010 PastPorts is a monthly publication of the Special Collections Department FOR THE RECORDS located on Tier 5 at the St. Louis County Library Ortssippenbücher and other locale–specific Headquarters, 1640 S. Lindbergh in St. Louis sources are rich in genealogical data County, across the street Numerous rich sources for German genealogy are published in German-speaking from Plaza Frontenac. countries. Chief among them are Ortssippenbücher (OSBs), also known as Ortsfamilienbücher, Familienbücher, Dorfsippenbücher and Sippenbücher. CONTACT US Literally translated, these terms mean “local clan books” (Sippe means “clan”) or To subscribe, unsubscribe, “family books.” OSBs are the published results of indexing and abstracting change email addresses, projects usually done by genealogical and historical societies. make a comment or ask An OSB focuses on a local village or grouping of villages within an ecclesiastical a question, contact the parish or administrative district. Genealogical information is abstracted from local Department as follows: church and civil records and commonly presented as one might find on a family group sheet. Compilers usually assign a unique numerical code to each individual BY MAIL for cross–referencing purposes (OSBs for neighboring communities can also reference each other). Genealogical information usually follows a standard format 1640 S. Lindbergh Blvd. using common symbols and abbreviations, making it possible to decipher entries St. Louis, MO 63131 without an extensive knowledge of German. A list of symbols and abbreviations used in OSBs and other German genealogical sources is on page 10. BY PHONE 314–994–3300, ext. -

„Opa, Es Reicht!“
42. Jahrgang (164) Donnerstag, den 27. Oktober 2016 Nr. 43/2016 Hördter Klosterbühne e.V. „Opa, es reicht!“ - Komödie in 3 Akten von Bernd Gombold - Samstag 12.11.2016 19.30 Uhr Sonntag 13.11.2016 18.00 Uhr Samstag 19.11.2016 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Hördt Unterstützt von: Haustechnik Becht, Metzgerei Hormuth, Pfalzapotheke Kuhardt, Gärtnerei Steiff, Eismanufaktur Taberna, Autohaus Stoltmann, Baustatik Fischer, Bettina Lattmann, Generalagentur Patrick Wetzel, Fam Wolfgang Schmierer Kartenvorverkauf am 29.10.16 Gemeindehaus Hördt, 11-12 Uhr Restkarten erhältlich bei Anita Becht, Goethestraße 1, Hördt, Tel: 07272/4466 Rülzheim - 2 - Ausgabe 43/2016 Samstag, 29. Oktober Wichtige Telefonnummern Pfalz-Apotheke Kuhardt Ringstr. 12-16, Tel.: 07272/ 31 31 Sonntag, 30. Oktober Kreuz-Apotheke Rülzheim Verbandsgemeindeverwaltung Mittlere Ortsstr. 123, Tel.: 07272/ 83 52 .................................................................................. 07272/7002-1011 Montag, 31. Oktober Verbands- und Ortsbürgermeister Schardt, Rülzheim ... 07272/7002-1021 Neue Löwen-Apotheke Bellheim Beigeordneter der Verbandsgemeinde Rülzheim Hauptstraße 118, Tel.: 07272/ 82 83 Dudenhöffer ......................................................................07272/74404 Dienstag, 1. November Ortsbürgermeister Hör, Rülzheim ............................. 07272/7002-1601 Rats-Apotheke Rheinzabern Bürgermeister Schardt, Leimersheim ....................... 07272/7002-1021 Hauptstraße 28, Tel.: 07272/ 93 09 15 Ortsbürgermeister Frey, Hördt ..........................................07272/74817 -

Großes Interesse an Senioren-WG
DIE RHEINPFALZ — NR. 230 KREISGERMERSHEIM MONTAG, 5. OKTOBER 2015 Rheinbrücke: Großes Interesse an Senioren-WG Keine klare Linie bei Landesregierung NEUBURG: Bürgerverein legt Finanzierung des Wohnprojekts vor – Jetzt schon Mietanfragen von Senioren RÜLZHEIM. Kritik „in Sachen zweite Die Planung der Senioren-Wohnge- Rheinbrücke“ bringt der Landtags- meinschaft schreitet voran – jetzt abgeordnete Martin Brandl (CDU) in geht es vor allem ums Geld. Gesprä- einem Schreiben zum Ausdruck. che mit einer Bank wegen des Kre- Darin heißt es, die Landesregierung dits fanden bereits statt. Bei der ließe „einfach keine klare Linie er- nächsten Mitgliederversammlung kennen.“ am 7. Oktober stimmt der Bürger- verein über den Kauf der entspre- Schrieb die Landesregierung noch im chenden Gebäude ab. April, es sei ihr Ziel, Ende 2015 ge- meinsam mit Baden-Württemberg In der Senioren-WG sollen zwölf die Planfeststellungsbeschlüsse fer- Menschen mit einer Pflegestufe von tigzustellen, sei heute davon keine Null bis Drei leben. Jeder hat sein ei- Rede mehr, moniert Brandl. genes Zimmer mit einer Größe von 15 Ein gemeinsamer Abschluss der bis 23 Quadratmetern. Die Mietpreise beiden Planfeststellungsverfahren werden demnach unterschiedlich werde 2015 nicht mehr erfolgen kön- ausfallen, „aber einen genauen Preis nen. Auf rheinland-pfälzischer Seite haben wir noch nicht festgelegt“, sagt werde voraussichtlich im Dezember Arnika Eck, Vorsitzende des Neubur- ein Erörterungstermin durchgeführt, ger Bürgervereins. Zusätzlich zum auf baden-württembergischer Seite Mietvertrag schließen die Bewohner seien noch Fragen zu klären. So seien der Senioren-WG einen Vertrag di- bis zu einem Abschluss der Planfest- rekt mit einem Pflegedienst ab. Zwei stellungsverfahren noch viele Ar- feste Mitarbeiter werden immer vor beitsschritte erforderlich, zusätzliche Ort sein: eine Pflegefachkraft und ei- Verzögerungen möglich. -

Gemeinde Offenbach / Queich
Gemeinde Offenbach / Queich Bebauungsplan „Böhlweg“ Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB mit Umweltbericht Satzungsfassung Offenbach / Queich Bebauungsplan „Böhlweg“ Satzungsfassung Begründung mit Umweltbericht gem. § 2a BauGB Erstellt im Auftrag der Gemeinde Offenbach / Queich durch BBP Stadtplanung Landschaftsplanung | Kaiserslautern Seite 1 von 39 Offenbach / Queich Bebauungsplan „Böhlweg“ Satzungsfassung Begründung mit Umweltbericht gem. § 2a BauGB INHALTSVERZEICHNIS Ziele, Zwecke und Wesentliche Auswirkungen der Planung gem. § 2 a Nr. 1 BauGB .... 5 A. Erfordernisse und Zielsetzung der Planaufstellung gem. § 1 Abs. 3 BauGB ...... 5 B. Aufstellungsbeschluss ............................................................................................ 5 C. Grundlagen ............................................................................................................... 5 1 Planungsgrundlagen ............................................................................................... 5 2 Lage und Größe des Plangebietes / Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ................................................................................................... 6 3 Bestandssituation (09/2015) .................................................................................... 6 3.1 Nutzung und natürliche Situation ........................................................................... 6 3.2 Schutzgebietsausweisungen ................................................................................. 7 3.3 Geschützte Pflanzen ............................................................................................ -
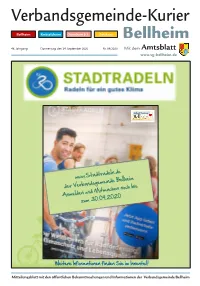
Amtsblatt 39 2020.Pdf
Verbandsgemeinde-Kurier Bellheim Knittelsheim Ottersheim b. L. Zeiskam Bellheim 48. Jahrgang Donnerstag, den 24. September 2020 Nr. 39/2020 Mit dem Amtsblatt www.vg-bellheim.de www.Stadtradeln.de der Verbandsgemeinde Bellheim Anmelden und Mitmachen noch bis zum 30.09.2020 Weitere Informationen finden Sie im Innenteil! Mitteilungsblatt mit den öffentlichen Bekanntmachungen und Informationen der Verbandsgemeinde Bellheim AMTSBLATT VERBANDSGEMEINDE BELLHEIM - 2 - Ausgabe 39/2020 ✂ Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim Ab 04.05.2020 sind Terminvereinbarungen telefonisch oder per E-Mail möglich: Montag - Freitag ....................................................................................................................................08.00 - 12.30 Uhr Das Sozialamt ist bis auf Weiteres dienstags geschlossen. Mittwoch ................................................................................................................................................14.00 - 18.00 Uhr Montag und Donnerstag .......................................................................................................................14.00 - 16.00 Uhr .............................................................................................................................................................Tel.: 07272/7008-0 E-Mail-Adresse VG-Verwaltung Bellheim: [email protected] Internet-Adresse: www.vg-bellheim.de Notrufe Polizei .................................................................................................................................................... -

Liniennetzplan Landkreis Germersheim
www.vrn.de Liniennetzplan Landkreis Germersheim Neustadt Freimersheim Domherrenplatz Freisbach Oberer Waldacker Neustadt 599 Schwegenheim Speyer Legende Sportplatz 509 ScherrngasseLindenplatz 552 592 S 3 RE 4 RE 6 FriedhofHauptstr. Kirche Buslinie S 4 RB 56 594 RB 51 Trifelsstr. Essingen Hauptstr. Schulverkehr RB 53 Bahnhof Zug Grundschule Rathaus Lingenfeld Turnhalle SiedlungLustadt Weingarten Sängerheim/ Raiffeisen Pfalz Firma Lehr Rathaus Kirche relevanter Umstiegsbahnhof Kirche Ort Hochstadt Haltestelle Westheim Steinfeld Bornheim Linde Sporthalle Schule Kerweplatz Daimler AG Tor 1 mehrere Haltestellen in Gemeinde 559 Rathaus Schulzentrum Dammheim Linde Denkmal Speyerer Str. Waage Raiffeisenstr. Winden Gemeinde Kindergarten Siedlung Bahnhof Siedlung 590 Zeiskam Feuerwehr Am Steinsteg Alte Bahnhofstr. Bahnhof Dreihof Gasthaus Ochsen US-Depot 539 Gasthaus Schwanen EKZ Bahnhof Germersheim Hainbachstr. 596 SchwimmparkSenioren-ZentrumAm Hasenspiel Krankenhaus In der Windblase Straßen-Museum Berufsschule ParkstiftHallenbad Paradeplatz 550 Bellheim Johanneskirche Römerweg Schulzen- Spiegelbachpark Stadthalle 546 Böllenborn - Bad Bergzabern - Winden - Kandel Schulzentrum Dammühlstr. trum Ost Offenbach Dorfgemein- Feuerwehr Wasserturm 547 Bad Bergzabern - Niederotterbach - Minfeld - Kandel (- Wörth) schaftshaus Turn-und Festhalle Schule 548 (Leimersheim -) Rheinzabern - Kandel (- Wörth) Uni/Alter Meßplatz 555 Hauptbahnhof Mozartstr. Ottostr. 549 (Wörth - Hagenbach -) Berg - Scheibenhardt - Büchelberg - Kandel Deutsches Tor Nikolaus-Moll-Str.Paulusstift -

Amtsblatt Wörtham Rhein Das Amtliche Bekanntmachungsorgan Der Stadt Wörth Am Rhein
45. Jahrgang • Woche 14 • Donnerstag, 6. April 2017 • www.woerth.de Amtsblatt Wörtham Rhein Das amtliche Bekanntmachungsorgan der Stadt Wörth am Rhein Bitte vorgezogenen Redaktionsschluss 40. Rhein-Volkslauf Maximiliansau wegen Ostern beachten - Unter Amtliches mit Sparkassen-Schulcup Wörth Neue Beschilderung in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße beachten - Unter Amtliches WAS,WANN,WO? Samstag, 8.4. Abenteuer Vorlesen, Stadtbücherei Wörth 40. Rhein-Volkslauf mit Wörther Schulcup, Volkslaufgruppe Maximiliansau, Tulla- und Rheinhalle Samstag, 8.4. und Sonntag, 9.4. Ostereier-Schießen, Schützenverein Wörth, Turnhalle Dammschule Sonntag, 9.4. Konfirmation, protestantische Christuskirchengemeinde Wörth Tanznachmittag mit Rolf & Christine, Bayerischer Hof (15 bis 18 Uhr) Montag, 10.4. bis Donnerstag, 13.4. Kinderferienwoche für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, Kinder- und JugendzentrumWörth/Mehrgenerationenhaus Mittwoch, 12.4. bis Samstag, 15.4. Ostereier-Schießen, Schützengesellschaft DieVolkslaufgruppeMaximiliansaulädtzum40.Rhein-VolkslaufamSamstag,8.April, Schaidt, Schützenhaus inMaximiliansauein.Erwartetwerdenca.500Teilnehmer,denGroßteildavonüberdie Mittwoch, 12.4. Straßenlaufdistanzenvon10-kmbisHalbmarathon.Auchdie5-km-Distanzistvermes- LesespaßindenFerien„DieWeltderOlchis“, sen; sie gibt es als Laufstrecke, sowie als Extrastart für Walking. Stadtbücherei Wörth Freitag, 14.4. Kinderkreuzweg, katholische Ebenfalls an diesem Samstag ausgerichtet wird der Sparkassen-Schulcup Wörth. Kirchengemeinde Maximiliansau, katholische Kirche -

Influential Parameters of Surface Waters on the Formation of Coating Onto Tio2 Nanoparticles Under Natural Conditions
Electronic Supplementary Material (ESI) for Environmental Science: Nano. This journal is © The Royal Society of Chemistry 2021 Influential parameters of surface waters on the formation of coating onto TiO2 nanoparticles under natural conditions Narjes Tayyebi Sabet Khomami a, Parthvi Mayurbhai Patel a, Cynthia Precious Jusi a, Vanessa Trouillet b, Jan Davida, Gabrielle. E. Schaumanna, Allan Philippe a* * Corresponding author a iES Landau, Institute for Environmental Sciences, Koblenz-Landau University, Fortstrasse 7, 76829 Landau, Germany. b Institute for Applied Materials (IAM) and Karlsruhe Nano Micro Facility (KNMF), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany. 1 Table S1: The locations of surface water (SW) sites and their descriptions. Abbr. Site GPS Location Type of Description landscape SW1 Rehbach 49° 21′ 20″ N urban Is tributary of the Speyerbach river which flows through the Winziger 8° 9′ 19″ E Wassergescheid in Neustadt Weinstrasse. SW2 Speyerbach 49°19'04.8"N urban The Speyerbach is a left tributary of the Rhine river and flows through the 8°26'49.5"E southern palatinate forest as splits into smaller water courses before emptying out into the Rhine. SW3 Bischofsweiher 49°20'40.4"N forest Bischofsweier is an artificial lake dammed from inflows from the 8°05'18.2"E Kaltenbrunnertalbach stream and serves as a recreational fishing lake. SW4 Kaltenbrunnertal 49°20'40.4"N forest Kaltenbrunnertalbach is a stream that flows from the northern summit of -bach 8°05'18.2"E Hüttenhohl and maintains its course through the southern palatinate forest before emptying into Rehbach. SW5 Modenbach 49°16'12.4"N agricultural Modenbach is a stream, just under 30 kilometers long, and a right-hand tributary 8°10'58.4'' E of the Speyerbach. -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of
L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

Heavy Rainfall Provokes Anticoagulant Rodenticides' Release from Baited
Journal Pre-proof Heavy rainfall provokes anticoagulant rodenticides’ release from baited sewer systems and outdoor surfaces into receiving streams Julia Regnery1,*, Robert S. Schulz1, Pia Parrhysius1, Julia Bachtin1, Marvin Brinke1, Sabine Schäfer1, Georg Reifferscheid1, Anton Friesen2 1 Department of Biochemistry, Ecotoxicology, Federal Institute of Hydrology, 56068 Koblenz, Germany 2 Section IV 1.2 Biocides, German Environment Agency, 06813 Dessau-Rosslau, Germany *Corresponding author. Email: [email protected] (J. Regnery); phone: +49 261 1306 5987 Journal Pre-proof A manuscript prepared for possible publication in: Science of the Total Environment May 2020 1 Journal Pre-proof Abstract Prevalent findings of anticoagulant rodenticide (AR) residues in liver tissue of freshwater fish recently emphasized the existence of aquatic exposure pathways. Thus, a comprehensive wastewater treatment plant and surface water monitoring campaign was conducted at two urban catchments in Germany in 2018 and 2019 to investigate potential emission sources of ARs into the aquatic environment. Over several months, the occurrence and fate of all eight ARs authorized in the European Union as well as two pharmaceutical anticoagulants was monitored in a variety of aqueous, solid, and biological environmental matrices during and after widespread sewer baiting with AR-containing bait. As a result, sewer baiting in combined sewer systems, besides outdoor rodent control at the surface, was identified as a substantial contributor of these biocidal active ingredients in the aquatic environment. In conjunction with heavy or prolonged precipitation during bait application in combined sewer systems, a direct link between sewer baiting and AR residues in wastewater treatment plant influent, effluent, and the liver of freshwater fish was established. -

Rheinland-Pfalz Verwaltung
Politische Bildung PULHEIM Rheinland-Pfalz - unser Land im Überblick LVermGeo Erft Verwaltung RurRheinland-Pfalz BERGISCH- Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz GEILENKIRCHEN GLADBACH für Landeszentrale Rheinland - Pfalz ÜBACH- KREUZTAL PALENBERG BERGHEIM LAND- Das Landeswappen JÜLICH FRECHEN www.lvermgeo.rlp.de GRAAF BAES- KÖLN WEILER Nordrhein-Westfalen NIEDER- Die Wappenzeichen der ehemaligen drei Kur- trägt eine „Volkskrone“, eine goldene Krone LANDE ALSDORF HÜRTH SIEGEN KERPEN fürstentümer Trier, Mainz und Pfalz - Trierer aus Weinlaub, Symbol der Volkssouveräni- KERKRADE Rur RHEIN Erftkanal Kreuz, Mainzer Rad und Pfälzer Löwe - sind tät. 1948 bestimmte der Landtag die Farben HERZOGEN- Kirchen (Sieg) im Wappen des Landes lebendig geblieben. Schwarz-Rot-Gold, Symbol für Freiheit und RATH BRÜHL ESCHWEILER Das Trierer Wappen - rotes Kreuz auf weißem Einheit, zu den Farben der Landesfahne. An TROISDORF Wahn- ALTENKIRCHEN WÜRSELEN bach- Grund - und das Mainzer Wappen - weißes das Ringen um Freiheit und Einheit unter talsperre Sieg ERFTSTADT WESSE- Wissen (WW) Kirchen Rad auf rotem Grund - sind erstmals im 13. diesen Fahnen erinnert noch heute eine alte DÜREN LING SIEGBURG (Sieg) Betzdorf Jahrhundert nachzuweisen. Der rotgekrönte und verblichene schwarz-rot-goldene Fahne AACHEN SANKT Sieg und rotbewehrte goldene Löwe auf schwar- im Plenarsaal des Landtages. Sie wurde beim STOLBERG Hamm Wissen Betzdorf Herdorf AUGUSTIN HENNEF (Sieg) zem Grund war ursprünglich Wappentier der Hambacher Fest 1832 mitgeführt und soll