Aletsch 5 4 7 8 10 99 14 15 16 17 3 2 6
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Managementstrategie Für Das UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn
Managementstrategie für das UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn Trägerschaft UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn Naters und Interlaken, 1. Dezember 2005 07_Managementstrategie_D_Titelse1 1 15.1.2008 11:11:27 Uhr Zitierung Trägerschaft UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, 2005: Managementplan für das UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn; Naters und Interlaken, Schweiz: Trägerschaft UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. Autoren Wiesmann, Urs; Wallner, Astrid; Liechti, Karina; Aerni, Isabel: CDE (Centre for Development and Environment), Geographisches Institut, Universität Bern Schüpbach, Ursula; Ruppen, Beat: Managementzentrum UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, Naters und Interlaken Kartenredaktion Hiller, Rebecca und Berger, Catherine; CDE (Centre for Development and Environment), Geographisches Institut, Universität Bern in Zusammenarbeit mit der Trägerschaft UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, Naters und Interlaken Kontaktadressen Trägerschaft und Managementzentrum UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn Postfach 444 CH-3904 Naters und Jungfraustrasse 38 CH-3800 Interlaken [email protected]; www.welterbe.ch © Trägerschaft UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, Naters, Schweiz Alle Rechte vorbehalten Titelfotos Trägerschaft UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (2005) Albrecht (1999); Ehrenbold (2001); Andenmatten (1995); Jungfraubahnen Kein Gebilde der Natur, das ich jemals sah, ist vergleichbar mit der -

Oeschinensee Ob Kandersteg – Lake Oeschinen Above Kandersteg
Switzerland – Tagesausflüge / One-day excursions (Teil 2) (With my best thanks to english translation assistant Coach R. Wyss) Oeschinensee ob Kandersteg – Lake Oeschinen above Kandersteg Bild mitte: Blümlisalp mit Niesen – Bild rechts Blümlisalp (3661 m) Blümlisalp von Mülenen. Unser Ausflugsziel befindet sich auf der Rückseite der Blümlisalp – Blümlisalp from Mülenen. Our destination for today is located direct behind the Blümlisalp. Bild links: Frutigen – Bild mitte und rechts: Blick Richtung Kandersteg Balmhorn/Altes (3698 m) Talstation Kandersteg (1176 m) – Doldenhorn (3638 m) – Bergstation (1682 m) Bild mitte: Fisistöck (2946 m) – Bild rechts: Bire (2502 m) Direkt neben der Bergstation befindet sich die 750 m lange Rodelbahn – Rigth next to the top station is the 750 m long toboggan run Bild mitte: Fründenhorn (3369 m) – Bild rechts: Ostwand Doldenhorn Der Spaziergang von der Bergstation zum Oeschinensee beträgt 25 Minuten – The walk from the upper cable way station to Lake Oeschinen takes about 25 minutes Vom Oeschinensee gibt es zahlreiche Bergwanderungen zu unternehmen. Auf dem Bild links (roter Pfeil) zur SAC-Fründenhütte (2562 m) und Bild rechts (schwarzer Pfeil) zur SAC-Blümli- salphütte (2840 m) – If you like mountain hikes and if you are in good physical condition, you can walk to Fründenhütte (2562 m) – 2½ h way up (red arrow) or to Blümlisalphütte (2840 m) - 4 h way up ( black arrow) Mittagessen – Lunch time Eggishorn: Der Grosse Aletschgletscher – The Great Aletsch Glacier Lageplan – Location map Der Aletschgletscher (117,6 Km2) mit einer Länge von 23 Kilometer der längste Gletscher der Alpen. Es gibt verschiedenen Aussichtspunkte um diesen zu sehen: Riederalp, Bettmeralp und Eggishorn, wo wir heute hingehen. -

C Lu B -N a C H R Ic H
Sektion Zofingen Club Alpin Suisse Schweizer Alpen-Club SAC Club Alpino Svizzero Club Alpin Svizzer n e g r. 3 Ausgabe Juli – Septe n N mber 2021 f o Z n o i t k e S N E T H C I R H C A N - B U L C IMPRESSUM Schweizer Alpen-Club, Sektion Zofngen, Homepage: www.sac-zofngen.ch 54. Jahrgang CLUB-NACHRICHTEN Sektion Zofingen Erscheinen 4-mal jährlich, Ende März, Ende Juni, Ende September, Ende Dezember Präsident Beat Weber, Wiesenstrasse 4, 4800 Zofingen, Tel. 062 752 36 33, [email protected] Finanzen Vita Pasic, Bündtenweg 9, 4805 Brittnau, Tel. 079 815 65 19, [email protected] Redaktion, Inserate und Mitgliederdienst Regula Hartmann, Gässli 10, 4665 Oftringen Tel. 079 317 48 04, [email protected] Redaktionsschluss für die Ausgabe 4 2021: 1. September 2021 Berichte und Fotos bitte an: [email protected] Clublokal Monatsversammlung im Hotel Zofingen, 20.00 Uhr Satz und Druck Carmen-Druck AG, Waldegg 12, 6242 Wauwil, Tel. 041 980 44 80, [email protected] Titelbild Kletterhalle BZZ Foto: Willy Hartmann Printprodukte & Layouts Schrift: Futura Book Buchstabe A ist Century Gothic Regular Flyer Falzprospekte Broschüren Briefe, Blocks Carmen-Druck AG 6242 Wauwil 041 980 44 80 carmendruck.ch [email protected] Karten aller Art Couverts Visitenkarten Kalender 2 INHALTSVERZEICHNIS Impressum 2 Inhaltsverzeichnis 3 Informationen aus dem Vorstand 5 Der Präsident informiert 5 Wir heissen herzlich willkommen 7 Wir trauern um 7 Erweiterung Kletterwand 9 Hüttenbewartung Vermigel 11 Kulturseite 13 Tourenberichte 18 Ersatztouren -

Summits on the Air – ARM V2.2 Für Schweiz (HB)
Summits on the Air – ARM v2.2 für Schweiz (HB) Summits on the Air Schweiz (HB) Assoziations-Referenzhandbuch Dokumentreferenz S13.2 Version 2.2 Version gültig ab 01-Okt-2019 Teilnahme seit 01-Aug-2005 Geprüft SOTA MT Datum 01-Okt–2019 Assoziationsmanager Jürg Regli, HB9BIN Summits-on-the Air ein Originalkonzept von G3WGV entworfen mit G3CWI Vermerk “Summits on the Air” SOTA und das SOTA Logo sind Warenzeichen des Programms. Dieses Dokument steht unter Urheberrecht des Programms. Alle anderen Warenzeichen und Urheberrechte die sich auf das Programm beziehen sind anerkannt. Seite 1 von 66 Dokument S13.2 Summits on the Air – ARM v2.2 für Schweiz (HB) Inhaltsverzeichnis 1 ÄNDERUNGSPROTOKOLL ..................................................................................................................... 4 2 ASSOZIATIONS-REFERENZDATEN ................................................................................................... 12 2.1 REGIONSEINTEILUNG ............................................................................................................................ 13 2.2 GENERELLE INFORMATIONEN ............................................................................................................... 13 2.3 KARTENMATERIAL ............................................................................................................................... 13 2.4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS ....................................................................................................................... 14 2.5 LETZTE WORTE ................................................................................................................................... -

13 Protection: a Means for Sustainable Development? The
13 Protection: A Means for Sustainable Development? The Case of the Jungfrau- Aletsch-Bietschhorn World Heritage Site in Switzerland Astrid Wallner1, Stephan Rist2, Karina Liechti3, Urs Wiesmann4 Abstract The Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn World Heritage Site (WHS) comprises main- ly natural high-mountain landscapes. The High Alps and impressive natu- ral landscapes are not the only feature making the region so attractive; its uniqueness also lies in the adjoining landscapes shaped by centuries of tra- ditional agricultural use. Given the dramatic changes in the agricultural sec- tor, the risk faced by cultural landscapes in the World Heritage Region is pos- sibly greater than that faced by the natural landscape inside the perimeter of the WHS. Inclusion on the World Heritage List was therefore an opportunity to contribute not only to the preservation of the ‘natural’ WHS: the protected part of the natural landscape is understood as the centrepiece of a strategy | downloaded: 1.10.2021 to enhance sustainable development in the entire region, including cultural landscapes. Maintaining the right balance between preservation of the WHS and promotion of sustainable regional development constitutes a key chal- lenge for management of the WHS. Local actors were heavily involved in the planning process in which the goals and objectives of the WHS were defined. This participatory process allowed examination of ongoing prob- lems and current opportunities, even though present ecological standards were a ‘non-negotiable’ feature. Therefore the basic patterns of valuation of the landscape by the different actors could not be modified. Nevertheless, the process made it possible to jointly define the present situation and thus create a basis for legitimising future action. -

G Rosser Al Et Schgl Etscher
EN IT Bietschhorn Breithorn Nesthorn Schinhorn Sattelhorn Aletschhorn Jungfrau Jungfraujoch Mönch Eiger Fiescherhörner Finsteraarhorn Oberaarhorn 3934 m 3785 m 3822 m 3797 m 3745 m 4193 m 4158 m 3454 m 4107 m 3970 m 4049 m 4274 m 3637 m Grosses Wannenhorn Dreieckhorn 3905 m FEELINFORMATION CABLEWAYS FREE SUMMER 2015 3810 m INFOS IMPIANTI DI RISALITA ESTATE 2015 Geisshorn 3740 m Finsteraarhornhütte (SAC) Hohstock 3048 m Unterbächhorn 3226 m Grosses Fusshorn Konkordiahütten (SAC) 3554 m Zenbächenhorn 2850 m - 3626 m Konkordiaplatz Wasenhorn B e i h 3386 m Kleines Wannenhorn c h s c 3706 m 3447 m - l e t Olmenhorn r a r Rothorn 3314 m Grisighorn O b e e Sparrhorn n 3271 m 3177 m Oberaletschhütte (SAC) r 3021 m ö 2640 m h G s l s Strahlhorn e u t 3050 m s F c r r h e e Setzehorn e h h 3061 m 2730 m r c Platta c Hohbiel, 2664 m t s 2380 m s e t Täschehorn l l e h g g Tyndalldenkmal s c e r 3008 m 2351 m e t Eggishorn c h Risihorn l e s Roti Seewe A 2926 m Märjelensee F i 2876 m e r 360° Panoramarundsicht Gletscherstube Märjelewang 2680 m Bergstation Eggishorn, 2869 m 2302 m 2346 m Lengsee Lüsgasee NEW: s Vordersee Bruchegg s 2706 m Brusee Lüsga aletscharena.ch/project_moosfluh o Roti Chumme Gletscherblick 2130 m r 2369 m 2615 m NOUVO: Tällisee Belalp, 2094 m 2124 m Wirbulsee 2724 m 2130 m aletscharena.ch/progetto_moosfluh G Bettmerhorn Tälligrat Rinnerhitta UNESC anoramaweg 2653 m Hotel Belalp O-P 2858 m 2610 m UNESCO Elsenlücke 2386 m 1931 m Furggulti-Berg, 2560 m Mittelsee Üssers Aletschji 2722 m Höhenweg n 2549 m Bäll 1756 m r 2625 m Hängebrücke -

Eisströme Im Aletschgebiet Ice Streams in the Aletsch Region
Eisströme im Aletschgebiet Ice streams in the Aletsch region Gletscher I Glacier Wissenswertes 2 Als die Gletscher bis ins Mittelland reichten … Es ist «nur» zirka 24‘000 Jahre her: Damals, während des Höhepunktes der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit, glichen die Schweiz und damit auch das ganze Wallis einem zu lange nicht mehr abgetauten Gefrierfach: Der Fieschergletscher, der Grosse Aletschgletscher und der Rhonegletscher bildeten zusammen einen gewaltigen Eispanzer. Verstärkt und angeschoben durch die Eis- ströme aus den Walliser Seitentälern, reichten die Glet- scherausläufer bis nach Solothurn und der südliche Teil dieser gewaltigen Eismasse stiess sogar bis nach Lyon vor. Und es war kalt während der letzten Eiszeit: Die mittlere Jahrestemperatur lag 14-15° C tiefer als heute. Das ganze Rhonetal und sämtliche Walliser Seitentäler lagen also unter einer zusammenhängenden Eismasse, so auch das gesamte Aletschgebiet. Aus diesem Eis- meer ragten nur die höchsten Bergspitzen hervor: das Finsteraarhorn, das Aletschhorn, das Eggishorn, das Bettmerhorn, das Bietschhorn und das Sparrhorn. Zwi- schen Fiesch und Brig war der Eispanzer schätzungs- weise 1700 Meter dick und über der Riederfurka lastete eine Eisdecke von 400 bis 500 Metern Mächtigkeit. 1 Valuable Information 3 In the days when the glaciers reached the Mittelland … About 24,000 years ago, during the peak of the last gla- cial period (the Würm ice age) most of Switzerland and thus all of Valais resembled a freezer, which had not been defrosted for too long: the Fiescher glacier, the Great Aletsch glacier and the Rhone glacier formed an impressive ice shield. Strengthened and pushed by the ice streams from the Valais side valleys, the glacier’s ends reached to today’s Solothurn and the southern part of this huge ice field even advanced as far as Lyon. -

BLN 1706/1507 Berner Hochalpen Und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (Südlicher Teil)
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung BLN BLN 1706/1507 Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil) Kantone Gemeinden Fläche Wallis Ausserberg, Baltschieder, Bellwald, Bettmeralp, Bitsch, Blatten, Blitzingen, 47 320 ha Eggerberg, Ferden, Fieschertal, Grafschaft, Kippel, Münster-Geschinen, Naters, Niedergesteln, Raron, Reckingen-Gluringen, Riederalp, Steg- Hohtenn, Wiler (Lötschen) Bern Grindelwald, Guttannen, Lauterbrunnen 1 BLN 1706/1507 Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil) Die Wahrzeichen der Berner Hochalpen: Eiger, Mönch BLN 1706/1507 Berner Hochalpen und Aletsch- und Jungfrau Bietschhorn-Gebiet Aletschgletscher, Blick vom Jungfraujoch Lötschental, Blick von der Anenhütte talabwärts Sefinental mit Jungfrau Ausschmelzmoräne Blüemlisalpgletscher 2 BLN 1706/1507 Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil) 1 Begründung der nationalen Bedeutung für den gesamten Raum 1.1 In weiten Teilen unberührte und unerschlossene Hochgebirgslandschaft 1.2 Eiger, Mönch und Jungfrau: eine der weltweit bekanntesten Gipfelgruppen 1.3 Grösste zusammenhängende Eisfläche der Alpen mit dem Grossen Aletschgletscher als längstem und ausgedehntestem Gletscher der Alpen 1.4 Vielfältiger geologischer und geomorphologischer Formenschatz: Zeugnis der alpinen Gebirgsbildung und der eiszeitlichen Vergletscherung 1.5 Besondere glaziologische Erscheinungen an der Grimsel mit Rundhöckern, versumpften Mulden, Schliffgrenzen und Rückzugsstadien 1.6 Eindrückliche dynamische -

Automatic Photo-To-Terrain Alignment for the Annotation of Mountain Pictures
Automatic Photo-to-Terrain Alignment for the Annotation of Mountain Pictures Lionel Baboud∗⋆ Martin Cadˇ ´ık⋆ Elmar Eisemann†† Hans-Peter Seidel⋆ ⋆Max-Planck Institute Informatik, †Telecom ParisTech/CNRS-LTCI Pikes Peak Almagre Mountain Cameron Cone Sachett Mountain 4303.5 m, 21 km 3776.5 m, 20 km 3839 m, 20 km Devils Playground 3776.5 m, 20 km 3264.5 m, 14 km 3983 m, 23 km Sheep Mountain 2989.5 m, 15 km Mt. Manitou 2989.5 m, 15 km 2880.5 m, 13 km Crystal BM 3200.5 m, 19 km Abstract 1. Introduction The internet offers a wealth of audio-visual content We present a system for the annotation and augmen- and communities such as Flickr and YouTube make large tation of mountain photographs. The key issue resides amounts of photos and videos publicly available. In many in the registration of a given photograph with a 3D geo- cases, an observer might wonder what elements are visible referenced terrain model. Typical outdoor images contain on a certain shot or movie. Especially for natural scenes, little structural information, particularly mountain scenes the answer to this question can be difficult because only whose aspect changes drastically across seasons and vary- few landmarks might be easily recognizable by non experts. ing weather conditions. Existing approaches usually fail on While the information about the camera position is (at least such difficult scenarios. To avoid the burden of manual reg- roughly) known in many cases (photographer’s knowledge istration, we propose a novel automatic technique. Given or camera GPS), the camera orientation is usually unknown only a viewpoint and FOV estimates, the technique is able to (digital compasses have poor accuracy). -

Arvenduft Entdecken Discover the Fragrance of Swiss Stone Pine
/aletscharena /aletscharena /aletscharena_ch aletscharena_ch /aletscharena /aletscharena Aletsch Arena App feelDAS BEFREIENDSTE NATURERLEBNIS DER ALPEN freE Arvenduft entdecken Aletsch Arena Hier rubbeln Riederalp – Bettmeralp – Fiesch-Eggishorn Discover the fragrance of Swiss Stone Pine Scratch here Aletsch Arena AG Découvrir le parfum d’arolle Postfach 16 Gratter ici CH-3992 Bettmeralp +41 27 928 58 58 Scoprite il profumo del pino cembro Grattare qui [email protected] aletscharena.ch Natur, soweit das Auge reicht. Der Aletschgletscher im UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch ist der längste Gletscher der Alpen. Seine Eis- Natur- und Felsmassen ziehen sich über 23 km von den Nordflanken von Eiger, Mönch und Jungfrau bis hinunter in die Aletsch Arena. phänomen aletscharena.ch/naturphaenomen spüren Experience a true natural phenomenon Nature as far as the eye can see. The Aletsch Glacier in the UNESCO Swiss Alps Jungfrau-Aletsch World Heritage Site is the longest glacier in the Alps. Its ice and rock masses stretch over 23 km from the north flanks of the Eiger, Mönch and Jungfrau down into the Aletsch Arena. Communier avec la nature Percepire i fenomeni naturali aletscharena.ch/nature-en Une nature qui s’étend à perte de vue. Splendida natura a perdita d’occhio. Situé dans la région des Alpes suisses Il ghiacciaio dell’Aletsch, facente parte Jungfrau-Aletsch inscrite au patri- del patrimonio mondiale dell’UNESCO moine mondial de l’UNESCO, le Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch, è il più glacier d’Aletsch est le plus long lungo ghiacciaio delle Alpi. I suoi am- fleuve de glace des Alpes. Sa masse massi di ghiaccio e rocce si estendono rocheuse et son amas de glace per 23 km, dalle pareti settentrionali s’étendent sur 23 km, des faces nord di Eiger, Mönch e Jungfrau fino ad arri- de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau vare all’Aletsch Arena. -

Leseprobe BE3.Pdf
Impressum Impressum Titelbild Blick vom Galletgrat (Doldenhorn) zum Berner Alpen-Gipfelmeer, Juli 2013 Seite 1 Vielfalt der Berner Alpen am Doldenhorn: Blumen, Kalkfelsen und Gletscher. Seite 3 Morgensonne am Trugberg-NW-Grat, © F. Schwager (Foto: Juli 2014) Fotos Sofern nicht anders vermerkt aus dem Archiv der Autoren Topos / Layout Daniel Silbernagel, Basel Lektorat / Übersetzungen Gaby Funk, freie Journalistin, Autorin, Oy-Mittelberg, Deutschland Fachlektorat Tobias Erzberger, Basel Kartenrechte Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BM120149) Druck Vetter Druck AG, Thun, COC-Zertifikat SQS-COC-100180 3. komplett überarbeitete, erweiterte Ausgabe, Sommer 2016 ISBN 978-3-9524009-0-6 Autoren das buch zum berg Daniel Silbernagel, Basel, Schweiz, [email protected] Stefan Wullschleger, Allschwil, Schweiz, [email protected] © topo.verlag www.topoverlag.ch das buch zum berg [email protected] PERFORMANCE neutral Drucksache No. 01-15-464073 – www.myclimate.org © myclimate – The Climate Protection Partnership Anregungen und Korrekturen Die Angaben in diesem Führer wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen der Autoren zusammengestellt. Die Begehung der vorgeschlagenen Routen und Touren erfolgt auf eigene Gefahr. Die Schwierigkeiten hängen stark von den Verhältnissen ab. Hinweise auf Fehler und Ergänzungen nehmen die Autoren dankbar entgegen. 2 Hochtouren Topoführer – Berner Alpen – 3. Auflage 2016 Inhaltsverzeichnis / table of contents / Index Inhaltsverzeichnis table of contents / Index Einleitung Seite -
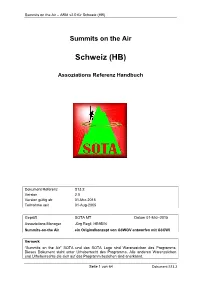
Summits on the Air – ARM V2.0 Für Schweiz (HB)
Summits on the Air – ARM v2.0 für Schweiz (HB) Summits on the Air Schweiz (HB) Assoziations Referenz Handbuch Dokument Referenz S13.2 Version 2.0 Version gültig ab 01-Mrz-2015 Teilnahme seit 01-Aug-2005 Geprüft SOTA MT Datum 01-Mrz–2015 Assoziations Manager Jürg Regli, HB9BIN Summits-on-the Air ein Originalkonzept von G3WGV entworfen mit G3CWI Vermerk “Summits on the Air” SOTA und das SOTA Logo sind Warenzeichen des Programms. Dieses Dokument steht unter Urheberrecht des Programms. Alle anderen Warenzeichen und Urheberrechte die sich auf das Programm beziehen sind anerkannt. Seite 1 von 64 Dokument S13.2 Summits on the Air – ARM v2.0 für Schweiz (HB) Inhaltsverzeichnis 1 ÄNDERUNGSPROTOKOLL..................................................................................................................... 4 ASSOZIATIONS REFERENZ DATEN ........................................................................................................... 11 1.1 REGIONSEINTEILUNG ........................................................................................................................... 12 1.2 GENERELLE INFORMATIONEN .............................................................................................................. 12 1.3 KARTENMATERIAL ............................................................................................................................... 12 1.4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS ....................................................................................................................... 13 1.5 LETZTE WORTE...................................................................................................................................