WOB 8 Die Ortsnamen Des Kreises Olpe.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Modellregion Eifelkreis Bitburg-Prüm Das Modellvorhaben
Modellvorhaben Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen Modellregion Eifelkreis Bitburg-Prüm Ziele – Vorgehen – Ergebnisse Das Modellvorhaben Mit dem Modellvorhaben leistet das Bundes Zu den Zielgruppen zählen u. a. Jugendliche, ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Familien mit Kindern und Senioren. Durch ihre einen Beitrag dazu, gleichwertige Lebensverhält aktive Einbindung können ihre Ideen aufge nisse in ländlichen Räumen zu gewährleisten. nommen und die Akzeptanz und Effizienz von Es soll die 18 Modellregionen dabei unterstützen, künftigen Lösungen gefördert werden. Daseinsvorsorge, Nahversorgung und Mobilität besser zu verknüpfen, um die Lebensqualität in Je nach Ausgangsbedingungen variiert der der Region zu verbessern und wirtschaftliche strategische Ansatz des Modellvorhabens in den Entwicklung zu ermöglichen. einzelnen Regionen. Während ein Konzept zur Bündelung von Standorten der Daseinsvorsorge In dem Modellvorhaben wird besonderer Wert in „Kooperationsräumen“ eher nur mittel- bis darauf gelegt, dass neben Politik, Verwaltung, langfristig umgesetzt werden kann, wird sich Zivilgesellschaft sowie Anbietern von Daseins ein integriertes Mobilitätskonzept auch schon vorsorgedienstleistungen und Nahversorgung in kürzerer Frist auf die vorhandene Verteilung von Beginn an auch die verschiedenen Ziel und der Daseinsvorsorgeeinrichtungen ausrichten Nutzergruppen vor Ort aktiv in die Entwicklung können. In Verbindung mit dem Kooperations und Umsetzung von Standortkonzepten und raumkonzept -

Media Information Media Information
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG Aloys-Mennekes-Str. 1 D-57399 Kirchhundem / Germany Phone +49 (0) 27 23 / 41-1 Fax +49 (0) 27 23 / 41-214 E-Mail [email protected] Media information Internet www.MENNEKES.de Media information Steinmeier visits Mennekes in Kirchhundem Kirchhundem. On 31 October, company Mennekes welcomed Dr. Frank-Walter Steinmeier in Kirchhundem. The chairman of the SPD's parliamentary group in the Bundestag had accepted Walter Mennekes’ invitation to visit them. The two have known each other for many years, having joined trips as delegates of the former black-red coalition government, together with representatives of the German industry. Following the welcome greeting and a detailed plant tour through the modern production facilities, Frank-Walter Steinmeier addressed the staff of Mennekes. He was impressed by the Sauerland company’s innovative strength in both its core business of industrial plugs and sockets and its charging solutions in the area of electric mobility. Steinmeier highlighted the importance of medium-sized enterprises as the driving force of Germany’s economy. He pointed out that family-owned businesses in particular define sustainably the German industry by thinking and acting in a long-term based fashion. He than met with Mennekes’ entire works council and management team to discuss the current challenges faced by family-owned businesses, including how to deal with the dwindling numbers of skilled workers. Walter Mennekes believes that the visit was worth it: “It is important that politicians know what kind of issues are affecting medium-sized, family-owned enterprises and what we expect from politics. -

Schwatt Op Witt Iut Hungeme
Nr. 23 - Dezember 2010 Schwatt op Witt iut Hungeme Neues und Altes, Geschichte und Geschichten aus Kirchhundem Dorfzeitung für Kirchhundem und Umgebung Liebe Kirchhundemer, Helmut Schauerte hat mir damals Doch ist nicht die Tatsache, dass wir liebe Schwatt-op-Witt das Zepter in die Hand gedrückt, unverändert und jugendfrisch uns als ich noch sehr wenig Bezug zum strebend bemühen, bereits lobens- Leser, Heimatort Kirchhundem hatte. Ich werter Erfolg? Der alte Gedanke, lebte im Vorort. „Das macht nichts“, schöner werden zu wollen, ist schön, ich grüße Sie alle recht herzlich an meinte er, „Heimatliebe kommt von wach und jung geblieben. Ein schei- dieser exponiert auffälligen Stelle allein. Man muss nur regelmäßig dender Alter, der den Elan beruflich in unserem heimatgeschichtlichen mitmachen.“ Insofern hatte er Recht. stark belasteter junger Mitstreiter Ortsjournal. Eigentlich tue ich das Nur dass er mir kein Zepter sondern kennen lernen durfte, weiß, dass ohne Vertretungsmacht, denn Bei- einen Bumerang in die Hand drück- wir auf dem rechten Wege sind, und ratsvorsitzender bin ich zum Segen te. Das habe ich erst später bemerkt. ahnt, dass wir erfolgreich sein wer- unseres Bürgervereins nicht mehr. den. Noch ist der Weg das Ziel. So Das ist jetzt zum Segen Peter Kauf- Seit Jahren bin ich bemüht, diese heißt es nach einer indischen Weis- mann. „Bleiben Sie gesund und zah- Waffe wieder los zu werden. Noch heit! Halten wir den Weg. Andere lungsfähig!“, darf ich Ihnen wün- heute traf sie mich am Kopf, als sie sagen jetzt: „wir machen den Weg schen. Ich bedanke mich zunächst wieder zurückkam. Schlimm ist nur, frei!“ für Ihr Interesse. -
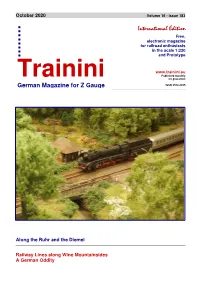
Trainini Model Railroad Magazine
October 2020 Volume 16 • Issue 183 International Edition Free, electronic magazine for railroad enthusiasts in the scale 1:220 and Prototype www.trainini.eu Published monthly Trainini no guarantee German Magazine for Z G auge ISSN 2512-8035 Along the Ruhr and the Diemel Railway Lines along Wine Mountainsides A German Oddity Trainini ® International Edition German Magazine for Z Gauge Introduction Dear Readers, If I were to find a headline for this issue that could summarise (almost) all the articles, it would probably have to read as follows: “Travels through German lands”. That sounds almost a bit poetic, which is not even undesirable: Our articles from the design section invite you to dream or help you to make others dream. Holger Späing Editor-in-chief With his Rhosel layout Jürgen Wagner has created a new work in which the landscape is clearly in the foreground. His work was based on the most beautiful impressions he took from the wine-growing regions along the Rhein and Mosel (Rhine and Moselle). At home he modelled them. We like the result so much that we do not want to withhold it from our readers! We are happy and proud at the same time to be the first magazine to report on it. Thus, we are today, after a short break in the last issue, also continuing our annual main topic. We also had to realize that the occurrence of infections has queered our pitch. As a result, we have not been able to take pictures of some of the originally planned layouts to this day, and many topics have shifted and are now threatening to conglomerate towards the end of the year. -

Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept Stadt
Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) der Stadt Lennestadt Der Schatz im Sauerland Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept Stadt Lennestadt Bearbeitungszeitraum: Dezember 2017 – November 2018 Auftraggeber: Stadt Lennestadt Thomas-Morus-Platz 1 57368 Lennestadt Tel.: 02723 608 - 0 Auftragnehmer: Arbeitsgemeinschaft Arbeitsgruppe Stadt MSP ImpulsProjekt Sickingenstraße 10 Zum alten Hohlweg 1 34117 Kassel 58339 Breckerfeld Tel.: 0561 778357 Tel.: 02338 545381 Bearbeiter: Dr. Jürgen Schewe Dipl. Ing. M.Sc. Nicolai Sieber Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete Gefördert wird die Ausarbeitung / Aktualisierung von Plänen zur Entwicklung ländlicher Gemeinden (M 7.1) im Rahmen des NRW-Programms Ländlicher Raum 2014-2020 unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) I Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) der Stadt Lennestadt Der Schatz im Sauerland Inhalt 1 IKEK Lennestadt - Zielsetzung und Vorgehensweise ...................................................................... 1 1.1 Einordnung und Grundlagen ..................................................................................................... 1 1.2 Methodik und Verlauf der Konzeptentwicklung ......................................................................... 1 1.2.1 Grundansatz der Bearbeitung........................................................................................... -

Wegbeschreibung Ihr Weg Ins Sauerland
Wegbeschreibung Ihr Weg ins Sauerland Der suaerländische Luftkurort Saalhausen liegt, verkehrstechnisch gut angebunden, an der B 236 im Len- netal etwa 30 Kilometer vor den renomierten Urlaubsorten Winterberg und Altastenberg und nur einen Katzensprung entfernt von Schmallenberg und Jagdhaus. Sie erreichen uns bequem mit dem Auto oder der Bundesbahn. Gerne bieten wir allen Bahnreisenden, gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, einen Abhol- und Bringservice zum nächstgelegenen Bahnhof an. Um besser planen zu können und Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie uns Ihre Ankunftszeit etwa 1 Tag vor Ihrer Anreise mitzuteilen. Anreise aus Richtung Westen • Aus Richtung Köln kommend verlassen Sie die Autobahn A 4 an der Ausfahrt Krombach • Folgen Sie den Schildern Richtung Lennestadt (B 54, B 517) • In Lennestadt-Altenhundem biegen Sie an der 3. Ampelkreuzung rechts auf die B 236 in Richtung Schmallenberg / Winterberg ab • Nach ca. 10 Minuten erreichen Sie Saalhausen • Unser Hotel finden Sie in der Ortsmitte direkt neben der Kirche • ACHTUNG: In der Ortsdurchfahrt Altenhundem befindet sich eine Blitzanlage Anreise aus Richtung Süden • Aus Richtung Frankfurt kommend verlassen Sie die Autobahn A 45(Sauerlandlinie) an der Ausfahrt Olpe • Folgen Sie den Schildern Richtung Lennestadt / Winterberg / Kirchhundem (B 55) • In Lennestadt-Bilstein biegen Sie an der Ampelkreuzung Rechts auf die L 715 in Richtung Lennestadt / Winterberg ab • In Lennestadt-Altenhundem biegen Sie an der Ampelkreuzung links auf die B 236 in Richtung Schmallenberg / Winterberg ab • Nach ca. 400 m biegen Sie an der nächsten Ampelkreuzung erneut links ab • Folgen Sie der B 236 in Richtung Schmallenberg / Winterberg • Nach ca. 10 Minuten erreichen Sie Saalhausen • Unser Hotel finden Sie in der Ortsmitte direkt neben der Kirche • ACHTUNG: Direkt nach der Autobahnabfahrt befindet sich eine Blitzanlage Landhotel Voss • Winterberger Str. -

Brandschutzbedarfsplan Feuerwehr Der Gemeinde Kirchhundem
Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Kirchhundem (Stand: 08/2012) GEMEINDE KIRCHHUNDEM Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Kirchhundem Retten - Löschen - Bergen - Schützen Seite 1 Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Kirchhundem (Stand: 08/2012) Inhalt 1. Allgemeiner Teil 2. Vorstellung und aktuelle Betrachtung der Feuerwehr 3. Darstellung der rechtlichen Grundlagen 4. Darstellung der Aufgaben der Feuerwehr 5. Gefährdungspotential 5.1 Die Gemeinde Kirchhundem im Überblick 5.2 Standorte der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem 5.3 Topografische Betrachtung 6. Personalbericht 7. Risiken 7.1 Gefahrenbereiche 7.2 Szenarien 7.3 Statistik der Feuerwehr 8. Schutzzielfestlegung 8.1 Schutzzieldefinition in der Gemeinde Kirchhundem 9. Soll-/Ist-Struktur 9.1 Topografischer Erreichungsgrad 9.2 Einsatzstärke / Personal 9.3 Feuerwehrtechnische Ausstattung 10. Zusammenfassung / Maßnahmen / Fortschreibung 11. Anlagen Seite 2 Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Kirchhundem (Stand: 08/2012) 1. Allgemeiner Teil Mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) zum 01.03.1998 sind die Gemeinden gehalten, unter Beteiligung ihrer Feuerwehr, Brandschutzbe- darfspläne und Pläne für den Einsatz ihrer Feuerwehr aufzustellen und fortzuschreiben (§ 22 Abs. 1 FSHG). Die Gemeinde Kirchhundem hat im Jahre 2000 erstmals auf Grundlage des zum 01.03.1998 in Kraft getretenen neuen FSHG einen Brandschutzbedarfsplan aufgestellt, den der Rat in seiner Sitzung vom 07.12.2000 beschlossen hat. Das mit Ratsbeschluss vom 11.07.1995 verabschiedete Brandschutzkonzept der Gemeinde Kirchhundem wurde durch den Brandschutzbedarfsplan ersetzt. Der Brandschutzbedarfsplan legt die Qualität der Gefahrenabwehr fest, indem er die Hilfsfrist, die Funktionsstärke sowie den Erreichungsgrad im Hinblick auf ein standardisiertes Schadens- ereignis (= kritischer Wohnungsbrand) definiert. Hierdurch soll der Feuerschutz gegenüber dem Rat und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde transparent gemacht werden. -

Sauerland Radring
Radringflyer Karte 2010:Radringflyer_Karte_2010 30.12.09 15:24 Seite 1 SauerlandRadringSauerlandRadring 11,5 km bis zum RuhrtalRadweg Wennenmen 1 Heimatstube Schönholthausen – Finnentrop-Schönholthausen Direkt neben der Kirche, in einem der schönsten Fachwerkhäuser von Schönholthausen, werden auf 260 qm Fläche die seit 1992 gesammelten und teils liebevoll wieder hergerichteten Exponate aus dem Leben und Wirken unserer Vorfahren zur Land- und Forstwirtschaft der Region, des dörflichen Handwerks und des heimischen Brauchtums gezeigt. s Geöffnet jeden 1. Sonntag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr. 2 „Alte-Mühle“ – Finnentrop-Frettermühle Wo über 630 Jahre lang Getreide gemahlen und bis 1983 auch noch Brot gebacken wurde, kann man nun bei Kaffee und Kuchen faszinierende alte Technik bewundern. Führungen nach Vereinbarung. Café geöffnet samstags, sonntags Wenne- und an Feiertagen 14-18 Uhr. Tel. 02721-70872, www.muehlencafestuebchen-brill.de radweg (ab 2011) 3 Knochenmühle – Finnentrop-Fretter Wenne- Um 1900 wurde eine alte Erzpoche dazu zweckentfremdet, im Winter Knochen zu Knochenmehl, zur Felddüngung und radweg als Futterzusatz für Jungvieh und Hühner zu zerstampfen. Führungen nach Vereinbarung, Tel. 02721-5120 (ab 2011) 8 4 Pumpspeicherwerk – Finnentrop–Rönkhausen–Glinge Winterumfahrung: Nachts wird mit überschüssigem Strom über Pumpturbinen aus dem 1,3 Mio. m3 fassenden Unterbecken Wasser in das 1 Mio. m3 fassende Oberbecken gepumpt, um zu Spitzenlastzeiten tagsüber preisgünstig und schnell Strom zu erzeugen. Fledermaustunnel von 312 7 Wenne- Der Weg um das Oberbecken ist frei zugänglich, Führungen durch das Krafthaus für Gruppen nach Absprache mit Mark-E, November bis Ende März/ E-Bike radweg Tel. 02331-12322720, www.mark-e.de Anfang April gesperrt! 16 km bis zum (ab 2011) s RuhrtalRadweg 5 Sieben-Schmerzen-Stationen – Finnentrop-Serkenrode Kinderland Trekkingroute Die Betrachtung der „Sieben Schmerzen Mariens“ ist eine alte, heute selten gewordene Form der Marienverehrung. -

Merkblatt Zur Beteiligung Der Bezirksschornsteinfegermeisterin
Merkblatt zur Beteiligung der Bezirksschornsteinfegermeisterin/ des Bezirksschornsteinfegermeisters Stadt Schmallenberg - Untere Bauaufsichtsbehörde - Nach der Vorschrift des § 43 Abs. 7 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) muss die Bauherrin/der Bauherr sich bei der Errichtung oder Änderung von Schornsteinen sowie bei Anschluss von Feuerstätten an Schornsteine oder Abgas- leitung von der Bezirksschornsteinfegermeisterin/dem Bezirksschornsteinfegermeister (BZSM) bescheinigen lassen, dass der Schornstein oder die Abgasanlage sich in ei- nem ordnungsgemäßen Zustand befindet und für die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist. Bei der Errichtung von Schornsteinen soll der/dem BZSM Gelegenheit gegeben werden, vor Erteilung der Bescheinigung auch den Rohbauzustand zu be- sichtigen. Die Bescheinigung braucht der Bauaufsichtsbehörde nicht vorgelegt werden. Sollten Mängel festgestellt werden, wird die oder der BZSM dies der Bauaufsichtsbe- hörde von sich aus mitzuteilen. Mit Erteilung der Baugenehmigung erhält die/der für den Bezirk zuständige BZSM au- tomatisch hierüber eine Information durch die Bauaufsichtsbehörde. Eine Übersicht über die Bezirke und der/des jeweils zuständigen BZSM ist auf der Rückseite abge- druckt und kann jeweils aktuell auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises unter www.hochsauerlandkreis.de (Dienstleistungen A - Z, Schornsteinfegerangelegenhei- ten, Kehrbezirksverzeichnis) abgerufen werden. 04/2011 Bezirke der Bezirksschornsteinfegermeister Kehrbezirk HSK 08 (Eslohe) Bezirksschornsteinfegermeister -

Die Ruhr Und Ihr Gewässereinzugsgebiet Stand: 2017
B8_Layout 1 14.04.16 12:15 Seite 1 Die Ruhr und ihr Gewässereinzugsgebiet Stand: 2017 Nach der Lippe ist die Ruhr der Bis auf einen „Grenzübertritt” ins Gewässer seinen Na men behält, wird zweitlängste in Westfalen fließende Rheinland bei Radevormwald bleibt hier jedoch nicht eingehalten. Fluss (171 km) mit einer Gesamtlän- das Gewässereinzugsgebiet der Ruhr Auf den ersten 20 km bis Olsberg ge von 219 km. Sie entwässert als in diesem Bereich auf westfälischem verliert die Ruhr aufgrund des star- Gewässer 2. Ordnung mit ihren Boden, bevor es dann nördlich von ken Sohlgefälles ca. 340 Höhenme- zahl reichen Nebenflüssen/-bächen Wuppertal bis zur Ruhr mün dung in ter. Rechtsseitige Nebenbäche sind den größten Teil des zum Rheini- den Rhein ca. 30 km in das Rhein- der Hillebach und der Gierskopp- schen Schiefergebirges gehörenden land hineinragt. bach. Ab Olsberg findet die Ruhr Sauerlandes. Der Bereich von Mül- ihre Hauptfließrichtung: westwärts in heim bis zur Mündung wird natur- Wasserwirtschaft Richtung Rhein. Während hier von Naturraum räumlich zur Niederrheinischen Die Ruhr ist namengebend für rechts, aufgrund der nahen Wasser- Bucht gerechnet. Über den Rhein Deutschlands größtes Industriegebiet scheide im Arnsberger Wald, keine (Gewässer 1. Ordnung) und seinen und hält mit ihrem Gewäs ser sys tem be deutenden Zuflüsse zu verzeichnen Mündungsarmen ge langt das Was- einen Rohwasserspeicher für ca. 4,6 sind, münden von links die aus dem ser aus dem Bereich der Ruhr zur Mio. Menschen vor. Der wassermen- Bereich der Hunau stammenden Nordsee bzw. zum IJsselmeer. genmäßigen Bewirtschaftung durch Flüsschen Elpe und Valme. den Ruhrverband dient das größte Ab der Einmündung der Henne Gewässereinzugsgebiet Talsperrensystem Deutschlands. -

Sauerland- Wandeldorpen
Sauerland- Wandeldorpen Wandel suggesties en kaarten SAUERLAND WANDERDÖRFER sauerland-wanderdoerfer.de Mijn ontdekking – Sauerlandse 2 – Sauerlandse wandeldorpen De Sauerlandse wandeldorpen SAUERLAND WANDERDÖRFER vormen samen een wandelregio met een dicht netwerk van prachtige de Sauerland-Höhenflug, maar vooral en goed bewijzerde wandelroutes het uitgebreide net aan kwalitatief zoals het bijna nergens anders in uitstekende wandelroutes maken de Sau- Duitsland te vinden is. erlandse wandeldorpen zo bijzonder. n en om de plaatsen Brilon, Diemel- Tot de specifieke wandelbelevenissen Isee, Lennestadt & Kirchhundem, over grotendeels natuurwegen met veel Medebach, Olsberg, Schmallenberg landschappelijke en culturele bijzon- & Eslohe, Willingen, Winterberg & Hallenberg vindt u belevenisrijke wandelroutes die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn – of het nu om de gepassioneerde sportwandelaar gaat of om genieters en gezinnen met kinderen. Op de volgende bladzijden vindt u uitgebreide informatie over de Sauerlandse wandeldorpen met daarbij speciale wandeltips. Niet alleen de lange afstandroutes Rot- haarsteig, de Sauerland-Waldroute en 3 www.sauerland-wanderdoerfer.de Van harte welkom in de Sauerlandse wandeldorpen! het beschikbare kaartmateriaal kunt u zich in de wandelregio heel gemakke- lijk oriënteren. Bovendien hebben de Sauerlandse wandeldorpen reeds verschillende kant en klare routes derheden horen vanzelfsprekend de voor u samengesteld. Maar u kunt na- gecertificeerde meerdaagse wandelrou- tuurlijk ook uw eigen route met behulp tes -

Rund Um Den Bigge-Stausee
Impressionen vom Bigge-Stausee 1. Der Bigge-Stausee (nach http://de.wikipedia.org/wiki/Biggesee) Der Biggesee liegt im Südteil des Sauerlands zwischen den Städten Attendorn im Norden und Olpe im Süden. Er erstreckt sich etwa im Zentrum des Naturparks Ebbegebirge. Durchflossen wird der Stausee vom Lenne-Zufluss Bigge und unter anderem von Bieke, Brachtpe, Bremgebach, Dumicke und Lister gespeist. An der Lister erstreckt sich westlich direkt an den Biggesee angrenzend auf dem Gebiet der Städte Drolshagen (Kreis Olpe) und Meinerzhagen (Märkischer Kreis) die ehemals selbstständige Listertalsperre. Im Biggesee befindet sich die etwa 34 ha große Gilberginsel, die zusammen mit der benachbarten Uferregion ein Naturschutzgebiet bildet. Vor allem dient der Biggesee der Speicherung von Rohwasser für das Ruhrgebiet, um eine gleichmäßige Wassermenge in der Ruhr sicherzustellen. Aus dem Stausee können über Bigge und Lenne bis zu 40 % des erforderlichen Zuschusswassers aller Talsperren im Flusssystem der Ruhr abgegeben werden. Weiterhin ist eine wichtige Aufgabe der Hochwasserschutz. In der hochwassergefährderten Zeit vom 1. November bis zum 1. Februar wird ein Hochwasserschutzraum von 32 Mio. m³ freigehalten; dieser wird in der Zeit vom 1. Februar bis zum 1. Mai für den Aufstau freigegeben. Daneben erzeugt ein Wasserkraftwerk ca. 22 Mio. kWh Strom im Jahr. Die Ausbauleistung der drei großen und einer kleinen Francis-Turbine beträgt 15,6 MW. Die Wasserentnahme aus dem Stausee erfolgt vorzugsweise über das Kraftwerk. Betreiber der Talsperre ist der Ruhrverband. Mit der benachbarten Listertalsperre bildet der Biggestausee ein großes Talsperrensystem. 1956 verabschiedete der Landtag von Nordrhein-Westfalen ein Gesetz für die Finanzierung der Biggetalsperre. Am 1. August 1956 trat das Biggetalsperrengesetz in Kraft.