Titelseite 1-2 2010.Pmd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Swedish Interests in Times of European Change
Swedish interests in times of European change Speach by Ulf Kristersson, Europahuset, 16th of May 2018 The spoken word applies Ulf Kristersson, Europahuset, 16th of May 2018 First of all, I would like to extend my warmest thanks to Katarina Areskough Mascarenhas for giving me the opportunity to come and say a few words about the development and future of European cooperation, what it means for Sweden, and the role I see our country playing within the EU. *** On the 31st of August 1961 Prime Minister Harold Macmillan announced in the United Kingdom’s House of Commons that the UK would apply for membership of the European Economic Community, or the EEC, the predecessor of the modern EU. History – or rather Charles de Gaulle – stood in Macmillan’s way, however, and it would take the UK more than a decade to finally gain membership. The process saw several vetoes from the French President, and eventually his resignation and death, before the UK became a member. Some things have not changed; every time the UK moves to change its relationship with Europe, its actions have an affect on everyone else, including Sweden. It is the same story repeating itself. Within a few weeks, Sweden’s relationship with the EEC would also be determined in a way that would have a significant impact on the European politics debate in Sweden for the next thirty years. The business community, the Liberal People’s Party, and not least my own party pushed for membership. In the 1962 elections, my predecessor Gunnar Hecksher appeared on election posters bearing the message ‘Yes to Europe – for freedom and security’. -

Affärsängel Med Fingertoppskänsla För Bra Teknikidéer
Så hoppas Sverige Sveriges lägga beslag på smartaste EU-myndighet 22 industri 5 IVAAKTUELLT NR 1 2017. GRUNDAD 1930 JANE WALERUD Affärsängel med fingertoppskänsla för bra teknikidéer Asea-robot långkörare i Genarp Första kvinnan som blev professor i Sverige IVA Opinion Digitaliseringens vardagsutmaningar igitalisering är vår tids stora tade uttrycket ”cash is king”. förändringskraft. I vardagen blir Självklart är det här ingen katastrof av vi ständigt påminda om hur den episka mått. Men det är irriterande att påverkar i stort och smått, på varken jag eller stormarknaden har en fung- jobb och fritid. Näringsliv och erande backup. Och min kundupplevelse av Dmyndigheter blir effektivare, våra sociala liv det som brukar kallas ”fintech” blir negativ. förändras och vår vardag enklare. Det finns runt 5 miljoner privata användare Smarta mobiler gör det lättare att skicka av Swish i dag. Men företagslösningar för pengar, hitta vägen, jämföra priser, boka butiker är än så länge bara på provstadiet. resor och hotell, konsumera media, spåra Samtidigt vill inte bankerna hantera borttappade mobiler, kolla tv-serier och kontanter och det blir allt längre mellan styra värmen i fritidshuset. Det mesta har bankomaterna. Särskilt i glesbygd. Att gå blivit lite bättre. Så länge allt fungerar. omkring med en bunt sedlar i plånboken Det är när tekniken slutar fungera som betraktas närmast som suspekt. vi plötsligt inser hur irriterande beroende Att it-system går ner och inte har hund- vi blivit av digitaliseringens positiva sidor. ra procents tillgänglighet är något vi lärt Det räcker med att den trådlösa routern oss att acceptera. Att samhällsfunktioner hemma går ner så drabbas familjen av blir allt mer beroende av dessa medför att kollektiv panik. -

Agents in Brussels
THOMAS LARUE AGENTS IN BRUSSELS DELEGATION AND DEMOCRACY IN THE EUROPEAN UNION DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE UMEÅ UNIVERSITY Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2006:01 ISSN 0349-0831 ISBN 91-7264-058-8 © Thomas Larue Tryck: Print & Media, Umeå universitet, 2006:2001780 Abstract: This dissertation explores delegation and democracy within the European Union (EU). The EU now constitutes one of the cornerstones of the democratic systems of its member states. The most vital instrument of democracy is lawmaking, which increasingly occurs at the European level. Many different actors contribute to the shaping of EU legisla- tion. Among the most important of these are national bureaucrats representing their mem- ber states in Council negotiations. This thesis focuses on these bureaucrats. In particular it analyzes the delegation and accountability relationship between member states’ govern- ments and their national bureaucrats stationed at the permanent representations (PRs) in Brussels. It is based on semi-structured elite interviews with 80 French and Swedish senior civil servants in Brussels, Paris and Stockholm. Using an explorative and descriptive comparative case study of two EU member states, France and Sweden, the dissertation seeks to describe and analyse how delegation between member states’ capitals and Brussels are affected by: i) the coordination and preparation of EU issues in member states’ government offices, ii) the organisation and functioning of the permanent representations, and, most importantly, iii) existing accountability mechanisms. Applying a principal-agent approach, this study shows that the delegation between govern- ments and their Brussels-based bureaucrats is adequate, despite relatively weak delegation and accountability designs. The study identifies institutional divergence between France and Sweden as regards the design of national systems of EU delegation, particularly moni- toring and reporting requirements, where Sweden seems to have a more developed system. -
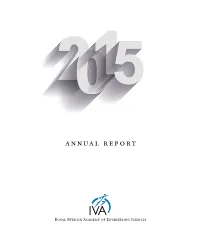
ANNUAL Report
Annual report TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO TEODOR AASTRUP KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR CHRISTOPHER AHLBERG INGA-BRITT AHLENIUS LENNART AHLGREN GÖRAN AHLSTRÖM KRISTER AHLSTRÖM KRISTINA AHLSTRÖM ESKO AHO MATTI ALAHUHTA HORST ALBACH ANN-CHRISTINE ALBERTSSON PER-ÅKE ALBERTSSON EVA-LENA ALBIHN MARCUS ALDÉN UNO ALFREDEEN HENRIK ALFREDSSON BERT ALLARD THOMAS ALLARD STURE ALLÉN GUNNAR ALMGREN ANDREAS ALSÉN KRISTINA ALSÉR OLLE ALSHOLM LEO ALTING JAVIER ALVAREZ VARA JOHNNY ALVARSSON LOUIS AMÉEN JOAKIM AMORIM PIA ANDERBERG ARNE ANDERSSON BENGT ANDERSSON BERTIL ANDERSSON BJÖRN ANDERSSON BRITT-INGER ANDERSSON CURT ANDERSSON EVERT ANDERSSON GÖRAN ANDERSSON INGER ANDERSSON INGVAR ANDERSSON JOHAN ANDERSSON LARS ANDERSSON MATS ANDERSSON MATS ANDERSSON PATRIK ANDERSSON ROLAND ANDERSSON ROLF ANDERSSON RUNE ANDERSSON SIV ANDERSSON SVEN-ERIK ANDERSSON SÖREN ANDERSSON THOMAS ANDERSSON TOMAS ANDERSSON ÅKE E ANDERSSON ROBERT ANDREEN PETER ANDREKSON CARL-GUSTAF ANDRÉN SVEN G ANDRÉN INGEGERD ANNERGREN KARIN ANNERWALL PARÖ MARKUS ANTONIETTI ULLA ANTONSSON JEANETTE ANTTILA MARIA ANVRET MASAHIKO AOKI KARIN APELMAN GUNILLA ARHÉN ANTTI ARJAS JOHN ARMSTRONG CHRISTEL ARMSTRONG-DARVIK SIGNHILD ARNEGÅRD-HANSEN ROAR ARNTZEN BERTIL ARONSSON LARS AROSENIUS FREDRIK ARP GÖRAN ARVIDSSON OLOF ARWIDI MICHAEL ASHBY LEIF ASP OLA ASPLUND PETER AUGUSTSSON JÖRGEN AXELSSON ANNA AXELSSON WÅLLBERG SVEN AXSÄTER ROLF BACK LARS BACKSELL SIGVARD BAHRKE CLAES BANKVALL DEAN BANNON SERGIO -

3 Hotet Från Öst
3 Hotet från öst 3.1 Sovjetunionen och Norden För Sovjetunionen var Norden vid slutet av 1960-talet inte något prioriterat område. Mot bakgrund bl.a. av de spända relationerna till Kina var en förbättring av relationerna till väst, och särskilt fortsatt avspänning gentemot den andra supermakten, de viktigaste prioriteterna för den sovjetiska utrikespolitiken. På den europeiska scenen var det för Moskva av vikt att få principen om status quo efter andra världskriget befäst, och att få till stånd en europeisk säkerhetskonferens för detta ändamål. Vägen dit låg via de stora fördragsverken rörande Tyskland och Centraleuropa, och Norden låg i detta perspektiv vid sidan av. 3.1.1 Allmänt Den ökade militära betydelse som Nordområdena (med Nordområdena menas här norra Norge, Sverige och Finland, och angränsande havsområden i Norska havet och Barents hav), senare under 1970-talet skulle komma att få hade ännu vid slutet av 1960- talet inte börjat göra sig gällande. Norden var ”den glömda flanken”. Moskvas intresse vid denna tid var av allt att döma att bevara Norden som ett lågspänningsområde. Sällan gjorde sovjet- ledningen uttalanden om Norden eller frågor som rörde de nordiska länderna, och i den sovjetiska pressen var ämnet vid denna tid sparsamt förekommande. Det ansågs dock i det sovjetiska utrikesministeriet att en ”aktivisering” av Nato i de nordliga med- lemsländerna Danmark och Norge pågick.1 Genom sin geografiska position var det ofrånkomligt att Norden drogs in i den globala öst-västkonfrontationen, och även om området inte låg i centrum för supermakternas intresse är det i 1 Promemoria 1970-06-10, Skandinaviska avdelningen vid det sovjetiska utrikesministeriet. -

Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Com pany 300 North Zeeb Road. Ann Arbor. Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Reproduced with with permission permission of the of copyright the copyright owner. -

Nya Antagningsregler Till Högskolan För IB-Elever Utlandsföräldrar Vill Ha
FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 1 ÅR 2017 Nya antagningsregler till högskolan för IB-elever Utlandsföräldrar vill ha mer stöd för svenskundervisning Ändrade regler vid förnyelse av körkort NUMMER 1, 2017 TIDNINGEN SVENSKAR I VÄRLDEN ANSVARIG UTGIVARE Karin Ehnbom–Palmquist CHEFREDAKTÖR Ellika Nyqvist Livchitz [email protected] LAYOUT Ellika Nyqvist Livchitz 11 ENLIGT RESULTATEN AV SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄT TILL UTLANDSSVENSKA FÖRÄLDRAR ÄR MÅNGA KRITISKA TILL HÖGSKOLANS NYA ANTAGNINGSREGLER FÖR IB-ELEVER. ANNONSER FOTO: SUSANNE WAHLSTRÖM, IMAGEBANK SWEDEN UH Marketing AB +46 (0)8–732 48 50 [email protected] DIGITAL PRENUMERATION ÄR GRATIS. ORGANISATIONEN SVENSKAR I VÄRLDEN – UNDER KUNGLIGT BESKYDD 9 EN SVENSK GENERALSEKRETERARE KLASSIKER SPRIDER SIG Karin Ehnbom-Palmquist ÖVER VÄRLDEN. STYRELSE 8 VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM BOR UTOM- Tuve Johannesson, ordf. LANDS PERMANENT OCH HAR SVENSKT KÖRKORT Lennart Koskinen, vice ordf. Karin Ehnbom-Palmquist, gen.sekr - NYA REGLER ÄR PÅ GÅNG. Anna Belfrage Claes-Johan Geijer Gunnar Gillberg Kai Hammerich David Höjenberg Birgitta Laurent Åsa Lena Lööf Barbro Sachs–Osher Annika Rembe Lisa Emelia Svensson Jonas Hafström Ibbe Gnem 3 GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET. Claudia Olsson Anders Söderström 4 SOCIALFÖRSÄKRINGAR VID UTLANDSVISTELSE OCH HEMFLYTT. Kristin Öster 5 NYA ANTAGNINGSREGLER TILL HÖGSKOLAN FÖR IB-ELEVER. MEDLEMSAVGIFTER Enskild och Familj 500 kr EMINARIESERIE OM UTLANDSSTUDIER Kampanjpris Ny Medlem 400 kr 6 S . Studerande 0 kr Ständig medlem 10 000 kr 7 MAJBLOMMAN FYLLER 110 ÅR. BETALNINGSINFO 8 ÄNDRADE REGLER VID FÖRNYELSE AV KÖRKORT. PLUSGIRO: 504–1 BANKGIRO: 732–0542 9 EN SVENSK KLASSIKER SPRIDER SIG GLOBALT. IBAN: SE 74 5000 0000 0521 3100 1002 SWIFT: ESSESESS 11 UTLANDSSVENSKA FÖRÄLDRAR EFTERLYSER ÖKAT STATLIGT STÖD FÖR SVENSKUNDERVISNING UTOMLANDS. -
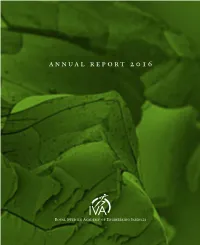
ANNUAL Report 2016
Annual report 2016 TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR CHRISTOPHER AHLBERG INGA-BRITT AHLENIUS LENNART AHLGREN GÖRAN AHLSTRÖM KRISTER AHLSTRÖM ESKO AHO MATTI ALAHUHTA HORST ALBACH ANN-CHRISTINE ALBERTSSON PER-ÅKE ALBERTSSON MARCUS ALDÉN UNO ALFREDEEN HENRIK ALFREDSSON BERT ALLARD THOMAS ALLARD STURE ALLÉN GUNNAR ALMGREN KRISTINA ALSÉR OLLE ALSHOLM LEO ALTING JAVIER ALVAREZ VARA JOHNNY ALVARSSON LOUIS AMÉEN ARNE ANDERSSON BENGT ANDERSSON BERTIL ANDERSSON BRITT-INGER ANDERSSON CURT ANDERSSON EVERT ANDERSSON GÖRAN ANDERSSON INGER ANDERSSON INGVAR ANDERSSON LARS ANDERSSON MATS ANDERSSON ROLAND ANDERSSON ROLF ANDERSSON RUNE ANDERSSON SIV ANDERSSON SVEN-ERIK ANDERSSON SÖREN ANDERSSON THOMAS ANDERSSON TOMAS ANDERSSON ÅKE E ANDERSSON PETER ANDREKSON CARL-GUSTAF ANDRÉN INGEGERD ANNERGREN KARIN ANNERWALL PARÖ MARKUS ANTONIETTI ULLA ANTONSSON MARIA ANVRET MASAHIKO AOKI ANTTI ARJAS JOHN ARMSTRONG CHRISTEL ARMSTRONG-DARVIK ROAR ARNTZEN BERTIL ARONSSON LARS AROSENIUS FREDRIK ARP OLOF ARWIDI MICHAEL ASHBY LEIF ASP OLA ASPLUND PETER AUGUSTSSON ANTONIA AX:SON JOHNSON SVEN AXSÄTER ROLF BACK LARS BACKSELL SIGVARD BAHRKE CLAES BANKVALL SERGIO BARABASCHI JOHN S BARAS FRITZ BARK PERCY BARNEVIK MICHEL W. BARSOUM CLAES-GÖRAN BECKEMAN MONICA BELLGRAN CHARLOTTE BENGTSSON EWERT BENGTSSON NILS BENGTSSON ARNE BENNBORN MATS BENNER CARL BENNET BENGT BERG LARS BERG MARTIN BERGDAHL SVEN-GUNNAR BERGDAHL BO BERGGREN THOMAS BERGLIN LARS BERGLUND -

Vi Minns Radio Sweden the Stockholm Recommendations TIPS FÖR SVIV Samordnar Unikt DIN HÄLSA, Europasamarbete EKONOMI & Skatte Fr - Ågor!
FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 Vi minns Radio Sweden The Stockholm Recommendations TIPS FÖR SVIV samordnar unikt DIN HÄLSA, europasamarbete EKONOMI & skatte fr - ÅGor! Årets svensk i världen 2009: NUMMER 02 ÅR 2009 I WWW.SVIV.SE SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA Gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9. Utbildning på svenska eller engelska. IB-program sedan 25 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter. Nära kontakter med högskolor och näringsliv. SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET Telefon: +46 8 592 571 00 www.sshl.se Svenskar i världen 2009-01-13 (170x240).indd 1 2009-01-13 13.25 INNEHÅLL TIDNINGEN SVENSKAR SVENSKAR I VÄRLDEN I NUMMER 02 ÅR 2009 >> I VÄRLDEN AnsvArig utgivAre Karin Ehnbom-Palmquist redAktör Andreas Hermansson [email protected] Art director Fredrik Bengtsson Annonser UH Marketing AB Urban Hedborg, Box 128, 183 22 Täby telefon 08-732 48 50, Fax 08-732 69 46 e-post [email protected] Webbplats www.uhmarketing.se Prenumerationer 4 nummer per år kostar 500 kronor 4. Generalsekreteraren har ordet 29. Medlemsförmåner tryckeri Axel Abrahamsons Tryckeri Nyheter Böcker & Förlag AB 6. 30. telefon 0455-339700 Ulf Dinkelspiel har skrivit Den motvillige www.abrahamsons.se, Karlskrona 16. GÖRAN LÖWING europén, en bok som beskriver Sveriges Kidnappningsdraman, kalla krig och mödosamma väg in i EU. FÖRENINGEN SVENSKAR midsommarfiranden. Radio Sweden fanns I VÄRLDEN där för utlandssvenskar i ur och skur. 34. Ombud – SVIV:are i världen generAlsekreterAre Radiomannen Göran Löwing minns tillbaka. Karin Ehnbom-Palmquist 20. The STockhoLm meeTING styrelse Tillsammans är vi starka. Så kan den konfe- Ulf Dinkelspiel, ordf. rens SVIV stod som värd för sammanfattas. -

Jakob Gustavsson the POLITICS of FOREIGN POLICY CHANGE
Jakob Gustavsson Lund Political Studies 105 THE POLITICS OF FOREIGN POLICY CHANGE EXPLAINING THE SWEDISH REORIENTATION ON EC MEMBERSHIP THE POLITICS OF FOREIGN POLICY CHANGE Explaining the Swedish Reorientation on EC Membership THE POLITICS OF FOREIGN POLICY CHANGE The 1990s has been characterized by profound changes in world affairs. While numerous states have chosen to redirect their foreign policy orientations, political scientists have been slow to study how such processes take place. Drawing on the limited earlier research that does exist in this field, this study presents an alternative explanatory model of foreign policy change, arguing that a new policy is adopted when changes in fundamental structural conditions coincide with strategic political agency, and a crisis of some kind. The model is applied to the Swedish government’s decision in October 1990 to restructure its relationship to the West European integra- tion process and advocate an application for EC membership. As such it constitutes the first in-depth study of what is perhaps the most important political decision in Swedish postwar history. The author provides a thorough examination of the prevailing political and economic conditions, as well as an insightful analysis of the government’s internal decision-making process, emphasizing in particular the strategic behavior of Prime Minister Ingvar Carlsson. Lund University Press Chartwell-Bratt Ltd Jakob Box 141, SE-221 00 Lund, Sweden Old Orchard, Bickley Road, Gustavsson Art. nr. Bromley, Kent BR1 2NE ISSN England ISBN -

Sweden and Poland Entering the EU
Sweden and Poland Entering the EU Comparative Patterns of Adaptive Organization and Cognition Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2005:2 ISSN 0349-0831 ISBN 91-7305-893-9 © Niklas Eklund Tryck: Print & Media, Umeå universitet, 2005:2000889 Sweden and Poland Entering the EU Comparative Patterns of Adaptive Organization and Cognition Niklas Eklund Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet 2005 Sweden and Poland Entering the EU Comparative Patterns of Organization and Cognition. Niklas Eklund, Department of Political Science, Umeå University, SE-901 87, Umeå, Sweden. ISBN 91-7305-893-9 ISSN 0349-0831 Distribution: Department of Political Science, Umeå University, SE-901 87 Umeå, Sweden. Abstract This thesis is a comparative study of how elites in Sweden and Poland approach and make sense of EU membership. It begins with the observation that the public debates in several EU member countries are becoming increasingly politicized around a dichotomy, i.e. enthusiasm and skepticism vis-à-vis European integration. Whereas a lot of research in this field covers the characteristics of the European integration process itself, fewer studies focus upon the cognitive complexity involved in national strategic policy choices. The aim of this thesis is to explore, compare and contrast the organizational and cognitive aspects of how Sweden and Poland entered the EU and thereby to contribute to an understanding of how national policymakers in Europe believe that national and supranational integration can work together. The theoretical point of departure is Stein Rokkan’s model of political integration, which emphasizes the importance of functional and territorial political cleavages in the development of modern European nation states. -
Sveriges Televisions Public Service-Redovisning 2003
Sveriges Televisions public service-redovisning 2003 S VERIGES T ELEVISIONS PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2003 SID 2 Sveriges Television AB 2004 Kontakt: SVT:s Programsekretariat, 10510 Stockholm eller e-post [email protected] S VERIGES T ELEVISIONS PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2003 SID 3 Kulturdepartementet, Medieenheten Granskningsnämnden för radio och TV Stockholm 2004-02-27 Sveriges Televisions public service-redovisning 2003 Härmed överlämnas Sveriges Televisions public service-redovisning för år 2003. Redovisningens huvudsakliga innehåll har fastställts av företagets styrelse. Redovisningen kommer i likhet med tidigare år att under mars månad göras tillgänglig för allmänheten på Sveriges Televisions webbplats www.svt.se. Därtill kommer materialet att användas i olika former i SVT:s informations- och kontaktverksamhet med allmänheten. Viktiga delar av redovisningen återges i handlingarna till ägarstiftelsen m.fl. i samband med företagets bolagsstämma. Sveriges Television vill med dessa olika former för information ge ökade möjligheter till granskning och bred debatt om public service-televisionen. Sveriges Television AB Christina Jutterström Leif Jakobsson verkställande direktör programdirektör S VERIGES T ELEVISIONS PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2003 SID 4 Avsnitt och innehåll 1 Inledning och sammanfattning 2 Public service-redovisningen 3 Tillståndsvillkoren och redovisningen 4 Sveriges Television AB 4.1 Organisation 4.2 Konkurrens 4.3 Produktion m.m. 5 Programkanaler och tjänster 5.1 Rikssänt utbud i SVT1 och SVT2 5.2 Rikssänt utbud i Barnkanalen,