Gewässerbericht 2003 (PDF
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Glems Mühlen
Die Mü hlen entlang der Glems Naturraum „Glemstal“ Ditzingen Hemmingen Die verkehrsgünstige Lage mit Der Ort war als kleines Strohgäu- 1. Lahrensmü hle. Der Mühlenbetrieb wurde Der Glemswald bei Stuttgart ist das Quellgebiet der dorf bis in die 60er Jahre hinein Erleben und entdecken Sie die reizvolle und S-Bahn- und Autobahnanschluss 1957 eingestellt. Heute wird das historische Mühlen- Glems. Nach einem Lauf von 48 km durch Keuper stark landwirtschaftlich geprägt. sowie die unmittelbare Nähe zur gebäude für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Im und Muschelkalk mündet die Glems bei Unterrie- Erst die danach einsetzende Landeshauptstadt Stuttgart haben sprunghafte Entwicklung verän- abwechslungsreiche Natur und Landschaft Wohnhaus befindet sich ein Mühlenladen. Infos am xingen in die Enz. Das Glemstal bietet durch seine Ditzingen mit seinen Stadtteilen derte den Ort grundlegend und Schaukasten und unter www.Lahrensmuehle.de reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft ideale Schloss Hemmingen Dreigiebelhaus Ditzingen Heimerdingen Hirschlanden und gab ihm seine heutige unver- des Glemstals. Unterwegs treffen Sie auf stille 2. Clausenmü hle. Das Mühlengebäude ist Voraussetzungen als Naherholungsgebiet. Gut er- Schöckingen zu einem bevorzugten Wohn- und Indu- wechselbare Skyline. Namhafte Gewerbebetriebe 1971 völlig abgebrannt. An der Stelle wurde ein Wohn- schlossene Wander- und Radwege laden ein, die siedelten sich an. Im Ortskern bilden die Varnbüh- striegebiet werden lassen. Die vorbildlich sanierten Wälder, beeindruckende Felsformationen, saf- haus gebaut. Ein Hofladen ist vorhanden. Natur und Landschaft des Glemstals zu erkunden lerische Schlossanlage mit ihrem herrlichen eng- Ortskerne der Stadtteile Heimerdingen und Schöckin- 3. Felsensä gmü hle. Die Sägmühle war bis und kennenzulernen. Durch seine Ursprünglichkeit lischen Landschaftsgarten, die Laurentiuskirche mit Unterwegs auf dem gen vermitteln ein lebendiges Bild der dörflichen Ver- dem Renaissance-Portikus und schmucke Fachwerk- tige Streuobstwiesen und vor allem auf 1994 in Betrieb. -
E-Bike-Region Stuttgart
Radfahren neu erleben E-Bike-Region Stuttgart Radellust rund um die Schwabenmetropole Vom Naturpark Schönbuch und dem Heckengäu zum Biosphä- rengebiet Schwäbische Alb, vom Albtrauf in die Daimlerstadt Schorndorf, dann entlang des Welterbe Limes durch den E-BIKE-REGION Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald in die Schillerstadt STUTTGART Marbach oder in die Weinbauregionen Neckar und Remstal: STUTTGART2017 Mit Wadenkraft und Stromantrieb lässt sich die abwechs- lungsreiche Landschaft rund um Stuttgart wundervoll erfahren. Die Strecke wurde speziell für die besonderen Ansprüche von Elektroradfahrern entwickelt, eignet sich aber auch für geübte Radfahrer mit Muskelkraftantrieb. Die Route ist gut mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar, so dass sich auch Halbta- ges- oder Tagestouren gut planen lassen. Entsprechende Tourentipps finden Sie in dieser Broschüre oder im Internet unter www.e-bike-region-stuttgart.de. Entlang der Route finden sich auch schöne Übernachtungsmög- lichkeiten, unter anderem in zertifizierten Bett & Bike-Betrieben. Eine regional geprägte, fahrradfreundliche Gastronomie lädt www.e-bike-region-stuttgart.de zum Rasten ein. Wer möchte, kann an einer der vielen Verleih- stationen ein Pedelec mieten und auf diese Weise einfach mal das Fahren mit einem Elektrorad ausprobieren. Oder, noch einfacher: Testen Sie das Stromradfahren bei einer geführten Radtour. Diese wird regionsweit zu den unterschied- lichsten Themen angeboten, z.B. „RadCUISINE“, „An Rems und Neckar“, „Natur am Albtrauf“, „Geschichte und Kultur entlang des Welterbe -
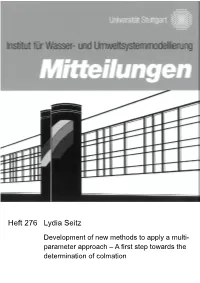
2020 Diss Seitz
Heft 276 Lydia Seitz Development of new methods to apply a multi- parameter approach – A first step towards the determination of colmation Development of new methods to apply a multi-parameter approach – A first step towards the determination of colmation von der Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) genehmigte Abhandlung vorgelegt von Lydia Seitz aus St. Georgen, Deutschland Hauptberichter: Prof. Dr.-Ing. Silke Wieprecht Mitberichter: Prof. Dr.-Ing. Holger Steeb Tag der mündlichen Prüfung: 29.07.2020 Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung der Universität Stuttgart 2020 Heft 276 Development of new methods to apply a multi-parameter approach – A first step towards the determination of colmation von Dr.-Ing. Lydia Seitz Eigenverlag des Instituts für Wasser- und Umweltsystemmodellierung der Universität Stuttgart D93 Development of new methods to apply a multi-parameter approach – A first step towards the determination of colmation Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar Seitz, Lydia: Development of new methods to apply a multi-parameter approach – A first step towards the determination of colmation, Universität Stuttgart. - Stuttgart: Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, 2020 (Mitteilungen Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, -

Enbw Report 2013: “Assumes”, “Forecasts”, “Potentially” E-Mail: [email protected] 7 March 2014 Or “Continued” and Similar Expressions
Report 2013 › Energiewende. Safe. Hands on. 201320 Condensed version Report 2013 › Energiewende. Safe. Hands on. 2020 Condensed version Goal system 2013 » 2014 – 2016 » 2020 Finance Goal dimension Financial performance Report on risks Expected trend in finance indicators and opportunities financial performance indicators p. 46 et seq. p. 66 et seqq. p. 102 et seqq. p. 118 et seq. Customers Goal dimension Non-financial perfor- Report on risks Expected trend in customers mance indicators and opportunities the customers area p. 47 et seq. p. 84 p. 106 et seq. p. 119et seq. Employees Goal dimension Non-financial perfor- Report on risks Expected trend in employees mance indicators and opportunities the employees area p. 48 et seq. p. 84 et seqq. p. 104 et seq. p. 120 Compliance Goal dimension Non-financial perfor- Report on risks Expected trend in compliance mance indicators and opportunities the compliance area p. 49 p. 88 et seqq. p. 106 p. 121 Ecology Goal dimension Non-financial perfor- Report on risks Expected trend in ecology mance indicators and opportunities the ecology area p. 49 et seq. p. 90 et seqq. p. 103 p. 121 Our segments Segment 51.1 billion KWh of electricity Sales1 sales (B2C/B2B) Tasks: advisory service; sale of electricity, gas and other prod- 67.7 billion KWh of gas ucts; providing of energy-related services; “Sustainable City” sales (B2C/B2B) project development; support for local authorities, including signing of franchises; collaboration with public utilities 227.1 € million adjusted EBITDA Segment 67.9 TWh of electricity -

Entlang Der Glems Samstag 23
Rückblicke auf Wanderungen und Veranstaltungen Entlang der Glems Samstag 23. März 2019 mit Erika und Walter Nogger Schwieberdingen – Stumpenmühle – Nippenburg – Sägmühle - Glemsmühle – Talmühle – Schlossmühle - Ditzingen Herrlichstes Frühlingswetter lockte die große Schar von 28 Wanderern an. Wir fuhren mit Bus, S-Bahn und der Strohgäubahn bis zum Bahnhof Schwieberdingen, wo unsere Wanderung auf dem Glems-Mühlen-Weg begann. Die Glems entspringt im Rotwildpark/Glemswald auf Stuttgarter Markung und mündet nach 47 km bei Unterriexingen in die Enz. Zahlreiche Mühlen speiste sie mit ihrem Wasser. An 5 Mühlen kamen wir vorbei. Auf Info-Tafeln wird über die Geschichte der Mühlen informiert, zwei sind noch als Mahlmühlen in Betrieb und eine als Sägemühle (heutzutage natürlich ohne Wasserkraft). 2019-03-23_R Glemstalwanderung von Schwieberdingen nach Ditzingen.pdf Wandergruppe mit 28 Personen (davon 6 Gäste), und dazu 1 Hund an der Burgruine Nippenburg Besonders schön und interessant auf unserem Weg war die Burgruine Nippenburg. Sie wurde 1160 erstmals urkundlich erwähnt und wechselte mehrmals den Besitzer. Seit 1685 ist Burg und zugehöriges Hofgut im Besitz der heute noch hier lebenden Grafen Leutrum von Ertingen. Die verbliebenen Mauern der Ruine wurden in den Jahren 1979 bis 1984 gesichert und restauriert. Wir ließen uns Zeit für einen Rundgang und Vesperpause. Etwas abenteuerlich war der Abstieg durch den Wald ins Tal, da der markierte Wanderweg nach Baumarbeiten noch nicht ganz freigeräumt war. Für unsere geübten Mitwanderer nur etwas Gymnastik! Der weitere Weg durchs Glemstal war sehr bequem, größtenteils in der Sonne. In Ditzingen kamen wir vorbei am Ditzinger Schloss, gingen hinauf zur Konstanzer Kirche, betrachteten die wenigen noch erhaltenen Fachwerkhäuser und kehrten zum Abschluss zünftig ein. -

50M Freistil Weiblich
Protokoll Seite: 1 Bezirkscup des Bezirks Mittlerer Neckar 27.01.2020 10:20 SVW - Bezirk Mittlerer Neckar Wasserfreunde Mühlacker 1920 e.V. Wettkampf 14 - 50m Freistil weiblich Pflichtzeiten 2010: 00:44,00 2009: 00:40,00 2008: 00:38,00 2007: 00:37,00 2006: 00:36,00 2005: 00:34,50 2004: 00:33,50 2003: 00:33,50 2001 bis 2002: 00:32,50 Jahrgang 2012 Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit 1. und Bezirksmeisterin Rieke Blümel 2012 SG Glems 00:48,11 2. Livia Macan 2012 TSV Ludwigsburg 00:48,35 3. Lia Berner 2012 Wfr. Leonberg 00:50,40 4. Zoé Stoll 2012 SSG Filder-Neckar-Teck 00:51,11 5. Maximiliane Berkenkopf 2012 Wfr. Leonberg 00:53,32 6. Iva Fey Krämer 2012 SV Böblingen 00:57,60 7. Sophie Lampe 2012 SG Glems 00:58,15 8. Sophie Strauß 2012 TSV Ludwigsburg 00:58,26 9. Paula Wagner 2012 Wfr. Leonberg 01:01,44 nicht am Start Freya Sokotra Schwarz 2012 Wasserfreunde Mühlacker 1920 abgemeldet Malin Becker 2012 SG Glems Jahrgang 2011 Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit 1. und Bezirksmeisterin Annika Niklasch 2011 VfL Sindelfingen 00:40,53 2. Leah März 2011 Wasserfreunde Mühlacker 1920 00:43,27 3. Leni Kreutel 2011 Wasserfreunde Mühlacker 1920 00:43,40 4. Livia Marie Teifke 2011 Wasserfreunde Mühlacker 1920 00:44,25 5. Annie Schumacher 2011 SV Cannstatt 00:45,76 6. Beyda Nur Bader 2011 SV Böblingen 00:46,41 7. Clara Richard-Kömen 2011 TSV Bernhausen 00:48,34 8. Cecilia Jiaen Ma 2011 Wfr. Leonberg 00:49,63 9. -

Landtag Von Baden-Württemberg Kleine Anfrage Antwort
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 12 / 3751 12. Wahlperiode 15. 02. 99 Kleine Anfrage des Abg. Roland Schmid CDU und Antwort des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Gewässersanierung und Uferrenaturierung Kleine Anfrage Ich frage die Landesregierung: 1. Wie oft wurde die Zustimmung der Gewässerdirektionen zu Gewässersa- nierungsmaßnahmen in den letzten fünf Jahren erteilt bzw. verweigert und aus welchen Gründen bzw. mit welcher Art von Auflagen geschah dies? 2. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten zur Vereinfachung des Zustim- mungsverfahrens oder gar zu einem Verzicht? 3. Unter welchen Voraussetzungen können Mittel aus dem KUF-Programm unter dem Titel Flussausbau auch für die Uferrenaturierung eingesetzt werden, und besteht gegebenenfalls die Bereitschaft, die Voraussetzungen dafür zu schaffen? 4. Werden die Sanierungen von Uferwegen über das Landesradwegepro- gramm gefördert oder besteht die Möglichkeit hierzu? 5. Gibt es auch in dicht besiedelten Gebieten des Landes, insbesondere im Großraum Stuttgart, Überlegungen und Konzepte zum Erhalt und zur Ent- wicklung naturnaher Gewässer? 11. 02. 99 Roland Schmid CDU Begründung Seit dem 1. Januar 1996 liegt dem Wassergesetz ein erweiterter Gewässer- schutzgedanke zugrunde. Danach wird nicht mehr nur der Schutz des Wassers Eingegangen: 15. 02. 99 / Ausgegeben: 22. 04. 99 1 Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 12 / 3751 als Stoff vorausgesetzt, sondern auch das Gewässerumfeld einschließlich der Gewässerrandbereiche in den Gewässerschutzgedanken einbezogen. Leitbild ist ein möglichst naturnaher Gewässerzustand im Sinne eines intakten biolo- gischen Systems. Dies ist nicht nur im Hinblick auf ökologische Aspekte von Belang; ein naturnaher Gewässerzustand dient vielmehr auch den klassi- schen wasserwirtschaftlichen Anliegen der Sicherstellung eines geordneten Wasserhaushalts, einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und des Hochwasserschutzes. Das Wassergesetz sieht hierfür u. -
Regionale Qualität. Einkaufen Und Genießen Direkt Ab Hof
Regionale Qualität. Einkaufen und genießen direkt ab Hof. Direktvermarkter-Broschüre Landkreis Ludwigsburg 1508_AZ_Girokonto_105x210_4c_RZ_105x210 21.10.15 12:58 Seite 1 www.ksklb.de/girokonto Unsere Girokonten – so individuell wie eine Familie s Kreissparkasse Ludwigsburg Mit einem Girokonto bei der Kreissparkasse Ludwigsburg haben Sie einen leistungsstarken Partner rund um die alltäglichen Dinge des Bankge- schäfts – ein faires Preis-Leistungsverhältnis gehört in jedem Fall dazu. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse. Regionale Qualität. Einkaufen und genießen direkt ab Hof. Direktvermarkter-Broschüre Landkreis Ludwigsburg Inhalt 3 Grußworte 6 Der Landkreis Ludwigsburg stellt sich vor 6 Unsere Landwirtschaft 8 Tierhaltung - Was muht und mäht denn da? 9 Kulturlandschaft erhalten – gerade im Verdichtungsraum 10 Tafelobst im Kreis Ludwigsburg 11 Weinbau – oft steil und steinig, aber oho! 12 Gut essen – ein Leben lang! 13 Gut zu wissen, was man isst und trinkt... 14 Der Spätlingsmarkt im Ludwigsburger Kreishaus 15 Wichtige „Zeichen“ für gute Qualität 17 Was steht auf dem Ei und der Verpackung? 18 Unsere Wochenmärkte 20 Saisonkalender 24 Verzeichnis der Betriebe 85 Kreiskarte Impressum Herausgeber: Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Landwirtschaft, Auf dem Wasen 9, 71640 Ludwigsburg, Tel: 07141 – 144-4900 www.landkreis-ludwigsburg.de Auflage: 15 000 Stand November 2015; Änderungen und Irrtum vorbehalten 8 | Direktvermarkter-Broschüre Landkreis Ludwigsburg Grußwort Landrat Dr. Rainer Haas Liebe Leserinnen und Leser, die aktualisierte Broschüre der Direktver- markter im Landkreis Ludwigsburg zeigt es wieder ganz deutlich: Unsere Region hat viel Gutes zu bieten! Was zwischen Stromberg, Neckartal und Heckengäu wächst und gedeiht, kann sich sehen und mit allen Sinnen genießen lassen. Dafür sorgen unsere landwirtschaft- lichen Erzeuger und Direktvermarkter, die ihre hochwertigen Produkte in Hofläden und auf Wochenmärkten präsentieren. -
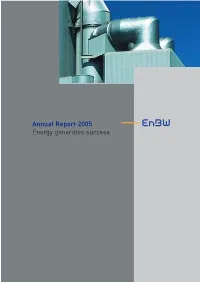
Enbw Annual Report 2005
Annual Report 2005 Energy generates success At a glance EnBW group1 2005 2004 Variance % External sales Electricity € millions 8,150.2 7,088.9 +15.0 Gas € millions 2,101.7 1,540.6 +36.4 Energy and environmental services € millions 517.4 494.8 +4.6 External sales, total € millions 10,769.3 9,124.3 +18.0 EBITDA € millions 2,054.3 2,044.5 +0.5 EBIT € millions 1,318.5 1,242.5 +6.1 Result of continuing operations € millions 522.5 357.7 +46.1 Earnings per share from continuing operations € 2.17 1.57 +38.2 Cash flow from operating activities € millions 1,329.9 1,545.7 -14.0 Free cash flow € millions 1,070.6 1,330.8 -19.6 Capital expenditures on intangible assets and property, plant and equipment € millions 547.0 417.7 +31.0 Return on Capital Employed (ROCE) % 13.4 11.7 +14.5 Cost of capital rate (WACC) before tax % 9.0 9.0 – Average capital employed € millions 9,353.7 9,400.8 -0.5 Value added € millions 407.5 251.9 +61.8 Energy sales of the EnBW group1 2005 2004 Variance % Electricity billions of kWh 106.7 100.9 +5.7 Gas billions of kWh 88.6 82.9 +6.9 Employees of the EnBW group1,2 2005 2004 Variance % Employees (annual average) 17,926 19,881 -9.8 1 The prior-year figures have been adjusted (see comments on the change in reporting in the notes). 2 Number of employees without apprentices/trainees and without inactive employees. -

Preisliste 2021 Nr
Preisliste 2021 Nr. 16 | Gültig ab 1. Januar 2021 Freitag, 27. September 2019 Politik sucht Die Pächter und Wächter der Glems Nachwuchs Ditzingen Vor rund 40 Jahren gegründet und stets rund 20 Mitglieder: Der Angelverein Ditzingen legt Wert darauf, dass der Fischbestand in Strohgäu Die Jugendgemeinde- Heidi Knobloch dem Fluss stabil bleibt. Durch seine liebevolle Pflege zeigen sich nun sogar Eisvögel an den Ufern. Von räte werden neu gewählt. Das ist schwieriger als gedacht. er Gewässerwart des Angelvereins Ditzingen wohnt direkt an der ie Stadt Gerlingen sucht junge D Glems. „So habe ich immer mein Leute zwischen 14 und 18 Jahren, Revier im Blick“, sagt Frank Beutelspa- die sich als Jugendgemeinderäte cher und lacht. Seit zehn Jahren ist der D engagieren wollen. Die Bewerbungsfrist groß gewachsene Mann im grünen T-Shirt läuft noch bis Montag, 7. Oktober, 12 Uhr. zuständig für Hege und Pflege der Glems Das Gremium aus 18 Mitgliedern wird für auf der Gemarkung Ditzingen. Sein Verein zwei Jahre gewählt und tagt regelmäßig – hat das Gewässer in diesem Abschnitt ge- so wie der Gemeinderat. pachtet. Zehn verschiedene heimische „Unser Jugendgemeinderat ist sehr en- Fischarten leben heute dort, vom Aal über gagiert und aktiv“, sagt Anja Frohnmaier Bachschmerle, Flussbarsch, Hecht oder von der Geschäftsstelle des Gremiums, sei Karpfen bis hin zum Rotauge. „Durch den das in sozialen oder baulichen Belangen, heißen Sommer hatten die Forellen es die- er könne viel bewegen. Das zeigten die ses Jahr etwas schwer: Sie mögen es eher vergangenen zwölf Amtsperioden. Derzeit kühl“, berichtet der selbstständige Möbel- rührten die Jugendlichen fleißig die Wer- gestalter und Schreinermeister. -

Vom Pfaffenwald Zur Enz
Hermann Beck Vom Pfaffenwald zur Enz Die Glems und ihr Tal ., 1. Name und Quelle Die Quelle liegt439 m ü. NN im Stubensandstelll des Keupers. Das Was er der feuchten Glem~wie Die Entstehung des Namens der Glcms liegt im se am Rotwildgehege tritt am Glemsbrunnen 7Uta dunkeln der Geschichte. Er ist nach dem Histori ge und fließt durch einen lichten Buchenwald, in schenAUas von Badcn-WUrttembcrg indogerma einem kurzen Lauf von nur I km, in den Pfaffen nisch und stammt aus einer Zeit, ehe sich in Mi r see. Dieser wurde 1566 unter Herzog Christoph teleuropa Einzelsprac hen wie dns Kelt isc he oder angelegt. um den Nesenbach in Trockenzeit en mit German ische gebi ldet haben. Diese alteuropäi Wasser zu versorgen. Die st.llndi gen Klage n der schen Gcwlissernumen bezeichnen oft Eigenschaf Stuttgnrter Müller, Gerber und Färber über den ten des Wassers (Murr= .,Die Peuchte, die Modri· Wassermangel wurden vom Herzog erhör! und ge"; Neckar =,.der heftig Bewegte"). Dem Na men Abhilfe geschaffen. Durch den 850 Meter langen Glems li egt .,Gium isa" zugrunde, was sich von Cbristophsstollen wird auch heute noc h Glcms "glem" ="Schleim" ableitet. "Die Schleimige, die wasser nach Stuttgart geleitet. Doch des einen Schlammige" wtirc demnach die ursprüngliche Freud ist des anderen Leid. Durch diese Verle Bedeutung. gung der Wasser chcidc zwischen Glems und Zum ersten Mal taucht der Name im Codex Nesenbach kamen jetzt die Müller an derGiem 10 Laureshamensis (772 880) und dann in Urkunden Wassernot und arge Bedrängnis. die sich out der des 12. und 13. Jh. auf als .,Giemisgoue·' oder späteren Anlage des Bären~ees und des Neuen .•Giemsgeu .'' ln einem Urbar von 1350 liest man Sees im Glemswald noch steigerte.ln einem Brief dann die Bezeichnungen .... -

Protokoll Nachwuchsschwimmfest 2016
Protokoll Int. Nachwuchsschwimmfest in Gerlingen am 06.03.2016 "Schwimmspaß beim SV Gerlingen" Abschnitt 1 (06.03.2016) Veranstalter: SV Gerlingen Ausrichter: SV Gerlingen Ausgabe erstellt durch WK-Pro 2.52, http://www.wk-pro.de Int. Nachwuchsschwimmfest in Gerlingen am 06.03.2016 Protokoll "Schwimmspaß beim SV Gerlingen" Veranstalter: SV Gerlingen / Ausrichter: SV Gerlingen Seite: 1 Teilnehmende Vereine: Nr. Verein ID Pers. Ab.1 Ab.2 Summe 01: Badischer Schwimm-Verband 1. SSG Pforzheim 5136 8 24 2 - - 24 2 18: Schwimmverband Württemberg 2. Rangendinger Schwimmsport Verein 6675 5 8 - 7 - 15 - 3. SG Glems 5166 67 117 4 79 3 196 7 4. SG Neckar/Enz 5254 24 46 - 47 - 93 - 5. SG Stuttgart-Nord 6656 30 71 5 13 - 84 5 6. SV Freiberg 6585 5 16 - 5 - 21 - 7. SV Region Stuttgart 4982 11 17 - 20 - 37 - 8. TSG Backnang 2538 16 22 - 28 1 50 1 9. TSG Schwäbisch Hall 2545 4 8 - 7 - 15 - 10. TSV Betzingen 5088 9 19 2 6 - 25 2 11. TSV Dagersheim 2560 23 76 3 - - 76 3 12. TSV Neustadt 1906 2578 10 42 2 - - 42 2 13. VfL Waiblingen 2626 20 55 3 13 - 68 3 14. Wfr. Leonberg 2632 8 - - 25 1 25 1 Gesamt: 240 521 21 250 5 771 26 Ausgabe erstellt durch WK-Pro 2.52, http://www.wk-pro.de Int. Nachwuchsschwimmfest in Gerlingen am 06.03.2016 Protokoll (Abs. 1) "Schwimmspaß beim SV Gerlingen" Veranstalter: SV Gerlingen / Ausrichter: SV Gerlingen Seite: 2 Kampfgericht: Schiedsrichter 1 : Hans Harz SVW Bezirk Mittlerer Neckar Schiedsrichter 2 : Rainer Markwirth SVW Bezirk Mittlerer Neckar Sprecherin 1 : Kathrin Essig SG Glems Sprecher 2 : Björn Eich SG Glems Starter