Magisterarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Phonetic Evidence for the Contact-Induced Prosody in Budai Rukai *
Concentric: Studies in Linguistics 37.2 (July 2011):123-154 Phonetic Evidence for the Contact-Induced Prosody in Budai Rukai * Chun-Mei Chen National Chung Hsing University This paper investigates the contact-induced prosody in Budai Rukai, an Austronesian language spoken in Taiwan. By providing phonetic representations of word stress shift in Budai Rukai, the contact-induced prosody has been further verified. The contrastive stress in the Budai dialect is in the process of developing predictable penultimate stress resulting in innovations in new settlements. Budai Rukai speakers who have frequent contact with Paiwan speakers tend to produce the Paiwan stress patterns. The prosodic change has applied an optional rule of extrametricality, and echo vowels have been treated as proper vowels in the varieties. Antepenultimate stress becomes penultimate stress in trisyllabic or longer prosodic words, with a release from extrametricality. Results also suggest that speaker variability affected the stress shift in Budai Rukai. Keywords: phonetic evidence, contact-induced prosody, Budai Rukai, stress 1. Introduction This paper investigates word-level phonetic features of the varieties of Budai Rukai, and I propose that the prosodic varieties of Budai Rukai have undergone a change due to language contact. Stress in Budai Rukai has been a controversial issue (Li 1977, Ross 1992, Blust 1997). Previous studies address the stress issue mainly within the work of historical reconstruction. None of the existing studies have made a careful examination on the prosodic phonology of stress in Budai Rukai, let alone empirical evidence for the innovation of the prosodic patterns. The controversy of the Rukai stress lies in the inconsistency with the penultimate prominence or “paroxytones”, following the practice of Zorc (1983), and the phonological environments in which predictable stress patterns are attested. -
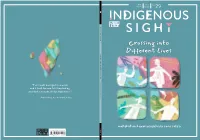
Crossing Into Different Lives
IPCF 2020 Issue magazine October 29 2020 October Issue 29 Issue October 2020 Crossing into mukakakua kuparaiaiahlüisa cucu sala'a cucu sala'a kuparaiaiahlüisa mukakakua Different Lives Crossing into Different Lives Different into Crossing “Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.” Robert Frost, The Road Not Taken. mukakakua kuparaiaiahlüisa cucu sala'a Words from Publisher Editorial pinadnaden o amizingan so cireng no rarakeh aka no malalavayo a tao pu'kataunan sa parhaway a kushwit Establishment of the Middle Ground Views across Generations Youthful Energy Pumps New Energy into Indigenous Communities o pimasawdan no makeykeylian a tao Traditional villages impose specific age rules and have their own Thau a kataunan lhmazawan ianan mani sa faqlhu a As the number of younger people returning to villages increases, an, pangozayan o cireng no rarakeh do systems to follow. It is always the village elders that provide kushwit, maqa ianan sa manasha wa parhaway mutauniza. a new force starts to form. The younger generation has come into opinions and make decisions on public affairs. However, kabedbedam no asa ka ili a vazavazay; am thuini a parhaway numa sa suma wa miniahala inai a thau contact with other groups within society, bringing back new ideas and when young people return to villages, they are faced with the fresh perspectives. Innovative approaches or solutions can then be sicyakwaya am, no siya mian do keymimili a qbit sa izai a shmuzaq, mapalansuun minfazaq, numa predicament where they cannot voice their opinions freely. Some kmathu sa faqlhu a inagqtu manakataun ; isa kataun derived when discussing issues in the villages. -

Sounding Paiwan: Institutionalization and Heritage-Making of Paiwan Lalingedan and Pakulalu Flutes in Contemporary Taiwan
Ethnomusicology Review 22(2) Sounding Paiwan: Institutionalization and Heritage-Making of Paiwan Lalingedan and Pakulalu Flutes in Contemporary Taiwan Chia-Hao Hsu Lalingedan ni vuvu namaya tua qaun Lalingedan ni vuvu namaya tua luseq…… Lalingedan sini pu’eljan nu talimuzav a’uvarun Lalingedan nulemangeda’en mapaqenetje tua saluveljengen The ancestor’s nose flute is like weeping. The ancestor’s nose flute is like tears... When I am depressed, the sound of the nose flute becomes a sign of sorrow. When I hear the sound of the nose flute, I always have my lover in mind. —Sauniaw Tjuveljevelj, from the song “Lalingedan ni vuvu,” in the album Nasi1 In 2011, the Taiwanese government’s Council for Cultural Affairs declared Indigenous Paiwan lalingedan (nose flutes) and pakulalu (mouth flutes) to be National Important Traditional Arts. 2 Sauniaw Tjuveljevelj, a designated preserver of Paiwan nose and mouth flutes at the county level, released her first album Nasi in 2007, which included one of her Paiwan songs “Lalingedan ni vuvu” [“The Ancestor’s Nose Flute”]. Using both nose flute playing and singing in Paiwan language, the song shows her effort to accentuate her Paiwan roots by connecting with her ancestors via the nose flute. The lines of the song mentioned above reflect how prominent cultural discourses in Taiwan depict the instruments today; the sound of Paiwan flutes (hereafter referred to collectively as Paiwan flutes) resembles the sound of weeping, which is a voice that evokes a sense of ancestral past and “thoughtful sorrow.” However, the music of Paiwan flutes was rarely labeled as sorrowful in literature before the mid-1990s. -

Rethinking Indigenous People's Drinking Practices in Taiwan
Durham E-Theses Passage to Rights: Rethinking Indigenous People's Drinking Practices in Taiwan WU, YI-CHENG How to cite: WU, YI-CHENG (2021) Passage to Rights: Rethinking Indigenous People's Drinking Practices in Taiwan , Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/13958/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 Passage to Rights: Rethinking Indigenous People’s Drinking Practices in Taiwan Yi-Cheng Wu Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy Social Sciences and Health Department of Anthropology Durham University Abstract This thesis aims to explicate the meaning of indigenous people’s drinking practices and their relation to indigenous people’s contemporary living situations in settler-colonial Taiwan. ‘Problematic’ alcohol use has been co-opted into the diagnostic categories of mental disorders; meanwhile, the perception that indigenous people have a high prevalence of drinking nowadays means that government agencies continue to make efforts to reduce such ‘problems’. -

The Rukai People and Collaborative Conservation in Pingtung, Taiwan
ASSERTING SOVEREIGNTY THROUGH STRATEGIC ACCOMMODATION: THE RUKAI PEOPLE AND COLLABORATIVE CONSERVATION IN PINGTUNG, TAIWAN By Ying-Jen Lin A DISSERTATION Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Anthropology—Doctor of Philosophy 2020 ABSTRACT ASSERTING SOVEREIGNTY THROUGH STRATEGIC ACCOMMODATION: RUKAI PEOPLE AND COLLABORATIVE CONSERVATION IN PINGTUNG, TAIWAN By Ying-Jen Lin This dissertation examines how the Rukai, an Indigenous people of Taiwan, have engaged in community-based ecotourism and the state’s conservation projects in order to assert Indigenous sovereignty over traditional territories. This study focuses on the Adiri and the Labuwan communities, which are communities of the Rukai people living in the Wutai Township in Pingtung, Taiwan. The two Rukai communities have actively collaborated with the government on various conservation projects although the relationship between Indigenous peoples of Taiwan and the settler state’s forest governance system has been riddled with conflicts. Existing research has portrayed collaborative environmental governance either as an instrument for co-optation of Indigenous interests or as a catalyst for a more equitable relationship between the state and Indigenous peoples. This dissertation builds on and extends this body of work by examining how the Rukai people have continueD to assert sovereignty in the community-based ecotourism and collaborative conservation projects. Using a combination of ethnographic observations, interviews, -

Wayfinding and the Materialisation of an Ancestral Homeland Wen-Ling Lin
2 From paths to traditional territory: Wayfinding and the materialisation of an ancestral homeland Wen-ling Lin Introduction The concepts of an ‘ancestral home’, ‘old tribe’ and ‘traditional territory’ have often been the main concerns at various Taiwanese indigenous social and cultural events. Every ‘return to the old site’ or ‘exploration for an old tribe’ implies, more or less, the loss or disappearance of an original habitat. Following the instructions of their elders, younger generations search through the mountains for the sites where their ancestors used to live and work. Wayfinding while walking to a certain place has become a common theme of these activities. The trajectories of such movements circumscribe the possible scope of a traditional territory. By walking, indigenous peoples make repeated visits to their ancestral home, giving form to their ‘ancestral homeland’ as conceived by their elders. The concept of a ‘homeland’ comes into being during the process of searching and a relationship is formed between people and the land. This differs drastically in terms of feelings and expression from the dematerialisation of space in contemporary social life. 29 AUSTRONESIAN Paths AND JOURNEYS Laipunuk is a region in the southeastern section of Taiwan’s Central Mountain Range, including the upper and middle reaches of the Luye River, a tributary of the Beinan River. It encompasses the present-day townships of Yanping and Haiduan in Taitung County, the western parts of the Maolin and Taoyuan districts of Kaohsiung City and the border between Wutai Township and Pingtung County. According to the literature, in the early days, it was where the Ngerarukai Rukai (‘Oponoho’ or Wanshan in Chinese), the East Rukai Danan community, the Southern Tsou and the Puyuma lived. -

On the State's Registration Of
A POSTCOLONIAL PERSPECTIVE ON THE STATE’S REGISTRATION OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS By Chun-Chi Hung Submitted in partial fulfillment of the requirements of the Degree of Doctor of Philosophy 1 Statement of Originality I, Chun-Chi Hung, confirm that the research included within this thesis is my own work or that where it has been carried out in collaboration with, or supported by others, that this is duly acknowledged below and my contribution indicated. Previously published material is also acknowledged below. I attest that I have exercised reasonable care to ensure that the work is original, and does not to the best of my knowledge break any UK law, infringe any third party’s copyright or other Intellectual Property Right, or contain any confidential material. I accept that the College has the right to use plagiarism detection software to check the electronic version of the thesis. I confirm that this thesis has not been previously submitted for the award of a degree by this or any other university. The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author. Signature: Chun-Chi Hung Date: 2019/06/12 Details of collaboration and publications: NA 2 Abstract This thesis draws upon postcolonial theory to examine to what extent the state’s registration system is an appropriate approach to protecting indigenous people’s traditional cultural expressions (TCEs). It specifically includes a case study on the performance of the state’s registration system in Taiwan in accordance with Taiwan’s Protection Act for the Traditional Intellectual Creations of Indigenous Peoples. -

Storytelling of Taiwanese Aborigines Plays
ABSTRACT STORYTELLING OF TAIWANESE ABORIGINAL PLAYS BALENG AND SNAKE, FLYING FISH FISHERS, AND HAWK SISTERS By SHU-CHIN HUANG This creative thesis focuses on my three adapted Taiwanese aboriginal plays, which staged in Ernst theatre in Miami University. Chapter One includes the historical origins of Taiwanese aborigines told by different countries through different perspective. Chapter Two is a review on the playwriting process how I applied storytelling and theatrical form in these three aboriginal stories. In Chapter Three, I discuss production process as well as the process translators working with translators. The whole creating process of these three plays focuses on the pursuit of nature theme and uses theatre as a new way of storytelling to English-speaking people. Chapter Four are the scripts, which were staged in Ernst nature theatre in Miami University in middle August, 2005. STORYTELLING OF TAIWANESE ABORIGINAL PLAYS BALENG AND SNAKE, FLYING FISH FISHERS, AND HAWK SISTERS A Thesis Submitted to the Faculty of Miami University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of Theatre by Shu-chin Huang Miami University Oxford, Ohio 2006 Advisor_______________________________ Dr. Howard A. Blanning Reader________________________________ Dr. Roger Bechtel Reader________________________________ Dr. William A. Wortman TABLE OF CONTENTS Acknowledgements …………………………………………………………..……..iii Introduction ……………………………………………………………………. ……1 Chapter One …………………………………………………………………………5 Chapter Two ………………………………………………………………………..18 Chapter Three ………………………………………………. …………………….26 Chapter Four ……………………………………………………………………….31 Work Cited…………………………………………………………………………. 57 Pictures of Productions……………………………………………………………..60 ii Acknowledgements I would like to express my special gratitude to Dr. Howard Blanning for being an understanding, inspiring, and supporting adviser, who always has insightful conversations with my plays. I thank the great teaching of Dr. -

When Visiting Indigenous Communities Words from Publisher
2019 August Publishing Organization: Editing & Production: Business Today Publisher Indigenous Peoples Cultural Foundation Art Editors: Zheng Liang-Long, Liao Xin-Hua Vol. Translators: Deh-I Chen, Sally I.C. Wu, Yu-hsuan Lai, Nai-yu Ker, Shih-fen Lin Publisher: AMAYA‧SAYFIK Chief Editor: Kacaw‧Fuyan Address: 8F, No.96, Sec. 1, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City Coordinator: Doyu‧Masao Tel: 02-2581-6196 ext. 336 23 Executive Editors: Lovenose, Bali Art Coordinator: Bali Fax: 02-2531-6433 Address: 5F., No.120, Chongyang RD., Nangang Dist., Cover Art: Jia-Dong Lin Taipei City, 11573 Tel: 02-2788-1600/0800-581-600 Fax: 02-2788-1500 Looking at the world from an indigenous perspective. E-mail: [email protected] Online version: Price: TWD 100 A ll c ont ent in t he p A ubl ll rig icati hts re on d serve oes n d, rep X ot re roduct er. -111 prese ions of ublish 2313 nt the this pub m the p SN: view lication wil consent fro e" ) IS of the F l be prosecuted. Do not repost without written agazin oundati ory: "M on. License mail categ Code: Chunghwa Post Taipei Magazine No. 2064 ( Retrace the Lost Roots Words from Publisher 02 Step by Step on a Decennial Down-to-earth Journey Editorial 03 The Worst, Also the Best Era! 06 Fundamental Facts about Indigenous Traditional Territory 38 Returning to Old Communities to 1 0 Stranger to Modern Civilization Seek Former Memories of Home 1 8 When Indigenous Communities 40 The Cultural Awakening of an Urban Youth: Meet Tourism: those BOT Projects Passing on Traditions in the Community in Our Traditional Territories 42 Rooted in Culture: 26 In front of My Home, there is a Mine Atayal Wufon Hunter School 34 The Road May be Long and Difficult, 44 A Home Cooking Lesson but We Will Return Home which Reclaims Memories of Food 36 The Hunter Guardian of 46 Things to Remember the Atayal Forest in Nan'ao when Visiting Indigenous Communities Words from Publisher Step by Step on a Decennial Down-to-earth Journey This year is the tenth anniversary of the Indigenous to communities. -

Disaster, Relocation, and Resilience: Recovery and Adaptation of Karamemedesane in Lily Tribal Community After Typhoon Morakot, Taiwan
Environmental Hazards ISSN: 1747-7891 (Print) 1878-0059 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/tenh20 Disaster, relocation, and resilience: recovery and adaptation of Karamemedesane in Lily Tribal Community after Typhoon Morakot, Taiwan Sasala Taiban, Hui-Nien Lin & Chun-Chieh Ko To cite this article: Sasala Taiban, Hui-Nien Lin & Chun-Chieh Ko (2020): Disaster, relocation, and resilience: recovery and adaptation of Karamemedesane in Lily Tribal Community after Typhoon Morakot, Taiwan, Environmental Hazards, DOI: 10.1080/17477891.2019.1708234 To link to this article: https://doi.org/10.1080/17477891.2019.1708234 Published online: 02 Jan 2020. Submit your article to this journal View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tenh20 ENVIRONMENTAL HAZARDS https://doi.org/10.1080/17477891.2019.1708234 Disaster, relocation, and resilience: recovery and adaptation of Karamemedesane in Lily Tribal Community after Typhoon Morakot, Taiwan Sasala Taibana, Hui-Nien Linb and Chun-Chieh Koc aDepartment of Sociology, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan; bIndigenous Program of the College of Tourism and Hospitality, I-Shou University, Kaohsiung, Taiwan; cAssembly of Ngudradrekai, Pingtung, Taiwan ABSTRACT ARTICLE HISTORY After Typhoon Morakot struck Taiwan in the summer of 2009, Received 26 December 2018 government officials relocated the indigenous village communities Accepted 16 December 2019 of Kucapungane, Adiri, Karamemedesane, Kinulane, Dawadawan KEYWORDS and Tikuvulu into sub-montane, permanent housing. Because Village migration; Typhoon villagers were accustomed to living in mountainous areas, they Morakot; community encountered many challenges while adapting their lifestyle and resilience; post-disaster culture into a new setting. -
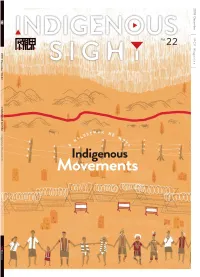
Indigenous Publications Began to Appear on Campus and Indigenous Intellectuals Also Marched on the Streets
Editorial A Time of Change -The Era of Indigenous Movements The early 1980s marked the budding stage of awareness of Taiwanese indigenous peoples’ rights. Although Taiwan was still under martial law at that time, many indigenous publications began to appear on campus and indigenous intellectuals also marched on the streets. Taiwan ended its martial law in 1987, and bans on newspapers and magazines were lifted; consequently, a large number of media appeared, ushering in an era of knowledge liberation. The movement also provided a platform for the marginalized voice of indigenous peoples to be heard by mainstream media. During that time, the so-called opposing political party media played an important role in promoting democracy. From the "Give Back Our Land" movement, the name rectification movements, to the current appeals for self-governance and reclaiming traditional land and space, requests of the indigenous peoples have always been closely related to the land. This also shows that, from the Qing dynasty, Japanese Occupation important milestones in the history of Taiwan media. The publications Period, to the Nationalist Government period, the fate documented a lot of important indigenous literature, and are of indigenous peoples is mirrored in the gradual loss of important data sources when reconstructing an indigenous- their ancestral land. perspective history and knowledge system. Unfortunately, the number of indigenous magazines and monthly publications gradually Established in 1984, the Taiwan Indigenous Rights decreased after 2000. Promotion Association originally fought for individual identity rights. The Association later expanded to include In 2008, indigenous peoples once again stood up to defend their fighting for the collective sovereignty of the overall dignity: individuals throughout Taiwan came together to voice Austronesian indigenous peoples, writing a new chapter their frustration on the loss of land, autonomy, dignity, and survival in indigenous history. -
Ready for a Journey to Explore Taiwan's Indigenous Tribes ? Let’S Go !
Did you know ? Taiwan is home to groups of Austronesian indigenous people who have lived on this island for over 8,000 years. Did you know ? Taiwan has sixteen officially recognized indigenous peoples, who each have their own native languages and culture. Did you know ? Alongside famous tourist magnets like Taroko Gorge, Alishan, Sun Moon Lake, and Kenting, you may also explore and experience the traditional lifestyles of aboriginal tribes around the island. Ready for a journey to explore Taiwan's indigenous tribes ? Let’s go ! uhtan’e ho mimimiyo in the Tsou language means "Come, from one village to another." 2 3 . . Distribution of Taiwan's Indigenous Peoples Distribution of Taiwan's Indigenous Peoples Amis Or Pangcah. They live on plains around Mt. Chilai in northern Hualien, south to the coastal plains and the hilly Distribution of Indigenous Peoples in Taiwan areas of Taitung and the Hengchun Peninsula. They have a total population of about 177,000, which is the largest Taiwanese indigenous peoples were the first among Taiwan’s indigenous peoples. settlers on this island. They have diverse Atayal Distributed in the northern part of Taiwan’s Central cultural backgrounds and languages. Mountain Range, including the area from north of Puli to Their population is approximately Hualien. They have a total population of approximately 540,000 (only 2.3% of Taiwan’s total). 81,000. Most indigenous groups live Scattered on both sides of the southern Central Mountain around the Central Mountain Paiwan Range - from north to Mt. Dawu, south to Hengchun, west Range, in the East Rift Valley to Fangliao, and east to Taimali in Taitung.