Die Gatiung Leucanthemum Mill
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
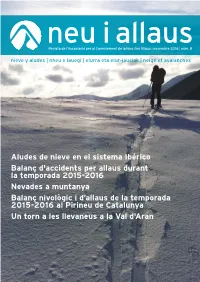
Nieve Y Aludes | Nheu E Lauegi | Elurra Eta Elur-Jausiak | Neige Et Avalanches
neu i allaus Revista de l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus | novembre 2016 | núm. 8 nieve y aludes | nheu e lauegi | elurra eta elur-jausiak | neige et avalanches Aludes de nieve en el sistema Ibérico Balanç d'accidents per allaus durant la temporada 2015-2016 Nevades a muntanya Balanç nivològic i d’allaus de la temporada 2015-2016 al Pirineu de Catalunya Un torn a les llevaneus a la Val d'Aran 1 Sumari 3 Editorial 4 Aludes de nieve en el sistema Ibérico José Luis San Vicente Marqués, Isabel Cuenca Peña y Pere Rodés i Muñoz 10 Balanç d'accidents per allaus durant la temporada 2015-2016 Jordi Gavaldà i Bordes i Glòria Martí i Domènech 13 Nevades a muntanya Ramón Pascual Berghaenel i Gabriela Cuevas Tascón 20 Las 10 reglas básicas para entender una predicción meteorológica Luca Mercalli y Rocío Hurtado Roa 2 2 Balanç nivològic i d’allaus de la temporada 2015-2016 al Pirineu de Catalunya Carles García Sellés i Glòria Martí i Domènech 24 Balance nivológico y de aludes de la temporada 2015-2016 en el Valle del Aragón (Huesca) Jon Apodaka Saratxo 28 Un torn a les llevaneus a la Val d'Aran Claudia Ramos Ferrer 31 ESPAI NEU I NENS: Allau a la peixera! Sara Orgué Vila 31 La formació a l'ACNA Comissió de Formació ACNA NEU i ALLAUS EDITA Revista de l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus ACNA Número 8 | Novembre de 2016 www. -

Comarca Del Matarraña
Comarca del Matarraña Comarca del Matarraña José Antonio Benavente Serrano Teresa Thomson Llisterri (Coordinadores) Edita: Diputación General de Aragón Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales Coordinación general: José Luis Ona González (Sargantana-Patrimonio) Coordinación: José Antonio Benavente Serrano y Teresa Thomson Llisterri Diseño cubierta (colección): Cano & Cano Imagen cubierta: Puente de Valderrobres sobre el río Matarraña (Foto: María Ángeles Pérez Hernández) Fotos: Alberto Bayod (página 193 derecha e izquierda). José Antonio Benavente (páginas 81 derecha e izquierda, 90, 296, 300). C. Estevan (página 293). P. Moret (página 80). Museo de Teruel (páginas 87, 142, 244). Museo Juan Cabré (página 270). José Luis Ona (páginas 362, 363, 364, 370, 381, 387). María Ángeles Pérez Hernández (páginas 14, 19, 23, 96, 99, 114, 145, 148, 149, 150, 155, 156, 157, 159, 162, 164, 167, 168, 171, 174, 175, 180, 182, 184, 186, 188, 189, 198, 200, 204, 207 derecha e izquierda, 208, 235, 237, 249, 250, 257, 258, 260, 262, 267, 274, 275, 278, 279, 285, 286, 290, 305, 306, 316, 320, 333, 337, 343, 344, 345 superior e inferior, 346, 347 superior e inferior, 348, 349 superior e inferior, 350 superior e inferior, 351 superior e inferior, 352, 353 superior e inferior, 354). José Luis Roda (páginas 36, 43, 47, 49, 51, 61, 62, 72, 76). Francisco Javier Sáenz (páginas 230 superior e inferior, 231, 234). Fernando Zorrilla (páginas 40, 46, 54, 55, 63, 69, 74) Preimpresión: INO reproducciones, S.A. Impresión: INO reproducciones, S.A. I.S.B.N.: 84-7753-723-2 Depósito legal: Z-1621-2003 Índice Presentación. -

Identificación De Áreas a Desfragmentar Para Reducir Los Impactos De Las Infraestructuras Lineales De Transporte En La Biodiversidad
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS A DESFRAGMENTAR PARA REDUCIR LOS IMPACTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS LINEALES DE TRANSPORTE EN LA BIODIVERSIDAD Madrid, 2013 Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Edita: Distribución y venta: © Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Paseo de la Infanta Isabel, 1 Secretaría General Técnica 28014 Madrid Centro de Publicaciones Teléfono: 91 347 55 41 Fax: 91 347 57 22 Maquetación, impresión y encuadernación: DiScript Preimpresión, S. L. NIPO: 280-13-205-8 (Papel) NIPO: 280-13-206-3 (Línea) Tienda virtual: www.magrama.es ISBN: 978-84-491-1326-0 [email protected] Depósito Legal: M-34539-2013 Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: http://publicacionesoficiales.boe.es/ Datos técnicos: Formato: 21 x 29,7 cm. Caja de texto: 15,1 x 25,3 cm. Composición: 2 columnas. Tipografía: Myriad Pro a cuerpo 10. Encuadernación: rústica cosida con hilo. Papel: couché mate de 115 g. Cubierta en cartulina gráfica de 300 g. Tintas: 4/4. En esta edición se ha utilizado papel ecológico sometido a un proceso de blanqueado TCF, cuya fibra procede de bosques gestionados de forma sostenible. Este documento se ha redactado en el marco de una Comisión técnica integrada en el Grupo de Trabajo sobre Fragmentación de Hábitats causada por Infraestructuras de Transporte, coordinado por la Subdirección General de Medio Natural de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que participaron las siguientes personas: Georgina Álvarez Jiménez, DG de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. -

MUNT 1994 12 0796.Pdf
MUNTANYA CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA Club Alpí Cátala 199>4 ANY CXVIII, VOL. 98, NÚMS. 791-796 Confecció dels índexs: Joaquim Bordons i Serra ÍNDEXS ANY CXVIII, VOL. 98, NÚMS. 791-796 ÍNDEX GENERAL nader i entom ( F. M ). 189. horn/ Cervino (F.C), 15. D'AUTORS I D'ARTICLES Carreté i Bisbal, Kildo: Camins deh Gurri, Francese: Cronologia de la ports de Beseit. 6. La serra de protecció del Montseny. 106. l'Espino i entom (F. M). 230. Hijar, Robert: De la baga a la solana. Referències d'illustracions: Català i Viladevall, Lluis: Els camins Fi de curs botànic a la Molina (F. (F) fotografia. (M) mapa, (D) dibuix. dels quatre uni. IO. Matterhorn/ D), 53. (C) croquis. (G) grafie. Cervino (F. C). 15. Jolis, Agusti: 50 volums de la coilec- Codina, Josep M.: Expedició Yukon ció «Llibre de motxilla» (F), 208. Aguadé, Jaume: Esquiar al Wilds- '92 {Canada) (F, C), 226. Kirchner, Francese: Participado del trubeKF. M), 242. Cortes i Ribelles, Manuel: Arbres ex- Centre en la compativa «Pirineas Aguilar ¡ Gimeno, Julia: Popo- cepcionals del Montsec i la seva ro nets» (F), 33. catepetl, la muntanxa que fume ja dai ia (II) (F). 199. Latorre, Ferran: La cinta del silenti (F. D). 12. Costa i Costa, Joan: XXV Renovació (F),56. Aloy, David: Estanys de Rabassales, de la /'lama de la Llengua Catalana Martín Guillen, Sandra: LAma Negre i Blau (F. M). 20. 09.91. zonia: una complexitat difícil de Andreu, Joan-Bernat: De la baga a DEPANA: Cai modificar el pia espe comunicar (F). 163. la solana. -

Aragon 20000 of Trails
ENGLISH ARAGON 20,000 KM OF TRAILS BEAUTY AND ADVENTURE COME TOGETHER IN ARAGON’S EXTENSIVE NETWORK OF TRAILS. FROM THE HEIGHTS OF THE PYRENEES TO THE BREATHTAKING STEPPES OF THE EBRO AND THE MOST RUGGED MOUNTAIN RANGES ON THE IBERIAN PENINSULA, HERE YOU WILL FIND NATURE AT ITS BEST. HIKING TRAILS OF ARAGON LONG-DISTANCE PATHS THEMED LONG-DISTANCE HIKES WALKS AND EXCURSIONS CLIMBS ACCESIBLE TRAILS Download the app for the Hiking Trails of Aragon and go to senderosturisticos.turismodearagon.com / HIKING TRAILS OF ARAGON 01/ HIKING TRAILS OF ARAGON .................................. 1 02/ INDEX OF TRAILS IN THIS GUIDE .................... 4 03/ LONG-DISTANCE PATHS ........................................ 6 04/ THEMED LONG-DISTANCE HIKES ............... 9 05/ WALKS AND EXCURSIONS ............................... 12 06/ CLIMBS .................................................................................... 28 07/ ACCESSIBLE TRAILS ................................................ 32 Published by: PRAMES Photography: F. Ajona, D. Arambillet, A. Bascón «Sevi», Comarca Gúdar-Javalambre, Comarca Somontano de Barbastro, M. Escartín, R. Fernández, M. Ferrer, D. Mallén, Montaña Segura, M. Moreno, Osole Visual, Polo Monzón, Prames, D. Saz, Turismo de Aragón HIKING IS ONE OF THE BEST WAYS TO GET FIRSTHAND EXPERIENCE OF ALL THE NATURAL AREAS THAT ARAGON HAS TO OFFER, FROM THE SOUTHERNMOST GLACIERS IN EUROPE, FOUND ON THE HIGHEST PEAKS OF THE PYRENEES, TO THE ARID STEPPES OF THE EBRO VALLEY AND THE FASCINATING MOUNTAIN RANGES OF TERUEL. / HIKING TRAILS OF ARAGON In terms of landscapes and natural beauty, Aragon is exceptional. It is famous for the highest peaks in the Pyrenees, with Pico de Aneto as the loftiest peak; the Pre-Pyrenean mountain ranges, with Guara and the Mallos de Riglos as popular destinations for adventure sports worldwide; and the Iberian System, with Mount Moncayo as its highest peak and some of the most breathtakingly rugged terrain in Teruel. -

Dictamen Sobre La Propuesta Para La Declaración De Una Zona En La Provincia De Teruel Como
Dictamen Pleno CPN 8_11_2012 DICTAMEN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE ARAGÓN SOBRE LA PROPUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE UNA ZONA EN LA PROVINCIA DE TERUEL COMO ESPACIO NATURAL PROTEGIDO EN LA CATEGORÍA DE PARQUE NATURAL El Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2012, y conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, acordó emitir el siguiente DICTAMEN Con fecha 5 de junio de 2012, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo escrito de la Dirección General de Conservación del Medio Natural del Gobierno de Aragón, solicitando informe sobre la posibilidad de acometer la declaración de una zona en la provincia de Teruel como espacio natural protegido, en la categoría de Parque Natural, dado que este territorio es una de las pocas provincias en España que no cuenta con una zona protegida bajo esta categoría de protección. Tras su debate y deliberación en la reunión de la Comisión Conjunta de Espacios Naturales Protegidos, Flora y Fauna Silvestre y de Protección del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, celebrada el día 18 de septiembre de 2012, y tras considerar que el Consejo debe informar sobre el objeto de la solicitud formulada, se acuerda: Emitir el siguiente Dictamen sobre la Propuesta del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, para la declaración de una zona en la provincia de Teruel como espacio natural protegido en la categoría de Parque Natural 1.- INTRODUCCIÓN Entre las funciones que tiene atribuidas el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón en la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza, el artículo 2 “Funciones del Consejo” establece c) Proponer zonas a declarar como espacios naturales protegidos y la modificación de las ya existentes. -

The Collection of Type Specimens Belonging to The
Arxius de Miscel·lània Zoològica, 14 (2016): 1–90 ISSN:Viñolas 1698– et0476 al. The collection of type specimens belonging to the superfamilies Scarabaeoidea, Buprestoidea, Byrrhoidea, Elateroidea, Cleroidea, Cucujoidea, Tenebrionoidea (except Tenebrionidae family), Chrysomeloidea and Curculionoidea (Coleoptera) hosted in the Natural Sciences Museum of Barcelona, Spain A. Viñolas, B. Caballero–López & G. Masó Viñolas, A., Caballero–López, B. & Masó, G., 2016. The collection of type specimens belonging to the superfamilies Scarabaeoidea, Buprestoidea, Byrrhoidea, Elateroidea, Cleroidea, Cucujoidea, Tenebrionoidea (except Tenebrionidae family), Chrysomeloidea and Curculionoidea (Coleoptera) hosted in the Natural Sciences Museum of Barcelona, Spain. Arxius de Misceŀlània Zoològica, 14: 1–90. Abstract The collection of type specimens belonging to the superfamilies Scarabaeoidea, Buprestoidea, Byrrhoidea, Elateroidea, Cleroidea, Cucujoidea, Tenebrionoidea (except Tenebrionidae family), Chrysomeloidea and Curculionoidea (Coleoptera) hosted in the Natural Sciences Museum of Barcelona, Spain.— The type collection of the superfamilies Scarabaeoidea, Buprestoidea, Byrrhoidea, Elateroidea, Cleroidea, Cucujoidea, Tenebrionoidea (except Tenebrionidae family), Chrysomeloidea and Curculionoidea (Coleoptera) deposited in the Natural Sciences Museum of Barcelona, Spain, has been organised, revised and documented. It contains 533 type specimens belonging to 170 different taxa. Of note is the considerable number of species of different families described -

Flora Y Vegetación De Las Sierras De Cucalón Y Fonfría. VEGETACIÓN
FLORA Y VEGETACIÓN DE LAS SIERRAS DE HERRERA,CUCALÓN y FONFRÍA JAVIER FERRER PLOU Zaragoza, 1993 NATURALEZA EN ARAGÓN 4 ..Q$ -GOBIERNO.. :. : DE ARAGON Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes. 5. ITINERARIOS DE INTERÉS A continuación describiremos una serie de itinerarios cuyo recorrido nos permitirá conocer directamente el paisaje vegetal de estas sierras. Los dos pri meros (Itinerarios 1 y 2) pueden realizarse en coche, por carreteras asfaltadas, o en algunos tramos por pistas en buenas condiciones, y nos permitirán adquirir una visión de conjunto de la flora y vegetación de la comarca. Los otros cuatro, en el transcurso de los cuales visitaremos muchas de las localidades más intere santes botánicamente, deberán realizarse a pie. Los números 3, 4 Y5 no presentan especiales dificultades, ya que transcurren por sendas y caminos de montaña. Sin embargo, el Itinerario n.? 6 presenta algunos tramos de difícil tránsito, por lo que si bien no hace falta ser un experto montañero para recorrerlo, sí es necesario contar con un cierto hábito de andar por el campo. Itinerario n." 1 VILLANUEVA-PANTANO DE LAS TORCAS-HERRERA-SJERRA DE CUCALÓN-FoNFRÍA• PUERTO DE RUDlLLA Presentación Este itinerario nos permite recorrer la comarca desde la parte más baja, en contacto con la Depresión del Ebro, hasta la cima de las sierras ibéricas. Durante el viaje iremos observando los sucesivos pisos de vegetación, empezando por las formaciones termófilas del coscojar con pino carrasco en Villanueva de Huerva a 600-700 m. de altitud, siguiendo por los carrascales progresivamente más fríos, desde Tosas a Herrera, entre los 700 y 1300 m., hasta alcanzar los quejigales y marojales de la parte más elevada, en las sierras de Cucalón y Fonfría, desde los 1100 a los 1500 m, de altitud, Por último, en el puerto de Rudilla a más de 1300 m. -

Aprovechamiento Eléctrico De La Cabecera Del Río Pitarque
Ontejas Asociación Cultural de Fortanete Aprovechamiento eléctrico de la cabecera del río Pitarque Francisco Agustín Iñigo Muñoz La naturaleza no fue pródiga en recursos con las partes altas de la provincia de Teruel. Si sumamos la altitud, la situación geográfica, la índole del suelo y la orografía, muy complicada en muchas de sus comarcas, con las consecuencias de un régimen de humedad y una zonas agroclimáticas de régimen Mediterráneo, templado fresco y templado frío, se nos ofrece un marco de vida muy difícil, desde siempre, para los habitantes de estas tierras. En la evolución socioeconómica ocurrida a lo largo del presente siglo en España, nuestras zonas altas turolenses han quedado rezagadas por la serie de condicionantes que han bloqueado las posibilidades para la creación de infraestructuras, que potenciasen la transformación de la población asentada en pequeños pueblos distanciados entre sí, y que no pudieron superar la fase del artesanado tradicional, convertible en la incipiente industrialización que permitiera el desarrollo económico, aligerando a la precaria agricultura-soporte y a la ganadería de recursos limitados. El clima, la falta de cursos de agua suficientes y las malas comunicaciones bloqueaban cualquier posibilidad seria que tratara de emprenderse. Algunas de nuestras comarcas se han beneficiado con la existencia de reservas de lignitos, que han venido explotándose hasta su agotamiento, o hasta que la llegada de carbones más baratos y de mejor calidad de importación han creado situaciones difíciles, resueltas por -

Expte. DI-323/2014-8 EXCMA. SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE Parque Empresarial Dinamiza
Expte. DI-323/2014-8 EXCMA. SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE Parque Empresarial Dinamiza (Recinto Expo) Pablo Ruiz Picasso, 65 D 50018 ZARAGOZA Asunto: Supresión de primer ciclo de ESO en Centros del medio rural I. ANTECEDENTES PRIMERO.- Han tenido entrada en esta Institución 34 quejas, 32 presentadas por colectivos y 2 individuales, agrupadas en 11 expedientes, que muestran su disconformidad con el hecho de que dejen de impartirse 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria en determinados Centros de Primaria de las provincias de Huesca y Teruel. En particular, la queja de un colectivo que quedó registrada con el número arriba expresado, a la que posteriormente se incorporan 443 firmantes y dos colectivos más, hace referencia al caso concreto de Cedrillas (Teruel), y formula las siguientes consideraciones de carácter general: «La despoblación es la pérdida masiva de habitantes de una región o ecosistema que se desplazan a otros lugares por causas naturales o humanas. Los municipios con mayores posibilidades de revitalización demográfica por poseer una mínima calidad de vida, son los que tienen servicios básicos educativos y sanitarios, cuya existencia caracteriza al estado del bienestar. Tienen mayor capacidad para atraer y fijar a nuevos pobladores, y para permitir que las familias que ya residen en el territorio puedan seguir 1 haciéndolo. Nadie puede negar que "si una escuela se cierra, el pueblo desaparece". Nadie puede negar que restando unidades a un centro escolar, este se encamina a su cierre. La igualdad de oportunidades es una forma de justicia social que se da cuando cada persona tiene el mismo acceso potencial a un bien social o económico que cualquier otra, independientemente de sus circunstancias y, por tanto, del lugar en que habita. -

ARQUEOLOGÍA DEL ARAGÓN ROMANO (Continuación) Por JOAQUÍN LOSTAL PROS
ARQUEOLOGÍA DEL ARAGÓN ROMANO (Continuación) Por JOAQUÍN LOSTAL PROS II C 3.° EL CAMPO DE BELCHITE ALMONACID DE LA CUBA. II C 3.° Pueblo situado junto al río Aguasvivas, sobre el que existe un dique para formar un pequeño pantano. Según Galiay(450) es obra romana. AZAILA. II C 3.° El proceso romanizador tiene su inicio en el «Cabezo de Alcalá» de Azaila con la destrucción de la ciudad hallsttáttica, hecho que lleva a cabo el cónsul Catón entre los años 197-195(451), aunque tal acción suponga tan sólo una toma de contacto con este factor externo, pues la nueva ciudad, de corte marcadamente ibérico, todavía conservará su tradición céltica anterior. A esta ciudad, levantada sobre el poblado céltico, pertenece la pro ducción original de la cerámica ibérica denominada de Azaila, y los primeros hallazgos de Campaniense A y B. Según M. Beltrán esta ciu dad «muy posiblemente fue pompeyana, y se destruyó durante las guerras de Sertorio en la comarca, entre los años 75-72 a. de J. C, y llevó el nombre de Beligio»(452). Si hasta el momento la romanización apenas ha jugado un papel re ducible a un mero trasiego comercial dentro de la gran eclosión de la cultura ibérica, con la erección de la tercera ciudad se llega al mo- memto álgido de la presencia cultural romana plasmada en el templo clásico en las termas en las casas de «aspecto pompeyano» y en los estucos pintados. Esta última ciudad destruida tras los sucesos del (450) La dominación romana..., pág. 123. (451) BELTRÁN, Α.: Notas sobre la cronología del poblado Cabezo de Alcalá en Azaila (Te ruel). -

The Route of the Magic Corners of Teruel Slow Driving Aragón
Slow driving aragón THE ROUTE OF THE MAGIC CORNERS OF TERUEL On this route, which takes us through several regions of the province of Teruel, we can discover pretty corners, beautiful natural landscapes, monumental buildings.... In Alcañíz we will be surprised by the splendid castle of the Calatrava Order and in Calanda we will follow in the footsteps of the great director Luis Buñuel. Here, too, we find the typical neveras in the "Routes of the Vaults of the Cold" - buildings where snow was once stored and turned into ice. We also find places and villages that are part of the spectacular Holy Week of the Bajo Aragón. In Molinos we can take a nice walk underground and admire the beauty of the Grutas de Cristal (crystal caves), and in Escucha, also 200 metres underground, we may also experience the hard life of the miners. This route takes us through some sections of the Río Martín Cultural Park and lets us discover true treasures of the Mudéjar heritage in the churches of Montalbán or Olalla. At the end of the day, we can enjoy the well-deserved relaxation in the spa town of Segura de Baños. The route of the magic corners of teruel Slow driving aragón IF YOU START IN ALCAÑIZ START Alcañiz is a town and a municipality of the region of Bajo Aragón, in the province of Teruel, in Aragon. Alcañiz The village is described by many as the Spanish Monaco, because its roads were pioneers for 20 years among the circuits where the best drivers fought for victory, and because its spirit lives on today thanks to the Motorland Circuit.