Magisterarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Satzungen Der Partei
SATZUNGEN DER PARTEI Beschlossen am 14./15. Februar 1987, zuletzt geändert am 43. Bundeskongress am 13. Juni 2021 DIE GRÜNEN / DIE GRÜNE ALTERNATIVE DIE STATUTEN / INHALTSVERZEICHNIS § 1. NAME UND SITZ 2 § 9. GRÜNES SYMPOSIUM 8 1.1. NAME .......................................................... 2 9.1. AUFGABEN ................................................... 8 1.2. TÄTIGKEITSBEREICH ...................................... 2 9.2. EINBERUFUNG .............................................. 8 1.3. LANDESORGANISATIONEN ............................... 2 9.3. VORBEREITUNG, LEITUNG, FRISTEN ................. 8 1.4. TEILORGANISATIONEN/GRÜNE ORGANISATIONEN 9.4. ZUSAMMENSETZUNG ...................................... 8 MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT ..................... 2 § 10. DER ERWEITERTE BUNDESVORSTAND 8 § 2. GRUNDSÄTZE DER ORGANISATION (PARTEI) 2 10.1. ALLGEMEINES ............................................. 8 § 3. AUFBRINGUNG DER FINANZIELLEN MITTEL 2 10.2. ZUSAMMENSETZUNG, TERMINISIERUNG, 3.1. FINANZIERUNG ............................................. 2 HÄUFIGKEIT DER SITZUNGEN ................................. 9 § 4. FINANZIELLE OFFENLEGUNG 2 10.3. VORSITZ .................................................... 9 10.4. AUßERORDENTLICHE SITZUNGEN ................... 9 § 5. MITGLIEDSCHAFT 3 10.5. BESCHLUSSFÄHIGKEIT, ANTRAGSRECHT 5.1. MITGLIEDSCHAFT .......................................... 3 STIMMRECHT ....................................................... 9 5.2. BEITRITT, MITGLIEDSBEITRÄGE, RECHTE .......... 3 10.6. AUFGABEN ................................................ -

25 Jahre Grüne Erfolgsgeschichte Inhalt
25 JAHRE GRÜNE ERFOLGSGESCHICHTE INHALT VorWort 5 Grüne ERFOLGSGESCHICHTEN TEIL 1 01 Umweltschutz wird zur Institution 6 02 Österreich bleibt frei von Gentechnik 8 03 Tierschutz ist Gesetz – und zwar ein bundesweit einheitliches 10 04 Die Landwirtschaft wird grün(er) 12 05 Green Jobs 14 06 Atomkraft? Nein Danke! 16 07 Grüner Strom für Österreich 18 Grüne Pionierinnen 20 Grüne ERFOLGSGESCHICHTEN TEIL 2 08 „Alle Neune!“ – Grüne in allen Landtagen 22 09 Wir leben die Quote 24 10 Abschaffung der PolitikerInnenpensionen 26 11 Barrierefreiheit für alle 28 12 Finanztransaktionssteuer entwaffnet SpekulantInnen 30 13 BürgerInnenpartizipation und BürgerInnenfinanzierung 32 14 Diese 25 Grünen Erfolge wurden in einem gemeinsamen Workshop erarbeitet, AufdeckerInnen der Nation 34 zu dem alle (Ex-)Abgeordneten und MitarbeiterInnen eingeladen waren. 15 Stoppt die Rechten 36 16 Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure 38 AutorInnen Marlies Meyer, Lukas Hammer, Jens Karg, Brigid Weinzinger, 17 Kunstrückgabe 40 Alexander Van der Bellen, Judith Neyer, Gerhard Jordan, Anita Bernroitner, 18 Ausbau der Demokratie in der EU 42 Felix Ehrnhöfer, Gabi Stauffer, Josef Meichenitsch, Monika Feigl-Heihs, 19 Bleiberecht wird Gesetz 44 Wolfgang Niklfeld, Lukas Wurz, Thomas Geldmacher, Hannes Metzler, 20 Jakob Redl, Eike Pressinger, Ewa Dziedzic, Esther Lurf Grüne Grundsicherung: Aufbruch in das Sozialsystem der Zukunft 46 21 Bundespflegegeldgesetz 48 IMpressUM 22 Eingetragene PartnerInnenschaft 50 Herausgeber Die Grünen, Rooseveltplatz 4 – 5, 1090 Wien, www.gruene.at; 23 Getrennter Ehename 52 Grüner Klub im Parlament, 1017 Wien 24 Wählen ab 16 54 Redaktion Sumaya Musa, Reinhard Pickl-Herk, Doris Schmidauer, Walter Schmidt, 25 Abschaffung der Studiengebühren 56 Marlene Sindhuber, Martin Radjaby, Johanna Stögmüller, Jonas Vogt Redaktionsschluss November 2011 Grafische Gestaltung Super-Fi, 1040 Wien FotoiMpressionen 58 Druck Druckerei Janetschek, Gußhausstr. -

Die Grüne Haltung Zur Europäischen Integration“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Vom Widerstand zur Wende: Die Grüne Haltung zur Europäischen Integration“ Verfasser Gerald John angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuerin / Betreuer: Univ.-Doz. Dr. Siegfried Mattl Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung 6 1.1. Vorwort 6 1.2. Inhalt und Aufbau der Arbeit 8 1.3. Quellenlage 9 1.4. Interviews mit Grün-Politiker(inne)n 11 1.5. Zur Methodik der Leitfadeninterviews 12 1.5.1. Vorteile des qualitativen Ansatzes 12 1.4.2. Zur Form des Leitfadeninterviews 13 2. Die Geschichte der europäischen Integration im Überblick 16 3. Österreich und die europäische Integration 22 4. Vorgeschichte und Wurzeln der Grünen in Österreich 27 4.1. Rahmenbedingungen 27 4.1.1. Der ökologische Boom 27 4.1.2. Wertewandel – eine „stille Revolution“ 28 4.1.3. Neue Soziale Bewegungen 29 4.1.4. Gesellschaft und Politik im Strukturwandel 31 4.1.5. Die These von der zweiten Moderne 32 4.2. Die Vorläufer der Grünen Parteien 34 4.3. Sternstunde I: Zwentendorf und die Anti-AKW-Bewegung 35 4.4. Zersplitterung: Alternative, Autonome und kommunalpolitische Pioniere 38 4.5. VGÖ und ALÖ: Zwei Parteien ringen um die Hegemonie 40 4.6. Sternstunde II: Hainburg 42 4.7. Einigungsprozess und Einzug in den Nationalrat 45 4.8. Die Grüne Alternative: Ein turbulenter Einstieg ins Establishment 47 4.9. Neubeginn und Professionalisierung 50 5. Grüne EU-Skepsis –Traditionen, Bilder, Ideologien 55 5.1. „Small is beautiful“: Die EU als zentralistischer Moloch 55 5.2. Kapitalismuskritik: Die EU als Wachstumsmonster 62 2 5.2.1. -

Grüne Sprossen - Alternative Blüten Beinharte Konkurrenzkmpfe, Stimmrecht Um 30 Schilling, Herzinfarkt, Klubausschluß – Die Geburtswehen Der Grünen
The political party was founded in . They want to save the nature and they are against atomic power plants in and next to Austria. The party is represented in the European Parliament by 12 MEP's and in the national Parliament Bundestag by 47 MP's. Five out of 16 regions do not have Green parliamentarians. In these five East Germany regions, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN did not make the 5% threshold. Overcoming the difference in the performance between East and West due to the specific situation of the East is one of the major challenges in the near future. In 1999 all of the East-German regions will have elections. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN will then have to show, that they do not only succeed in West-Germany. NR-Wahl: ERGEBNISSE DER GRÜNEN 1986 - 1999 Stimmen, Prozente, Mandate bei Nationalrats- und EU-Wahlen Die Ergebnisse der Grünen bei den Nationalratswahlen seit 1986 (1995 inkl. Wiederholungswahl vom 13. Oktober 1996, bei der ein Mandat von der ÖVP zur FPÖ gewandert ist) und bei den EU-Wahlen 1996 und 1999: STIMME PROZEN MANDAT JAHR +/- N T E 1986 234.028 4,8 8 1990 225.084 4,8 10 1994 338.538 7,3 +2,5 13 1995 233.208 4,8 -2,5 9 1999 310.682 7,4 +2,6 14 EU-Wahlen: 1996 258.250 6,8 1 1999 260.273 9,3 +2,5 2 Grüne Sprossen - alternative Blüten Beinharte Konkurrenzkmpfe, Stimmrecht um 30 Schilling, Herzinfarkt, Klubausschluß – die Geburtswehen der Grünen. Von Gregor Matjan Eine heiße Viertelstunde – mehr war 1968 in Österreich nicht. -
Mitglieder BV Seit 1987
Mitglieder des Bundesvorstandes der Grünen seit 1987 13.9.2010 – dato Eva GLAWISCHNIG, Bundesssprecherin Werner KOGLER, Stv. Bundessprecher Stefan WALLNER, Bundesgeschäftsführer Andreas PARRER, Bundesfinanzreferent Peter PILZ Sigrid PILZ Johannes RAUCH Maria VASSILAKOU, Stv. Bundesssprecherin Daniela GRAF für die GBW 18.1. 2009 – 12.9.2010 Eva GLAWISCHNIG, Bundesssprecherin Michaela SBURNY, Bundesgeschäftsführerin (bis Dez. 2009) Stefan WALLNER, Bundesgeschäftsführer (ab Jänner 2010) Andreas PARRER, Bundesfinanzreferent Werner KOGLER, Stv. Bundessprecher Peter PILZ Sigrid PILZ Johannes RAUCH Maria VASSILAKOU, Stv. Bundesssprecherin Daniela GRAF für die GBW 4.5. 2008 – 17.1.2009 Alexander VAN DER BELLEN, Bundessprecher Michaela SBURNY, Bundesgeschäftsführerin Andreas PARRER, Bundesfinanzreferent Eva GLAWISCHNIG, Stv. Bundesssprecherin Werner KOGLER Peter PILZ Maria VASSILAKOU, Stv. Bundesssprecherin Karl ÖLLINGER für den Grünen Parlamentsklub Daniela GRAF für die GBW 4.3. 2006 – 3.5.2008 Alexander VAN DER BELLEN, Bundessprecher Michaela SBURNY, Bundesgeschäftsführerin Friedrich KOFLER, Bundesfinanzreferent Eva GLAWISCHNIG Stv. Bundesssprecherin Georg WILLI Ingrid LECHNER-SONNEK Maria VASSILAKOU Madeleine PETROVIC, kooptiert, Stv. Bundessprecherin Karl ÖLLINGER für den Grünen Parlamentsklub Daniela GRAF für die GBW 24.01.2004 - 4.3. 2006 Alexander VAN DER BELLEN, Bundessprecher Franz FLOSS, Bundesgeschäftsführer bis 25.06.2004 Michaela SBURNY, Bundesgeschäftsführerin ab 25.06.2004 Friedrich KOFLER, Bundesfinanzreferent Eva GLAWISCHNIG Margarethe -

Vienna, 2004 with Support from This Book Has Been Edited And
innen.qxd 17.11.04 10:25 Seite 1 This book has been edited and sponsored by... Die Grüne Bildungswerkstatt (Austrian Green Foundation) Neubaugasse 8 with support from A-1070 Vienna, Austria Heinrich Böll Stiftung phone: +43-1/526 91 11 Rosenthaler Str. 40/41 E-Mail: [email protected] D-10178 Berlin, Germany Web: http://www.gbw.at phone: +49-30/285 34-0 E-Mail: [email protected] Web: http://www.boell.de Contact addresses of the organizers of the Vienna meeting: European Green Party/EFGP rue Wiertz 31 B-1050 Brussels, Belgium phone: +32-2/284 66 77 E-Mail: [email protected] Web: http://www.europeangreens.org/ Grüner Klub im Rathaus Rathaus The Greens/European A-1082 Vienna, Austria Free Alliance in the EP phone: +43-1/4000 81832 European Parliament E-Mail: [email protected] rue Wiertz [email protected] B-1047 Brussels, Belgium Web: http://wien.gruene.at phone: +32-2/284 30 44 E-Mail: [email protected] Web: http://www.greens-efa.org Editorial office, translation, photos: Christine Côte, Norbert Fischer, Daniela Graf, Gerhard Jordan, Andrew Kilpatrick, Gerhard Ladstätter, Monika Vana, Barbara and Marco Vanek. Layout: Otto Fritsch, Printed by: Donau Forum, A-1120 Vienna. Vienna, 2004 innen.qxd 17.11.04 10:25 Seite 2 2nd European Meeting of Green Local Councillors "Greening the Cities in the European Union" Vienna, December 5th - 7th, 2003 TABLE OF CONTENTS Foreword by Monika Vana 4-5 (City councillor, Die Grünen Vienna, Deputy chair of the Green Group) Welcome addresses by Eva Glawischnig (MP, Die Grünen Austria), 6-10 Arnold Cassola (Secretary General of EFGP), Monika Vana (Die Grünen Vienna) and Monica Frassoni (MEP, co-chair of the Greens/EFA Group) Presentation of the panel "Greens govern European Cities" 11 Participants of the Vienna meeting. -
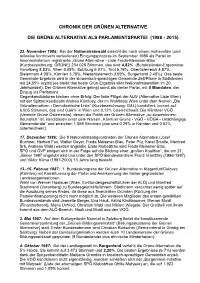
1986 Bis 2015, Stand: Juni
CHRONIK DER GRÜNEN ALTERNATIVE DIE GRÜNE ALTERNATIVE ALS PARLAMENTSPARTEI (1986 - 2015) 23. November 1986: Bei der Nationalratswahl erreicht die nach einem mühevollen (und teilweise kontrovers verlaufenen) Einigungsprozess im September 1986 als Partei im Innenministerium registrierte „Grüne Alternative - Liste Freda-Meissner-Blau“ (Kurzbezeichnung: GRÜNE) 234.028 Stimmen, das sind 4,82% (Bundesländer-Ergebnisse: Vorarlberg 8,83%, Wien 6,09%, Salzburg 5,91%, Tirol 5,76%, Oberösterreich 4,87%, Steiermark 4,08%, Kärnten 3,78%, Niederösterreich 3,59%, Burgenland 2,48%). Das beste Gemeinde-Ergebnis wird in der slowenisch-sprachigen Gemeinde Zell/Pfarre in Südkärnten mit 24,55% erzielt (es bleibt das beste Grün-Ergebnis aller Nationalratswahlen im 20. Jahrhundert). Der Grünen Alternative gelingt somit als vierter Partei, mit 8 Mandaten, der Einzug ins Parlament. Gegenkandidaturen bleiben ohne Erfolg: Der linke Flügel der ALW (Alternative Liste Wien) mit der Spitzenkandidatin Andrea Komlosy, der im Wahlkreis Wien unter dem Namen „Die Grünalternativen - Demokratische Liste“ (Kurzbezeichnung: GAL) kandidiert, kommt auf 6.005 Stimmen, das sind 0,66% in Wien und 0,12% österreichweit. Die Kärntner VGÖ (Vereinte Grüne Österreichs), denen die Politik der Grünen Alternative „zu slowenInnen- freundlich“ ist, kandidieren unter dem Namen „Kärntner Grüne - VGÖ - VÖGA - Unabhängige Gemeinderäte“ und erreichen 1.059 Stimmen (das sind 0,29% in Kärnten und 0,02% österreichweit). 17. Dezember 1986: Die 8 Nationalratsabgeordneten der Grünen Alternative (Josef Buchner, Herbert Fux, Walter Geyer, Freda Meissner-Blau, Peter Pilz, Karel Smolle, Manfred Srb, Andreas Wabl) werden angelobt. Erste Klubobfrau wird Freda Meissner-Blau. SPÖ und ÖVP einigen sich in der Folge auf die Bildung einer „großen Koalition“, die am 21. -

Forschungsbericht No. 11 ORF Sommergespräche
Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung Institute for Comparative Media and Communication Studies (CMC) Österreichische Akademie der Wissenschaften | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Forschungsbericht No. 11 ORF Sommergespräche: Strategien, Images und Themen im politischen Fernsehinterview – Kategorienschema und Codieranweisung zur standardisierten, quantitativen Inhaltsanalyse finanziert von der Kulturabteilung der Stadt Wien Postgasse 7/4/1 1010 Wien, Österreich Tel. +43 1 51581-3110 Fax +43 1 51581-3120 [email protected] www.oeaw.ac.at/cmc Bankverbindung: © Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung UniCredit Bank Austria AG BLZ 11000 IBAN: AT541100000262650519 BIC Code: BKAUATWW Wien 2018 Empfohlene Zitierung: Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung (2018). ORF Sommergespräche: Strategien, Images und Themen im politischen Fernsehinterview – Kategorienschema und Codieranweisung zur standardisierten, quantitativen Inhaltsanalyse. CMC-Forschungsberichte, No. 11. Wien: Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung. ORF Sommergespräche: Strategien, Images und Themen im politischen Fernsehinterview – Kategorienschema und Codieranweisung zur standardisierten, quantitativen Inhaltsanalyse 1. Formale Festlegungen 1.1. Untersuchungsgegenstand Es werden die im ORF in den Jahren 1982 bis 2012 ausgestrahlten politischen Interviewsendungen („Politik am Freitag“, „Inlandsreport“, „Anders gefragt“, „Zur Sache“ „Sommergespräche“) codiert.1 1.2. Analyseeinheit Analyseeinheit -

The Emergence and Electoral Success of Green Parties in Austria, Britain and the Netherlands
Rethinking Green Parties: The Emergence and Electoral Success of Green Parties in Austria, Britain and the Netherlands A Dissertation Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy University of Sheffield Mark Williams Faculty of Social Sciences Department of Politics August 1999 Abstract The proliferation of green parties on the European political landscape in recent decades has prompted much debate concerning the explanation of their emergence and the factors considered to influence their varying levels of electoral success. This thesis critically examines a number of perspectives and concepts drawn from the sociological and political studies literatures which shed light on these two key issues. Through a comparison of green party politics in Austria, Britain and the Netherlands, the thesis challenges the assessment of those who maintain that the emergence and/or electoral success of green parties can be understood principally in terms of the theory of 'post-materialist' value change, or in terms of the shift to 'post-industrial' society. Drawing on contemporary studies of 'high-consequence' risks, it argues for an alternative approach to understanding the emergence of green parties which is rooted in processes of social and global environmental change that have taken place during the post-war period. The question of green party electoral success is examined by means of the organisation of a variety of political and institutional factors into four overarching themes: political state-institutional structures, electoral dealignment and political competition, modes of interest representation, and internal dynamics. It is contended that attention to each of these can yield important insights into the conditions which have impacted on the electoral significance of green parties in Austria, Britain and the Netherlands. -

Einfluss Von Social Media Auf Die Mediale Berichterstattung Der „Alten Medien“ Am Beispiel Des Österreichischen Nationalratswahlkampfes 2013
Bernhard Pekari Einfluss von Social Media auf die mediale Berichterstattung der „alten Medien“ am Beispiel des österreichischen Nationalratswahlkampfes 2013 Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Master of Arts im Rahmen des Universitätslehrgangs “Medienlehrgang“ Univ.-Prof. Dr. Manfred Prisching Karl-Franzens-Universität Graz und UNI for LIFE Graz, Mai 2014 1 Ehrenwörtliche Erklärung (Eigenständigkeitserklärung): „Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet und die den benützten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.“ Graz, Mai 2014 ____________________________ Bernhard Pekari 2 ABSTRACT Der Nationalratswahlkampf 2013 war der erste, in dem Social Media, insbesondere Facebook und Twitter, eine relevante Rolle spielte. Die vorliegende Arbeit geht primär der Frage nach, wie die klassischen Medien, vor allem der Printbereich, auf diese Entwicklung reagiert haben und wie sich der Social-Media-Auftritt der wahlwerbenden Parteien in der Nationalratswahlkampf-Berichterstattung der „alten“ Medien niedergeschlagen hat. Anhand der in der Arbeit dargelegten Fallstudie zeigt sich, dass man die Medienresonanz über die Social Media-Auftritte der Parteien (und der Politikerinnen und Politiker) grundsätzlich in folgende Gruppen einteilen kann: - Skandale, beziehungsweise Skandalisierungen und Aufgeregtheiten - bewusstes Agenda Setting der Parteien - Analysen und Rankings - indirekte -

Geschichte Gruenechronik
CHRONIK DER GRÜNEN ALTERNATIVE DIE GRÜNE ALTERNATIVE ALS PARLAMENTSPARTEI (1986 - 2015) 23. November 1986: Bei der Nationalratswahl erreicht die nach einem mühevollen (und teilweise kontrovers verlaufenen) Einigungsprozess im September 1986 als Partei im Innenministerium registrierte „Grüne Alternative - Liste Freda-Meissner-Blau“ (Kurzbezeichnung: GRÜNE) 234.028 Stimmen, das sind 4,82% (Bundesländer-Ergebnisse: Vorarlberg 8,83%, Wien 6,09%, Salzburg 5,91%, Tirol 5,76%, Oberösterreich 4,87%, Steiermark 4,08%, Kärnten 3,78%, Niederösterreich 3,59%, Burgenland 2,48%). Das beste Gemeinde-Ergebnis wird in der slowenisch-sprachigen Gemeinde Zell/Pfarre in Südkärnten mit 24,55% erzielt (es bleibt das beste Grün-Ergebnis aller Nationalratswahlen im 20. Jahrhundert). Der Grünen Alternative gelingt somit als vierter Partei, mit 8 Mandaten, der Einzug ins Parlament. Gegenkandidaturen bleiben ohne Erfolg: Der linke Flügel der ALW (Alternative Liste Wien) mit der Spitzenkandidatin Andrea Komlosy, der im Wahlkreis Wien unter dem Namen „Die Grünalternativen - Demokratische Liste“ (Kurzbezeichnung: GAL) kandidiert, kommt auf 6.005 Stimmen, das sind 0,66% in Wien und 0,12% österreichweit. Die Kärntner VGÖ (Vereinte Grüne Österreichs), denen die Politik der Grünen Alternative „zu slowenInnen- freundlich“ ist, kandidieren unter dem Namen „Kärntner Grüne - VGÖ - VÖGA - Unabhängige Gemeinderäte“ und erreichen 1.059 Stimmen (das sind 0,29% in Kärnten und 0,02% österreichweit). 17. Dezember 1986: Die 8 Nationalratsabgeordneten der Grünen Alternative (Josef Buchner, Herbert Fux, Walter Geyer, Freda Meissner-Blau, Peter Pilz, Karel Smolle, Manfred Srb, Andreas Wabl) werden angelobt. Erste Klubobfrau wird Freda Meissner-Blau. SPÖ und ÖVP einigen sich in der Folge auf die Bildung einer „großen Koalition“, die am 21. -

Stenographisches Protokoll
Stenographisches Protokoll 21. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich XXIV. Gesetzgebungsperiode Dienstag, 19. Mai 2009 1 Stenographisches Protokoll 21. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich XXIV. Gesetzgebungsperiode Dienstag, 19. Mai 2009 Dauer der Sitzung Dienstag, 19. Mai 2009: 9.05 – 23.20 Uhr ***** Tagesordnung 1. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das KommAustria-Gesetz, das Presseförderungs- gesetz 2004, das Volksgruppengesetz, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das Außerstreitgesetz, die Exekutionsordnung, das Gebührenanspruchsgesetz, das Ge- richtliche Einbringungsgesetz 1962, das Gerichtsgebührengesetz, das Allgemeine Grundbuchsgesetz 1955, das Grundbuchsumstellungsgesetz, die Jurisdiktionsnorm, das Sachwalterrechts-Änderungsgesetz 2006, das Urkundenhinterlegungsgesetz, die Zivilprozessordnung, das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 1975, das Ju- gendgerichtsgesetz 1988, das Staatsanwaltschaftsgesetz, das Bewährungshilfegesetz, das Strafvollzugsgesetz, das Rechtspraktikantengesetz, das Bundeshaushaltsgesetz, das Bundesgesetz, über die Refinanzierung von Tätigkeiten der Austria Wirt- schaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das Finanzmarktstabilitäts- gesetz, das Poststrukturgesetz, das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaft- steuergesetz 1988, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Stiftungseingangssteuerge- setz, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, das Gebührengesetz 1957, das Grunderwerbsteuergesetz 1987,