Geschichte Der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Archivnachrichten 45 (2012)
LANDESARCHIV BADEN-WÜRTTEMBERG Nr. 45 / September 2012 ARCHIVNACHRICHTEN Architektenträume Ein kleines Versailles Baudenkmale im Bild Schätze aus der württembergischen Kunstkammer Architektenträume unter dem Skalpell Inhalt Regina Keyler Elke Koch Christine Axer 3 || Editorial 25 || Wie man Traumschlösser 38 || Heimerziehung in Baden-Würt- praktisch baut. Die Überlieferung der temberg 1949 – 1975. Archivrecherchen ARCHITEKTENTRÄUME Baugewerkeschule in Stuttgart und historische Aufarbeitung Konrad Krimm Stephan Molitor QUELLEN GRIFFBEREIT 4 || Architektenträume 27 || Baudenkmale im Bild. Die Glasplattensammlung des Landes- Sibylle Brühl Erwin Frauenknecht amts für Denkmalpflege 40 || An Bord der SMS Elisabeth. 7 || Gotische Baurisse im deutschen Tagebuchaufzeichnungen 1884–1886 Südwesten Birgit Meyenberg eines Marineoffiziers 28 || Avantgarde in Hohenzollern. Kurt Andermann Entwürfe des Architekten Martin Elsaes- Niklas Konzen 9 || Fürst – Achse – Planstadt. ser für den Fürsten von Hohenzollern 42 || Schätze aus der württembergischen Rastatt, Karlsruhe und Mannheim 1948 Kunstkammer. Ein Erschließungsprojekt zu den Ursprüngen des Landesmuseums Peter Müller Jürgen Treffeisen 10 || Kampf ums Rathaus. 29 || Die Post im Dorf. Die Plan- KULTURGUT GESICHERT Balthasar Neumanns Tätigkeit für den sammlung der Deutschen Bundespost Fürstpropst von Ellwangen im Generallandesarchiv Karlsruhe Cornelia Bandow 44 || Architektenträume unter dem Martina Heine Claudia Wieland Skalpell. Risse und Planzeichnungen als 12 || Ein kleines Versailles in Wertheim. -

Informationen Zur Raumentwicklung, Heft 1.2014
Informationen zur Raumentwicklung Heft 1.2014 49 Jens Imorde Shoppen ja, aber nur nicht im Warenhaus!? Rolf Junker Warenhäuser stehen seit einigen Jahrzehn triebstyp durch den Ersten Weltkrieg. Er ten unter einem erheblichen Wettbewerbs schnitt Deutschland von Warenlieferungen druck. Die Anteile am Einzelhandelsumsatz aus dem Ausland ab, führte zu sinkenden sinken kontinuierlich, und dementspre Bevölkerungszahlen und mündete letzt chend mussten viele Häuser schließen und lich in einer Weltwirtschaftskrise. Massive sogar einige Konzerne ganz aufgeben. We Umwälzungen in der Eigentumssituation gen der großen Bedeutung für die Entwick sind dann in Folge der Machtübernah lung der städtischen Zentren ist diese Pro me der Nationalsozialisten festzumachen. blematik auch stets Gegenstand politischer Da „jüdische Kaufleute und Unternehmer und planerischer Diskussionen gewesen. im Handel eine gewichtige Rolle spielten, Um die aktuellen Tendenzen und die Zu konnten aus dieser Tatsache heraus leicht kunftsfähigkeit der Warenhäuser besser ein Generalisierungen formuliert werden: Das ordnen zu können, lohnt sich zunächst ein Warenhaus selbst wurde zur jüdischen Blick auf die Entstehung und Entwicklung Einrichtung“ (Strohmeyer 1980: 155) und dieser besonderen Betriebsform und Han die Unternehmen nach und nach „arisiert“ delsarchitektur. Der folgende Aufsatz geht (ausführlich hierzu LadwigWinters 1997). auch auf die derzeitigen Entwicklungen ein Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu ei und betrachtet zudem die Rolle der Städte ner neuen Blütezeit der Warenhäuser (vgl. in den zu beobachtenden Umstrukturie von Schwanenflug 2013: o. S.). „Im Span rungsprozessen. nungsfeld zwischen Wiederaufbau und städtebaulichem Neubeginn im Sinne einer funktional gegliederten und aufgelockerten 1 Blüte und Niedergang sowie autogerechten Stadt bildeten die Wa der Warenhäuser renhäuser wichtige Fixpunkte in der City“ (PumpUhlmann 2011: 11). -

Abs, Clemens, 100, 103, 105 Abs, Hermann Josef, 7, 8, 17–18, 30
Cambridge University Press 0521803292 - The Deutsche Bank and the Nazi Economic War Against the Jews: The Expropriation of Jewish-Owned Property Harold James Index More information Index Abs, Clemens, 100, 103, 105 Aryan Clothing Manufacturers), Abs, Hermann Josef, 7, 8, 17–18, 30, 59, 60 66, 71, 74–77, 91, 99, 189, 217 Adler, Alfred, 98 and Adler & Oppenheimer, 92–98, Adler, Anna Luise, 98 160 Adler, family, 90, 95, 99, 120, and Böhmische Union Bank, 140, 215–216 144, 157, 160, 216 Adler, Hans, 90 and Creditanstalt-Bankverein, Adler & Oppenheimer, 38, 82, Wien, 131–35, 140 87–88, 90–94, 98–99, 160, 208 as partner of Delbrück Schickler & AEG, 12 Co., 86, 87, 105 Agraria Vermögensverwaltungs AG, becomes Director of Deutsche 146 Bank, 29 Ahlmann, Wilhelm, 105–106 moral responsibility of, 215 Air Ministry, 52 and Petschek, 100–104 Almy, 91, 94–95, 98 and postwar restitution Amann, Max, 48–49 negotiations, 89–90, 102–104 Allalemjian, Mirham, 124 and views on profits, 213 Allgemeine Deutsche Creditanstalt and Salamander, 86–90 (see ADCA) and Suhrkamp, 105, 106, 110 Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft Abs, Josef, 100, 101 (see AEG) Abshagen, Otto, 78 Allgemeine Handels- und ACM, 77, 80, 81 Creditbank, 180 ADCA, 144 Allgemeiner Jugoslawischer Adefa (Arbeitsgemeinschaft deutsch- Bankverein, 135 arischer Allgemeiner Polnischer Bankverein, Konfektionsfabrikanten, or 187 Working Group of German- Amsterdamsche Bank, 94, 255 © Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 0521803292 - The Deutsche Bank and the Nazi Economic War Against the Jews: The Expropriation of Jewish-Owned Property Harold James Index More information INDEX Amsterdamsche Crediet Bandeisen + Blechwalzwerke AG Maatschappij (see ACM) Karlshütte, 176 N.V. -

Warenhaus-Wertheim
Potsdam, der 26.01.2016 Fachhochschule Potsdam Fachbereich 3 Bauingenieurwesen Ingenieurprojekt WS 15/16 Warenhaus Wertheim Bauen im Inland Archivrecherche im: „Bildarchiv der Philipp Holzmann AG“ Betreut durch: Prof. Dr. phil. A. Kahlow Josephine Merten Johannes Andrä Inhaltsverzeichnis II Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ............................................................................................... II Abbildungsverzeichnis ....................................................................................... III 1 Entwicklung der Warenhäuser ....................................................................... 4 1.1 Entwurfsmerkmale und Baugeschichtliche Wurzeln ............................ 6 1.2 Baubestimmungen ........................................................................... 7 1.3 Baubestimmungen nach 1945 ............................................................ 9 2 Familie Wertheim ....................................................................................... 10 2.1 Anfänge in Strahlsund .................................................................... 10 2.2 Aufschwung in Berlin .................................................................... 14 2.3 Enteignung während des II. Weltkrieges .......................................... 22 3 Bau des Warenhauses in Steglitz .................................................................. 27 3.1 Entwurf ........................................................................................ 28 3.2 Ausführung .................................................................................. -

Verblasster Glanz – Das Ende Der Warenhausherrlichkeit
SÜDWESTRUNDFUNK SWR2 Wissen – Manuskriptdienst Verblasster Glanz – das Ende der Warenhausherrlichkeit Autor: Helmut Frei Regie: Günter Maurer Redaktion: Udo Zindel Sendung: Dienstag, 27. Oktober, 8.30 Uhr, SWR2 Wissen ____________________________________________________________ Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Mitschnitte auf CD von allen Sendungen der Redaktion SWR2 Wissen/Aula (Montag bis Sonntag 8.30 bis 9.00 Uhr) sind beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden für 12,50 € erhältlich. Bestellmöglichkeiten: 07221/929-6030 _________________________________________________________________ SWR 2 Wissen können Sie ab sofort auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de __________________________________________________________________ Seite 1 von 11 ATMO: Hertie-Song Ansage: Verblasster Glanz – das Ende der Warenhausherrlichkeit. Eine Sendung von Helmut Frei. Sprecherin: 15. August 2009. An diesem Samstag schlossen die letzten Hertie-Warenhäuser in Deutschland. Der Hertie-Song, der die Beschäftigten zu Höchstleistungen an der Verkaufsfront anstacheln sollte, hatte ausgedient. Sprecher: Das Ende kam nicht überraschend. Das Angebot der Warenhauskette wirkte nach Ansicht vieler Konsumenten genauso altbacken wie die Einrichtung. Junge Leute fanden kaum noch den Weg zu Hertie. Die Insolvenz des Unternehmens war nicht abzuwenden. Bereits in den Jahren davor hatte das Unternehmen Standorte aufgegeben. Anfang 2009 waren noch 63 Hertie-Filialen übrig. Dass auch kleine, familiengeführte Warenhaus-Firmen kapitulieren müssen, ist oft nur eine Randnotiz in einer Regionalzeitung wert. Im Brennpunkt stehen die Großen der Branche wie Karstadt. Nun steht auch der einst führende Warenhaus-Konzern Europas unter dem Regiment eines Insolvenzverwalters. Nach dessen Auffassung sind derzeit 19 von insgesamt 90 Karstadt-Filialen in ihrer Existenz bedroht. -
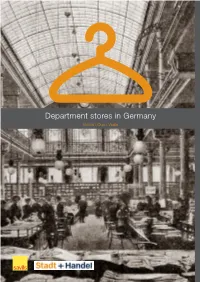
Department Stores in Germany Status I Quo I Vadis
Department stores in Germany Status I Quo I Vadis 01 Foreword Quo vadis, department stores? The as well as the competition structure The study is particularly intended for title of this study reflects the prevailing and potential demand in the retail and practical use in everyday work. The body uncertainty surrounding the future of property sectors. of data presented can also act as an the department store. For decades, essential reference work. department stores have represented This is why, in summer 2015, Savills local retail leaders and main draws in and Stadt+Handel compiled store data We hope that the study will assist you with many town and city centres. In recent on Karstadt and Kaufhof properties, your discussions and decision-making times, however, department stores in analysed this data and evaluated it processes. Germany have lost significant market via a scoring process. The outcome share and whether the store closures is the present study, which provides over the last decade should be a bird‘s eye view of the situation and regarded as consolidation or as erosion structures the department store stock is a matter of perspective. in terms of location and property- related conditions. The scoring results Both the type of property and quality and tools presented in the study can be of location cover a broad spectrum. used by owners and retailers, investors From flagship store to local supplier: and developers and even local who will „draw the short straw“ in the authorities and expansionists to gain Ralf Beckmann Silke Wittig competition against other formats a good impression of future options Stadt + Handel Stadt + Handel and the Internet? Where does strong for the individual stores. -

Jewish Women As Employees and Consumers in German Department Stores
German Studies Faculty Publications German Studies 2013 Kosher Seductions: Jewish Women as Employees and Consumers in German Department Stores Kerry Wallach Gettysburg College Follow this and additional works at: https://cupola.gettysburg.edu/gerfac Part of the German Language and Literature Commons, and the History of Gender Commons Share feedback about the accessibility of this item. Recommended Citation Wallach, Kerry. “Kosher Seductions: Jewish Women as Employees and Consumers in German Department Stores.” In Das Berliner Warenhaus: Geschichte und Diskurse/The Berlin Department Store: History and Discourse, eds. Godela Weiss-Sussex and Ulrike Zitzlsperger, 117-137. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. This is the publisher's version of the work. This publication appears in Gettysburg College's institutional repository by permission of the copyright owner for personal use, not for redistribution. Cupola permanent link: https://cupola.gettysburg.edu/gerfac/19 This open access book chapter is brought to you by The Cupola: Scholarship at Gettysburg College. It has been accepted for inclusion by an authorized administrator of The Cupola. For more information, please contact [email protected]. Kosher Seductions: Jewish Women as Employees and Consumers in German Department Stores Abstract Department stores have long been associated with the trope of seducing female consumers, at least since the publication of Emile Zola’s novel Au bonheur des dames in 1883. This fictionalized portrayal of the Parisian department store Bon Marche, which has exerted considerable influence among early chroniclers of department store culture, identifies store owners as men who build ‘temples’ for prospective customers, and who use inebriating tactics to encourage them to enter and spend money. -

Claims Resolution Tribunal
CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL In re Holocaust Victim Assets Litigation Case No. CV96-4849 Certified Award to Claimant [REDACTED 1] also acting on behalf of [REDACTED 2] in re Accounts of Hermann Tietz & Co., Georg Tietz, Martin Tietz and Grundwert Aktiengesellschaft Kaiserdamm Claim Number: 209429/RS1 Award Amount: 757,000.00 Swiss Francs This Certified Award is based upon the claim of [REDACTED 1] (the Claimant ) to the account of Georg Tietz.2 This Award is to the unpublished accounts of Hermann Tietz & Co. ( Account Owner Hermann Tietz ), the unpublished accounts of Georg Tietz ( Account Owner Georg Tietz ), the unpublished accounts of Martin Tietz ( Account Owner Martin Tietz ), and the unpublished account of Grundwert Aktiengesellschaft Kaiserdamm ( Account Owner Grundwert ) and Hermann Tietz & Co. (together, the Account Owners ) at the [REDACTED] (the Bank ). The accounts awarded are from the Total Accounts Database ( TAD ) at the Bank. All awards are published, but where a claimant has requested confidentiality, as in this case, the names of the claimant, any relatives of the claimant other than the account owner, and the bank have been redacted. Information Provided by the Claimant The Claimant submitted a Claim Form identifying Account Owner Georg Tietz as his father Georg Tietz, Account Owner Martin Tietz as his paternal uncle Martin Tietz, and Account Owner Hermann Tietz as the network of Hermann Tietz department stores founded by his grandfather [REDACTED], and later co-owned by his father Georg Tietz and his uncle Martin Tietz. The Claimant indicated that his father, Georg Tietz, was born in Gera, Germany on 10 January 1889, and that he was the son of [REDACTED] and [REDACTED], née [REDACTED]. -

Aktuell Feiert Nr
12. 2017 | No. 100 from and about berlin aAUS UNDk ÜBERt BERLINu ell Jubiläum: aktuell feiert Nr. 100 Anniversary: aktuell celebrates No 100 Filmpremiere: Dritte Generation: „Alte Dame“: „Die Unsichtbaren – My Journey to Berlin 125 Jahre Hertha BSC Wir wollen leben“ Third generation: “Old Lady”: Film première: My journey to Berlin 125 years of Hertha BSC “The Invisible – We Want to Live” INHALT CONTENTS Hertha BSC wird 125 und entdeckt den Mannschaftsarzt Dr. Horwitz wieder Celebrating its 125th anniversary, Hertha BSC remembers its former team doctor Notes of Berlin – eine Hermann Horwitz Hommage an all die 16 Notizen, die Berlin tagtäglich im Stadtbild hinterlässt A homage to all the notes and signs left every day in Berlin’s cityscape „Die Unsichtbaren“ – ein Kinofilm über vier junge Jüdinnen und 58 Juden, die das Dritte Reich mitten in Berlin überlebten “Die Unsichtbaren” – A feature film about four young Jews who survived the Third Reich right in the heart of Berlin 36 Ihre Briefe an die Redaktion Your letters to the editor 48 Berlin übernimmt für ein Jahr die Bundesratspräsidentschaft Berlin is taking on the presidency of the Federal Council for one year 21 Inhalt Contents 2 Editorial Leserbeiträge Editorial Readers’ Contributions 40 Filmpremiere in Deutschland: Schwerpunkt: Jubiläum „Die Unsichtbaren – Wir wollen leben.“ In Focus: Anniversary Film première in Germany: “The Invisible – We Want to Live” 4 Masal tow! 42 Trotz allem kann ich stolz sagen: Mazal tov! „Ich bin ein Berliner!“ 8 „Liebe ehemalige Mitbürger …“ Despite it all, I can proudly say “Dear former fellow-citizens …” “I am a Berliner!” 12 „Ein Stück Heimat“ – der Kalender 44 My Journey to Berlin: The Presence of History The calendar – “A bit of Heimat” 45 Erinnerungen 14 In eigener Sache: aktuell im neuen Gewand Memories A word from the editor: aktuell in makeover 46 „Berlin bleibt Berlin!“ mode 48 Leserbriefe Berliner Ereignisse Letters to the Editor Life in Berlin 16 „Dr. -

The Attack on Berlin Department Stores (Warenhaeuser) After 1933 Simone Ladwig-Winters
The Attack on Berlin Department Stores (Warenhaeuser) After 1933 Simone Ladwig-Winters Georg Wertheim, the head of one of the four largest German department store chains in the 1920s and 1930s, noted in his diary: "1 January 1937 - the store is declared to be "German.”1 This entry marks the forced end to his activities in the business that he and his family had worked hard to build up. 2 Roots In 1875, Georg's parents, Ida and Abraham Wertheim (who sometimes went by the name Adolf), had opened a modest shop selling clothes and manufactured goods in Stralsund, a provincial town on the Baltic Sea. An extensive network of family members ensured a low-priced supply of goods. In 1876, one year after the shop opened, the two eldest sons Hugo and Georg (aged 20 and 19 respectively), went to work in the shop following their apprenticeships in Berlin. Three younger sons later joined them. The business was called "A. Wertheim" after the father, who increasingly withdrew from active management of the business. Guidelines were introduced into the business that had been known outside of Germany for some time but were innovative in German retailing. These included: "low profit margins with high sales and quick inventory turnover; a broad and varied selection of merchandise; fixed prices (price tags on the goods); viewing of merchandise without a personal, psychological obligation to buy; exchanges - even a right In addition to archival material of the Deutsche Bank, available in the Bundesarchiv, Abt. 1 Postdam (in the meantime moved to Berlin-Lichterfelde) for the first time in the wake of reunification, I was able to use the copy of Georg Wertheim's diary in the Archiv Stuerzebecher (cited in the following as: Wertheim, Diary). -

Kadewe Group Launches Signature Fragrances for Its Premium Stores in Berlin, Hamburg and Munich
Berlin February 2015 Cityscape Kadewe Group launches signature fragrances for its premium stores in Berlin, Hamburg and Munich • 030, 040 and 089 honor the Kadewe store in Berlin, Alsterhaus in Hamburg and Oberpollinger in Munich • The limited edition fragrances were created by Berlin fragrance house Frau Tonis Parfum • The launch reflects the new trends towards Heritage and Patriotism “Three new fragrances commemorate Germany’s most famous luxury department stores and their cities” Demonstrate your love for your city with a signature fragrance According to Mintel Trend, Patriot Games, our feelings of national identity are being subject to major flux and the psychological and economic impact of this is having large-scale consequences on how we think of our cultural identity and how we relate to global, national and local products. Feelings of patriotism and nationalistic pride are coming under threat and are in danger of being diluted. This is creating a counter-trend whereby consumers actively seek to reassert their belief in – and support of – their homeland through their consumer choices. Fragrance shoppers in Germany can now demonstrate their pride in their home cities thanks to Kadewe, Alsterhaus and Oberpollinger launching three signature scents. These are three of Germany’s best-known luxury department stores and each one is an integral part of its city’s civic history. History of Kadewe Berlin’s Kadewe was founded by Adolf Jandorf, owner of the Jandorf chain of department stores. The store first opened its doors in 1907; with some 60,000 sq m of retail space it is considered the biggest department store on the European continent. -

Die Geschichte Der Jüdischen Warenhäuser in Deutschland
Die Geschichte der jüdischen Warenhäuser in Deutschland Von André Krajewski © André Krajewski Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................1 2. Die Geschichte der jüdischen Warenhäuser in Deutschland...............................2 2.1 Gründung und Etablierung der jüdischen Warenhäuser................................2 2.1.1 Die Kleinstadt Birnbaum als „Wiege“ der jüdischen Warenhaustradition .................................................................................3 2.1.2 Eine Kaufmannsfamilie erobert Berlin - Wertheim ...............................3 2.1.3 Die Geburt der Galeria Kaufhof - Leonhard Tietz .................................4 2.1.4 Warenhauspionier und Macher bei HERTIE - Oscar Tietz....................5 2.1.5 Vom Lehrling zum Gründer des KaDeWe - Adolf Jandorf ...................7 2.1.6 Zwei Brüder erobern den Osten – Salman und Simon Schocken ..........8 2.2 Die Phase bis zum Ersten Weltkrieg .............................................................9 2.3 Die jüdischen Warenhäuser zur Zeit der Weimarer Republik.....................11 2.4 Der Boykott jüdischer Geschäfte.................................................................12 2.5 Die „Arisierung“ durch die Nationalsozialisten ..........................................14 2.6 Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg – ein Abriss ......................15 3. Schlussbetrachtung ............................................................................................16