Liselotte Vogel Und Hans-Jochen Vogel Bundesjustizminister A.D
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bd. 5: Deutsch- 29 Hs
willy brandt Berliner Ausgabe willy brandt Berliner Ausgabe Herausgegeben von helga grebing, gregor schöllgen und heinrich august winkler Im Auftrag der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung band 1: Hitler ist nicht Deutschland. Jugend in Lübeck – Exil in Norwegen 1928 – 1940 band 2: Zwei Vaterländer. Deutsch-Norweger im schwedischen Exil – Rückkehr nach Deutschland 1940 – 1947 band 3: Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947 – 1966 band 4: Auf dem Weg nach vorn. Willy Brandt und die SPD 1947 – 1972 band 5: Die Partei der Freiheit. Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 band 6: Ein Volk der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966 – 1974 band 7: Mehr Demokratie wagen. Innen- und Gesellschaftspolitik 1966 – 1974 band 8: Über Europa hinaus. Dritte Welt und Sozialistische Internationale band 9: Die Entspannung unzerstörbar machen. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1974 – 1982 band 10: Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1982 – 1992 willy brandt Berliner Ausgabe band 5 Die Partei der Freiheit Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 Bearbeitet von karsten rudolph Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung bedankt sich für die groß- zügige finanzielle Unterstützung der gesamten Berliner Ausgabe bei: Frau Ursula Katz, Northbrook, Illinois Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen Otto Wolff von Amerongen-Stiftung, Köln Stiftungsfonds Deutsche Bank im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., Essen Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg Bankgesellschaft Berlin AG Herlitz AG, Berlin Metro AG, Köln Schering AG, Berlin Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; dataillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. -

CDU) SOZIALORDNUNG: Dr
g Z 8398 C 'nformationsdienst der Christlich Demokratischen Union Deutschlands Union in Deutschland Bonn, den 7. Oktober 1982 Für die Wir packen Auftakt-Aktion Bundeskanzler es an Helmut Kohl liegen jetzt sämtliche Materia- Als Helmut Kohl vor zehn Tagen zum Bundes- lien vor. Ausführliche Vorstel- lung mit Abbildungen und Be- kanzler gewählt wurde, sagte er: „Packen wir es stellformular im rosa Teil. gemeinsam an." Dieses Wort gilt. Die Re- Von dem am 1. Oktober 1982 gierung unter seiner Führung hat angepackt. aktuell herausgegebenen „Zur D'e Bürger im Land spüren dies, sie atmen Sache"-Flugblatt zur Wahl Hel- *uf, daß die Zeit der Führungslosigkeit, des mut Kohls wurden am Wo- Tr chenende bereits über 3 Mil- eibenlassens und der Resignation zu Ende lionen Exemplare verteilt. 9eht. Auch die Beziehungen zu unseren Freun- • den im Ausland hat Helmut Kohl mit seinen er- sten Reisen nach Paris und Brüssel gefestigt Das traurige Erbe und gestärkt. Dokumentation über die Hin- terlassenschaft der Regierung Der Bundeskanzler und alle, die ihm helfen, haben in Schmidt im grünen Teil den letzten Tagen mit einem gewaltigen Arbeitspen- sum ein Beispiel für uns alle dafür gegeben, was jetzt yon uns verlangt wird, um Schritt für Schritt das trau- • HELMUT KOHL r,9e Erbe, das die Schmidt-Regierung hinterlassen Wir müssen den Leistungswillen nat, zu überwinden. Die häßliche Hetzkampagne zahl- in unserem Volke wieder beleben Seite 3 reicher Sozialdemokraten gegen diesen Neuanfang 2ßigt ihre Ohnmacht und ihr schlechtes Gewissen; s'e sind schlechte Verlierer und schlechte Demokra- • BUNDESTAGS- ten, und sie werden dafür am 6. März die Quittung er- FRAKTION halten. -

HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv Für Christlich-Demokratische Politik
HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv für Christlich-Demokratische Politik Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. herausgegeben von Günter Buchstab, Hans-Otto Kleinmann und Hanns Jürgen Küsters 19. Jahrgang 2012 BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv für Christlich-Demokratische Politik 19. Jahrgang 2012 Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. herausgegeben von Dr. Günter Buchstab, Prof. Dr. Hans-Otto Kleinmann und Prof. Dr. Hanns Jürgen Küsters Redaktion: Dr. Wolfgang Tischner, Dr. Kordula Kühlem Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Wissenschaftliche Dienste / Archiv für Christlich-Demokratische Politik Rathausallee 12 53757 Sankt Augustin Tel. 02241 / 246 2240 Fax 02241 / 246 2669 e-mail: [email protected] Internet: www.kas.de © 2012 by Böhlau Verlag GmbH & Cie., Wien Köln Weimar Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, [email protected], www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth Druck: Strauss GmbH, Mörlenbach ISSN: 0943-691X ISBN: 978-3-412-21008-3 Erscheinungsweise: jährlich Preise: € 19,50 [D] / € 20,10 [A] Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Böhlau Verlag unter: [email protected], Tel. +49 221 91390-0, Fax +49 221 91390-11 Ein Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn die Kündi- gung nicht zum 1. Dezember erfolgt ist. Zuschriften, die Anzeigen und Ver- trieb betreffen, werden an den Verlag erbeten. Inhalt AUFSÄTZE Hanns Jürgen Küsters . 1 Der Bonn/Berlin-Beschluss vom 20. Juni 1991 und seine Folgen Katrin Rupprecht . 25 Der isländische Fischereizonenstreit 1972–1976. Im Konfliktfeld zwischen regionalen Fischereiinteressen und NATO-Bündnispolitik Herbert Elzer . 47 Weder Schlaraffenland noch Fata Morgana: Das Königreich Saudi-Arabien und die Fühlungnahme mit der Bundesrepublik Deutschland im Herbst 1952 ZUR CHRISTLICHEN DEMOKRATIE VOR 1945 Markus Lingen . -

Criminalizing Insurgents: the United States and Western Europe Response to Terrorism, 1968-1984
CRIMINALIZING INSURGENTS: THE UNITED STATES AND WESTERN EUROPE RESPONSE TO TERRORISM, 1968-1984 A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF PHILOSOPHY by Silke Victoria Zoller Diploma Date August 2018 Examining Committee Members: Dr. Richard H. Immerman, Advisory Chair, History Dr. Petra Goedde, History Dr. Orfeo Fioretos, Political Science Dr. David Farber, University of Kansas Dr. Paul T. Chamberlin, External Member, Columbia University ii © Copyright 2018 by Silke Zoller ________________ All Rights Reserved iii ABSTRACT The United States, Germany, and other Western industrialized countries began seeking multilateral anti-terrorism agreements in the 1970s. In that decade, transnationally operating terroristic actors tapped into the anti-imperialist, anti-colonial global discourse of the 1960s to justify themselves as national liberation fighters. This dissertation is a case study of Western state officials who interacted with one another and with recently independent states in response to the activity of such ostensible insurgents. The dissertation reveals how Western officials worked to define and deploy the terrorism label against these non-state actors. U.S., German, and other Western officials generated international conventions that treated terrorists as ordinary criminals and ignored their political motivations. The resulting multilateral agreements stipulated that terrorism was an illegal and criminal act. These solutions undermined national liberation actors’ claims to protected status as wartime combatants. This dissertation clarifies some of the mechanisms which permitted Western states to shape the norms about who is or is not a terrorist. However, Western efforts to define and regulate terrorism also led to the institutionalization of terrorism as a global security threat without providing long-term solutions. -
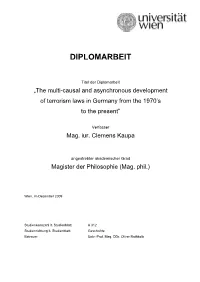
Terrorism As Discourse
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „The multi-causal and asynchronous development of terrorism laws in Germany from the 1970’s to the present” Verfasser Mag. iur. Clemens Kaupa angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im Dezember 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: Univ.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb Content Introduction ................................................................................................................................ 3 Terrorism as discourse ............................................................................................................... 6 Terrorism discourse: the case of SDS .................................................................................... 7 Terrorism discourse: sympathizers....................................................................................... 11 Terrorism laws in Germany enacted during the RAF period................................................... 16 Kronzeugenregelung – the leniency law .............................................................................. 16 Conclusion........................................................................................................................ 23 Lauschangriff – the wiretapping program............................................................................ 24 Conclusion........................................................................................................................ 32 Rasterfahndung.................................................................................................................... -

Stenographischer Bericht 145. Sitzung
Plenarprotokoll 14/145 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 145. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 24. Januar 2001 Inhalt: Tagesordnungspunkt 1: Rolle des Bundesministers Trittin im Kommu- Befragung der Bundesregierung zum Ent- nistischen Bund in Göttingen während der wurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der 70er-Jahre; Ansicht des Kommunistischen illegalen Beschäftigung im gewerblichen Bundes in Göttingen zur Gewaltfrage Güterkraftverkehr . 14195 A DringlAnfr 1, 2 Kurt Bodewig, Bundesminister BMVBW . 14195 B Dr. Edzard Schmidt-Jortzig F.D.P. Horst Friedrich (Bayreuth) F.D.P. 14196 C Antw PStSekr Fritz Rudolf Körper Kurt Bodewig, Bundesminister BMVBW . 14196 D BMI . 14201 A, 14202 B Peter Dreßen SPD . 14197 A ZusFr Dr. Edzard Schmidt-Jortzig Kurt Bodewig, Bundesminister BMVBW . 14197 B F.D.P. 14201 B, 14202 C Dr. Klaus Grehn PDS . 14197 C ZusFr Jürgen Koppelin F.D.P. 14201 C, 14203 B Kurt Bodewig, Bundesminister BMVBW . 14197 C ZusFr Dirk Niebel F.D.P. 14201 D Wilhelm Josef Sebastian CDU/CSU . 14197 D ZusFr Walter Hirche F.D.P. 14201 D, 14203 C Kurt Bodewig, Bundesminister BMVBW . 14198 A ZusFr Eckart von Klaeden CDU/CSU . 14202 A Dirk Niebel F.D.P. 14198 B ZusFr Dr. Heinrich L. Kolb F.D.P. 14203 A Kurt Bodewig, Bundesminister BMVBW . 14198 B Angelika Graf (Rosenheim) SPD . 14198 C Verhalten des Bundesministers Trittin gegen- Kurt Bodewig, Bundesminister BMVBW . 14198 D über dem Sohn des ermordeten Generalbun- Jürgen Koppelin F.D.P. 14199 A desanwalts Buback im Januar 2001 und auf der Kurt Bodewig, Bundesminister BMVBW . 14199 A Pressekonferenz am 22. Januar 2001 Dr. Klaus Grehn PDS . 14199 B DringlAnfr 3, 4 Kurt Bodewig, Bundesminister BMVBW . -

Download (3141Kb)
University of Warwick institutional repository: http://go.warwick.ac.uk/wrap A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick http://go.warwick.ac.uk/wrap/57447 This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. Sisters in Arms? Female Participation in Leftist Political Violence in the Federal Republic of Germany Since 1970 by Katharina Karcher A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Warwick, Department of German Studies February 2013 Contents List of Figures 4 Abbreviations 5 Acknowledgements 6 Abstract 7 Declaration 8 Introduction 9 1. Situating the Subject – The Historical, Political, Theoretical and Methodological Background of this Study 22 1.1. Historical and Political Context 22 1.1.1. The Protest and Student Movement in West Germany 22 1.1.2. The New Women’s Movement 34 1.2. The Armed Struggle of the RAF, MJ2, RC and RZ – a Brief Overview 47 1.3. Theoretical Background 59 1.3.1. Terrorism and Political Violence 59 1.3.2. Previous Scholarship on Women’s Involvement in Political Violence 66 1.4. Methodological Framework 76 1.4.1. The Vital Critique of New Feminist Materialisms 76 1.4.2. The Untapped Potential of Theories of Sexual Difference 81 1.4.3. British Cultural Studies – Exploring the Materiality of (Militant) Subcultures 87 1.4.4. -

The Lasting Legacy of the Red Army Faction
WEST GERMAN TERROR: THE LASTING LEGACY OF THE RED ARMY FACTION Christina L. Stefanik A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS August 2009 Committee: Dr. Kristie Foell, Advisor Dr. Christina Guenther Dr. Jeffrey Peake Dr. Stefan Fritsch ii ABSTRACT Dr. Kristie Foell, Advisor In the 1970s, West Germany experienced a wave of terrorism that was like nothing known there previously. Most of the terror emerged from a small group that called itself the Rote Armee Fraktion, Red Army Faction (RAF). Though many guerrilla groupings formed in West Germany in the 1970s, the RAF was the most influential and had the most staying-power. The group, which officially disbanded in 1998, after five years of inactivity, could claim thirty- four deaths and numerous injuries The death toll and the various kidnappings and robberies are only part of the RAF's story. The group always remained numerically small, but their presence was felt throughout the Federal Republic, as wanted posters and continual public discourse contributed to a strong, almost tangible presence. In this text, I explore the founding of the group in the greater West German context. The RAF members believed that they could dismantle the international systems of imperialism and capitalism, in order for a Marxist-Leninist revolution to take place. The group quickly moved from words to violence, and the young West German state was tested. The longevity of the group, in the minds of Germans, will be explored in this work. -

Wolfgang Mischnick Bundesminister A.D. Im Gespräch Mit Stefan Wittich
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks Sendung vom 26.10.1999 Wolfgang Mischnick Bundesminister a.D. im Gespräch mit Stefan Wittich Wittich: Herzlich willkommen bei Alpha-Forum. Unser heutiger Gast ist Wolfgang Mischnick, ein Politiker der FDP, der die Politik der Bundesrepublik in fast fünf Jahrzehnten an maßgeblicher Stelle mitgestaltet hat. Herr Mischnick, Sie sind 1945 aus dem Krieg in Ihre von Bombenangriffen schwer zerstörte Heimatstadt Dresden zurückgekommen. Noch im selben Jahr haben Sie sich der dortigen "Liberal-demokratischen Partei" LDPD angeschlossen. Was hat Sie veranlasst, sich in dieser Situation politisch zu engagieren? Mischnick: Das war zum einen die Erkenntnis, dass es notwendig ist, sich auch als damals noch junger Mensch politisch zu betätigen. Zweitens hatte ich das Gefühl, dass es beim Aufbau notwendig ist, dass gerade wir, die wir diese Kriegserfahrung hinter uns hatten, gefragt sind und mitwirken müssen. Drittens war ich noch völlig ratlos, welche beruflichen Möglichkeiten ich bekommen würde. Da ich Reserveoffizier gewesen war, durfte ich nämlich viertens nicht studieren, weil eine Verordnung erlassen worden war, dass man als Reserveoffizier nicht studieren dürfe. Eigentlich wollte ich Diplomingenieur und Doktor rer. pol. werden. Und fünftens war es schließlich so, dass ich, als ich mit meinem Vater auf den Bau ging, um am "Hygiene-Museum" in Dresden Steine zu klopfen, die man für den Wiederaufbau verwenden konnte, eines Tages ein Plakat von der "Demokratischen – und dann Liberal-demokratischen – Partei" sah. Ich bin auch dort hingegangen, um mich zu erkundigen, denn der Mann am Arbeitsamt, der mich vermitteln sollte - ich ging noch am Stock – hatte gesagt, dass man nach dem Ersten Weltkrieg den Fehler gemacht hätte, es den zurückkehrenden Frontsoldaten zu verwehren, politisch tätig zu werden und dass das dann in politischer Radikalität geendet hätte. -

An Examination of Gerhard Richter's 18. Oktober 1977 in Relation to the West
Trinity College Trinity College Digital Repository Senior Theses and Projects Student Scholarship Spring 2019 Gewalt und Gedächtnis: An Examination of Gerhard Richter’s 18. Oktober 1977 in Relation to the West German Mass Media Matthew McDevitt [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalrepository.trincoll.edu/theses Part of the Contemporary Art Commons, European History Commons, Fine Arts Commons, Modern Art and Architecture Commons, Other German Language and Literature Commons, and the Theory and Criticism Commons Recommended Citation McDevitt, Matthew, "Gewalt und Gedächtnis: An Examination of Gerhard Richter’s 18. Oktober 1977 in Relation to the West German Mass Media". Senior Theses, Trinity College, Hartford, CT 2019. Trinity College Digital Repository, https://digitalrepository.trincoll.edu/theses/760 Gewalt und Gedächtnis: An Examination of Gerhard Richter’s 18. Oktober 1977 in Relation to the West German Mass Media A Senior Thesis Presented By Matthew P. McDevitt To the Art History Department in Fulfillment of the Requirements for Honors in Art History Advisor: Professor Michael FitzGerald Trinity College Hartford, Connecticut Spring 2019 2 Table of Contents Acknowledgements………...………………………………………………………3 Chapter I: History and Ideology of the Red Army Faction………………………...4 Chapter II: Gerhard Richter: Beginnings, Over and Over Again……………........40 Chapter III: 18. Oktober 1977 and the West German Mass Media……………….72 Appendix of Images……………………………………………………………… 96 Bibliography………………………………………………………………….… 132 3 Thank You Thank you, Mom and Dad, for supporting me unrelentingly and trusting me unsparingly, even in times when I’m wrong. Thank you for those teaching moments. Thank you to Ryan and Liam for never changing, no matter how scattered we are. -

Entführung Peter Lorenz Deutsch-Israelische Beziehungen
1.2015 2 € ISSN 1433-349X www.museumsmagazin.com Entführung Peter Lorenz Vor 40 Jahren Deutsch-israelische Beziehungen Seit 50 Jahren intro TV-Duell, Talkshow, Titelstory: Politiker nutzen Medien be- wusst, um sich und ihre Botschaften in der Öffentlichkeit in Szene zu setzen. Dabei bekommen sie mitunter auch die Macht der Medien zu spüren, die nicht nur die Prominenten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kontrollieren, sondern durch Themensetzung und Kommentierung selbst Einfluss nehmen. Dem spannungsreichen Verhältnis zwischen Medien und Politik widmet sich die Wechselausstellung „Unter Druck. Me- dien und Politik“, die bis zum 9. August 2015 im Zeitgeschicht- lichen Forum Leipzig zu sehen ist und ab Anfang Oktober 2015 in Bonn gezeigt wird. Zeitungen, Fernsehsender, Radiopro- gramme, aber auch Blogs, Tweets und Online-Plattformen konkurrieren um unsere Aufmerksamkeit. Die tägliche Infor- mationsflut kann nur bewältigen, wer sich einen kritischen Blick bewahrt. Hochaktuelle Themen behandeln auch unsere weiteren Wechselausstellungen: In Leipzig zeigt „Schamlos. Sexualmo- ral im Wandel“ noch bis zum 6. April 2015 die tief greifenden Veränderungen von Moralvorstellungen und Geschlechter- beziehungen in Deutschland seit 1945. Die drängenden Fra- gen von Migration und Integration stehen im Mittelpunkt von „Immer bunter. Einwanderungsland Deutschland“ – diese Aus- stellung ist bis zum 9. August 2015 in Bonn zu sehen, anschlie- ßend in Leipzig. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dr. Hans Walter Hütter Präsident und Professor Zusammen mit Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters MdB eröffnet der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte Hans Walter Hütter am 9. Dezember 2014 Wie ambivalent das Verhältnis von Politikern und die neue Ausstellung „Immer bunter. Medien ist, zeigt der Fall Christian Wulff: In der Ausstellung Einwanderungsland Deutschland“ in Bonn. -

UID 1983 Nr. 13, Union in Deutschland
' Z 8398 C lnformationsdienst der Christlich Demokratischen Union Deutschlands Union in. Deutschland Bonn, den 31. März 1983 £gM0. Deutsche Bundestag geht an die Arbeit Helmut Kohl: •ch glaube an die Kraft Unserer Bürger |Jach der Konstituierung und der Wahl des Präsidiums, der Wahl ?es Bundeskanzlers und der Vereidigung des Bundeskabinetts J*nn der 10. Deutsche Bundestag an die Arbeit gehen. Nach Ser* Votum der Wähler am 6. März, die Bundeskanzler Helmut L°h' und seine Koalition der Mitte überzeugend bestätigt ha- K*n' beginnt wieder der politische Alltag. Helmut Kohl sagte *ch seiner Wahl in einem Fernsehinterview: lr haben vier Jahre Zeit, eine volle Legislaturperiode. Das gibt natürlich eine oße Vo Autorität nach einem solchen Wahlsieg wie dem am 6. März. Wir stehen tj Schwierigsten Fragen, das Problem der Abrüstung und die Frage der Sta- lerun $D? 9. die Frage der Stabilisierung des Bündnisses, die notwendigen Ge- ache mit Moskau, die notwendigen Gespräche auch mit der politischen Füh- ^9 der DDR. Und im innenpolitischen Bereich liegen die Probleme für jeder- nn l<6. erkennbar zutage: über zwei Millionen Arbeitslose, Jugendarbeitslosig- Juri ^ Was mich 9anz besonders bedrückt —, die Situation junger Studenten, Q 9akademikerarbeitslosigkeit. S cj*r sind alles Probleme, die jetzt in den Vordergrund treten. Wiederbelebung . Ortschaft! Wir sind auf einem guten Weg. Aber das kostet viel Kraft, p ^'aube, daß die Zeichen der Zeit jetzt zu erkennen sind. Ich habe einige der Uns e 9enannt- Das sind Herausforderungen. Und ich glaube an die Kraft eres Landes, unserer Bürger, daß wir das gemeinsam schaffen werden. UiD 13 • 31. März 1983 • Seite 2 Das Kabinett Helmut Kohl BUNDESKANZLER: BUNDESMINISTER FÜR ARBEIT UND Dr.