Auf Den Spuren Von Julius Hirsch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Julius Hirsch Nationalspieler - Ermordet Aber Nicht Vergessen!
in Gedenken an Julius Hirsch Nationalspieler - ermordet aber nicht vergessen! Mannschaftsbild des KFV 1910, stehend von links: Hüber, Burger, Tscherter, Ruzek, Breunig, Hollstein, Bosch, Gros. Sitzend von links: Förderer, Schwarze, Hirsch, Fuchs, Kächele. Julius Hirsch – 07.04.1892 - 08.05.1945 (für tot erklärt ) Julius Hirsch ist als jüngster Sohn, als eines von insgesamt sieben Kindern in Achern auf die Welt gekommen. Mit 6 Jahren wurde er in Karlsruhe eingeschult und beende- te seine Schulzeit mit der mittleren Reife. Daraufhin besuchte er eine Handelsschule und machte eine Lehre als Kaufmann bei der Karlsruher Lederhandlung Freund und Strauss. Dort arbeitete er bis zum 22.03.1912. Hirsch mit Förderer und Fuchs auf dem Cover von „Süddeutscher Julius Hirsch auf dem Cover von „Fußball“, 1922. Illustrierter Sport“, 1921. Ab dem 07.08.1914 diente er als Soldat im Ersten Weltkrieg und erreichte innerhalb von vier Dienstjahren den Rang des Vizefeldwebels und wurde mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet. Nach dem Krieg arbeitete er bei der Nürnberger Bing AG und kehrte erst danach zum 01.04.1919 zurück nach Karlsruhe in die Deutsche Signalflaggenfabrik seines Vaters. 1920 heiratete er die gebürtige Karlsruherin Ella Karolina Hauser und bekam 1922 und 1928 die Kinder Heinold Leopold und Esther Carmen. 1926 bekamen Julius und sein Bruder Max die Geschäftsanteile des Vaters an dem Unternehmen. Allerdings wurde am 10.02.1933 das Konkursverfahren über das Un- ternehmen eröffnet und jenes liquidiert, wegen einer Bürgschaft die Max Hirsch ge- geben hatte. Der nun nach Arbeit suchende Hirsch ging in die Schweiz und anschließend in den Elsass und trat dort eine Trainerstelle bei der F.A. -

Publikationen Schmaltz 10-2012
Dr. Florian Schmaltz Goethe Universität Frankfurt Historisches Seminar Arbeitsgruppe Wissenschaftsgeschichte Schriftenverzeichnis (Stand: Oktober 2012) Bücher mit Moritz Epple (Hg.), The History of Fluid Mechanics in the 20th Century, Stuttgart: Steiner-Verlag, im Erscheinen, ca. 350 S. Hans Frankenthal, Verweigerte Rückkehr. Erfahrungen nach dem Judenmord. Unter Mitarbeit von Babette Quinkert, Andreas Plake und Florian Schmaltz (Neuauflage), Berlin: Metropol-Verlag, 2012, 191 S. Ludwik Fleck, Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa. [Denkstil und Fakten. Artikel und Zeugnisse.] hrsg. v. Sylwia Werner, Claus Zittel und Florian Schmaltz, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2007, 418 S. Kampfstoff-Forschung im Nationalsozialismus. Zur Kooperation von Kaiser-Wilhelm- Instituten, Militär und Industrie, Göttingen: Wallstein-Verlag, 2005 (= Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, Hrsg. von Reinhard Rürup und Wolfgang Schieder im Auftrag der Präsidentenkommission der Max-Planck-Gesellschaft, Bd. 11), 676 S. Hans Frankenthal, Unwelcome One – Returning Home from Auschwitz. In collaboration with Andreas Planke, Babette Quinkert & Florian Schmaltz, Chicago: Chicago University Press, 2002, 169 S. Hans Frankenthal, Verweigerte Rückkehr. Erfahrungen nach dem Judenmord. Unter Mitarbeit von Babette Quinkert, Andreas Plake und Florian Schmaltz, hrsg. von Wolfgang Benz, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1999, 188 S. 1 Zeitschriften- und Buchbeiträge mit Andreas Plake -

Information Issued by the Association of Jewish Refugees in Great Britain • Fairfax Mansions
Vol. XVII No. 7 July, 1962 INFORMATION ISSUED BY THE ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN • FAIRFAX MANSIONS. FINCHLEY RD. (corner Fairfax Rd.). London. N.W.I Offset and ConMuUiitg Hours: Telephone: MAIda Vale 9096/7 (General OIkce and Welfare tor tha Aged) Moi\day to Thursday 10 a.in.—I p.m. 3—6 p.m MAIda Vale 4449 (Employment Agency, annually licensed bv the L.C.C,, and Social Services Dept.) Friday 10 ajn.—l p.m. Ernst Kahn Austrian baroque civilisation, tried to cope with their situation. Schnitzler, more fortunate than Weininger, if only through his exterior circum stances, knew much about the psychological struc THE YOUNG GENERATION CARRIES ON ture of Viennese middle-class s(Kiety and Jewry. The twilight, uncertainly and loneliness of the human soul attracted him, but his erotism is half- Sixth Year Book of the Leo Baeck Institute playful, half-sorrowful and does not deceive him about the truth that ". to write means to sit Those amongst us who remember our German- To some extent these achievements were due to in judgment over one's self". It enabled him to Jewish past are bound to wonder who will carry the Rabbi's charm which attracted Polish Jews objectivise the inner struggles of Jews who sought On with the elucidation of the relevant problems and German high-ranking officers and aristocrats the " Way into the Open ", i.e., into assimilation in once the older witnesses are no longer available. alike with whom he collaborated very closely. its different forms. The Year Book 1961* brings this home to us by This went so far that the German officials called Weininger. -
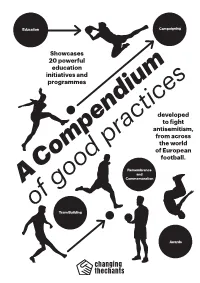
A Compendium of Good Practices
1 Education Campaigning Showcases 20 powerful education initiatives and programmes developed to fight antisemitism, from across the world of European football. CompendiumRemembrance and A Commemoration of good practices Team Building Awards 2 What are you reading ? This Compendium of good practices showcases 20 power- ful education initiatives and programmes, developed to fight antisemitism, from across the world of European football. The Compendium is not the definitive list of all noteworthy initiatives, nor is it an evaluation of a selection of programmes which are considered to be the best which exist; its aim is, rather, to highlight some of the existing practices - from workshops to commemoration plaques and remembrance trips to online campaigns – in the hope they might spark interest and motivate clubs, associations, fan groups and other stakeholders within or associated with the football community to develop their own practices. The initiatives were selected as a result of research conducted by a group of eight researchers and experts from across Europe who were all part of the Changing the Chants project. They conducted desk research and interviewed stake- holders connected to these initiatives. As a result, for every initiative the Compendium provides project background and context and an overview of what took place. Due to the limited scope of this Compendium, it has not been possible to analyse all these good practices in great depth and, as such, readers of this Compendium are invited and encouraged to seek out further information where further detail has not been provided. Categorization The practices have been categorised against five overarching themes: Campaigning (1), Education (2), Remembrance and com- memoration (3), Network building (4) and Awards (5). -

Sicherung Und Erschließung Von Kulturgut Des Sports
ISSN 1613-5121 Januar 2008 - Heft 1 Magazin 2. DAGS Symposium: Sicherung und Erschließung von Kulturgut des Sports MITTEILUNGSBLATT DER DEUTSCHEN ARBEITSGE M EINSCHAFT VON SPORT M USEEN , SPORTARCHIVEN UND SPORTSA mm LUNGEN E.V. 2008 - Heft 1 63 Geleitwort des DAGS-Vorsitzenden Das dritte DAGS-Symposium „Erfahrungen sporthistorischer Spezialmuseen“ findet am 21. und 22. November 2008 in den Räumen des Museums des Im Dezember 2004 erschien das letzte Heft DAGS-Magazin. Es Das wäre die einzige Aufgabe. Unser Traum von einem Handbuch Deutschen Schützenbundes auf Schloss Callenberg in Coburg statt. enthielt die Referate des so erfolgreichen Symposiums „Kulturgut der Archive war also ein geplatzter Luftballon. Wir wollten aber des Sports in Gefahr, das vom 15. bis 17. Oktober 2004 in Leipzig nicht aufgeben und planen, das, was wir über Museen und Archive stattfand. haben, ins Netz zu stellen und dann Schritt um Schritt zu erweitern. Für die Jahre 2005 und 2006 hatten wir uns vorgenommen, ein Außerdem sollen vom Carl und Liselott Diem-Archiv an der Deut- Handbuch der Sportmuseen, Archive und Sportsammlungen he- schen Sporthochschule Köln an der Diplomarbeiten vergeben wer- rauszugeben. Dort sollten diese Einrichtung sich selbst darstellen den, bei denen Studenten mit einem Fragebogen die Archivsituation zu können. Wir stellten eine Werbebroschüre zusammen, in der bei- in den Verbänden untersuchen sollen. spielhaft einige Archive sich beschrieben. Dieses Heft verschickten Unser Scheitern beim Handbuch führte zu einer fruchtbaren Trotz- wir an rund 700 Einrichtungen. Wir informierten alle Sportmuseen reaktion. Unser Vorstandsmitglied Martin Ehlers hatte die Idee, in (ca. 70), alle Verbände des Deutschen Olympischen Sportbundes seinem Heimatort Maulbronn eine Tagung zu dieser Fragestellung (etwa 80), die Landesorganisationen der Sportspitzenverbände durchzuführen. -

La Sucia Historia De IG Farben
Startseite home (engl) francais italiano espanol Photo Artículos Fosgeno IG Farben Venezuela Tea Party Bayer USA BAYER Bhopal Bhopal EEUU Institute / USA La sucia historia de IG Farben 6 de diciembre de 2003 La sucia historia de IG Farben Entre 1933 y 1945 la explotación de los obreros alemanes voluntarios, forzados o esclavos y el monopolio químico tenía un nombre: IG Farben. Después de la derrota alemana las potencias victoriosas acabaron con el trust. Así nacieron BASF, Hoechst o Bayer, pero IG Farben siguio existiendo hasta ayer. El pasado 9 de noviembre el antiguo consorcio IG Farben, una especie de INI o SEPI germana, se ha declarado insolvente, pero ese hecho no significa que vaya a desaparecer de forma inmediata: sus acciones siguen siendo objeto de especulación en los corros bursátiles. La historia de la IG Farben se lee como el historial de un criminal. Fundada en 1925 por las mayores empresas alemanas de química, la IG Farben se convirtió en un importante actor en la política alemana de entreguerras. Fue el mayor agente financiero del partido nazi que lideraba Adolf Hitler. Cuando el "Führer" llegó al poder los grandes dirigentes de la IG Farben le aseguraron que habían solucionado el problema de la falta de petróleo: la fabricación de gasolina artificial. Gracias a los ingenieros y técnicos de la IG Farben, Hitler pudo empezar su guerra por el "espacio vital" en Europa. Los estrategas del trust tenían pensando hacerse con los mercados siguiendo a la victoriosa "Wehrmacht". Facilitaron informaciones sensibles al Comando Supremo y colocaron a agentes en sus sucursales. -

Whole Dissertation Hajkova 3
Abstract This dissertation explores the prisoner society in Terezín (Theresienstadt) ghetto, a transit ghetto in the Protectorate Bohemia and Moravia. Nazis deported here over 140, 000 Czech, German, Austrian, Dutch, Danish, Slovak, and Hungarian Jews. It was the only ghetto to last until the end of Second World War. A microhistorical approach reveals the dynamics of the inmate community, shedding light on broader issues of ethnicity, stratification, gender, and the political dimension of the “little people” shortly before they were killed. Rather than relegating Terezín to a footnote in narratives of the Holocaust or the Second World War, my work connects it to Central European, gender, and modern Jewish histories. A history of victims but also a study of an enforced Central European society in extremis, instead of defining them by the view of the perpetrators, this dissertation studies Terezín as an autarkic society. This approach is possible because the SS largely kept out of the ghetto. Terezín represents the largest sustained transnational encounter in the history of Central Europe, albeit an enforced one. Although the Nazis deported all the inmates on the basis of their alleged Jewishness, Terezín did not produce a common sense of Jewishness: the inmates were shaped by the countries they had considered home. Ethnicity defined culturally was a particularly salient means of differentiation. The dynamics connected to ethnic categorization and class formation allow a deeper understanding of cultural and national processes in Central and Western Europe in the twentieth century. The society in Terezín was simultaneously interconnected and stratified. There were no stark contradictions between the wealthy and majority of extremely poor prisoners. -

SN Holocaust.Pdf
BEITRÄGE ZUR HISTORISCHEN SOZIALKUNDE • 1 Whereas in analysis and discussion adults predominantly concentrated on the diffe ren Introduction ces in the national perspectives of the Holo caust, the limitations of each respective in terpretation, the political interests and pe da gogical objectives, which flow into these, and contributed comparisons with other examples of genocide; pupils, as a rule, very directly hit The statements and opinions could hardly upon the inhumane core of the politically be more contradictory, which have been generated mass murder, which appears so dis cussed in the media and on specialist con overwhelmingly repulsive that further que ferences in the past months. The demands stions sometimes are not possible anymore. on the topic are mounting as well as critical One academic asked a group of pupils that voices warning of asking too much of both told about a visit to Auschwitz: “Has anything pupils and teachers. What would, therefore, caused you particular dis tress?” A schoolgirl be more obvious than bring together the then replied: “I just kept asking myself how participants in the learning process? something like this could happen.” And to the question about reapprai sal, about comparison and parallels to the present, whether the Pupils are tired of constantly dealing with the Third Reich, Kosovo would have also played a role, there Pupils hardly have secured knowledge about National Socialism, followed an astonished shake of the head and Pupils show great interest in the subject and want to know more; the answer of a female guide that a transfer Teaching about the murderous racism of the Nazis offers a com- had explicitly not taken place. -

The Factory Action and the Events at the Rosenstrasse in Berlin: Facts and Fictions About 27 February 1943 — Sixty Years Later
The Factory Action and the Events at the Rosenstrasse in Berlin: Facts and Fictions about 27 February 1943 — Sixty Years Later Wolf Gruner N 27 February 1943 in Nazi Germany the Gestapo brutally arrested more than ten thousand Jewish men and women. Martin Riesen- burger, later the Chief Rabbi of the German Democratic Republic, O 1 recalled that day as "the great inferno." This large-scale raid marked the begin- ning of the final phase of the mass deportations, which had been under way since October 1941. Also interned in Berlin were people who, according to NS termi- nology, lived in so-called mixed marriages. But new documents show that no deportation of this special group was planned by the Gestapo. In the past dec- ade, in both the German as well as the American public, quite a bit of attention has been paid to the fact that non-Jewish relatives publicly demonstrated against the feared deportation of their Jewish partners. The scholarly literature as well has pictured this protest as a unique act of resistance that prevented the depor- tation of these Jews living in mixed marriages. The fact that during this raid an untold number of Jews, both women and men, fled and went underground has so far been ignored. Since we still know much too little, the following article will discuss all the events of the spring of 1943 and their background.2 Memory and History Since the beginning of the 1990s, this "successful" protest during the NS dic- tatorship has been commemorated in Germany annually. Especially in Berlin, Translated by Ursula Marcum. -
![[Pdf] Florian Schmaltz the Bunamonowitz Concentration Camp](https://docslib.b-cdn.net/cover/6305/pdf-florian-schmaltz-the-bunamonowitz-concentration-camp-2286305.webp)
[Pdf] Florian Schmaltz the Bunamonowitz Concentration Camp
www.wollheim-memorial.de Florian Schmaltz The Buna/Monowitz Concentration Camp The Decision of I.G. Farbenindustrie to Locate a Plant in Auschwitz . 1 The Buna ―Aussenkommando‖ (April 1941 to July 1942) . 10 The Opening of the Buna/Monowitz Camp – Demographics of the Prisoner Population . 15 Composition of the Prisoner Groups in Monowitz . 18 The Commandant of Buna/Monowitz . 19 The Administrative Structure of the Camp . 21 Guard Forces . 24 The Work Deployment of the Prisoners . 25 Casualty Figures . 28 The Camp Elders . 35 Escape and Resistance . 36 Air Attacks on Auschwitz . 38 The Evacuation of the Camp . 42 Norbert Wollheim Memorial J.W. Goethe-Universität / Fritz Bauer Institut Frankfurt am Main, 2010 www.wollheim-memorial.de Florian Schmaltz: The Buna/Monowitz Concentration Camp, p. 1 The Decision of I.G. Farbenindustrie to Locate a Plant in Auschwitz The Buna/Monowitz concentration camp, which was erected by the SS in October 1942, was the first German concentration camp that was located on the plant grounds of a major private corporation.1 Its most important function was the fur- nishing of concentration camp prisoners as slave laborers for building the I.G. Auschwitz plant, I.G. Farben‘s largest construction site. Instead of estab- lishing an industrial production location on the grounds of an existing concentra- tion camp, a company-owned branch camp of a concentration camp was put up here, for the first time, on a site belonging to an arms manufacturer. This new procedure for construction of the I.G. Auschwitz plant served as a model and in- fluenced the subsequent collaboration between the arms industry and the SS in the process of expanding the concentration camp system in Nazi territory throughout Europe, particularly toward the end of the war, when numerous sub- camps were established in the course of shifting industrial war production to un- derground sites.2 The Buna/Monowitz concentration camp was located in East Upper Silesia within the western provinces of Poland, which had been annexed by the German Reich. -

Glossar Verweigerte Rückkehr
Andreas Plake · Babette Quinkert · Florian Schmaltz Glossar zu Hans Frankenthal Verweigerte Rückkehr Erfahrungen nach dem Judenmord Metropol 2012 Hans Frankenthal, geboren 1926 in Schmallenberg Sauerland, wurde zu- sammen mit seiner Familie 1943 nach Auschwitz deportiert. Seine Eltern wurden ermordet. Hans und sein Bruder Ernst überlebten die Zwangs- arbeit im Lager Monowitz und das Konzentrationslager Mittelbau-Dora und wurden schließlich 1945 in Theresienstadt befreit. Nach ihrer Rück- kehr nach Schmallenberg betrieb der Autor eine Metzgerei und arbeitete als Viehhändler. Er war im Landesverband der Jüdischen Gemeinden Westfalen-Lippe, als Mitglied des Zentralrates der Juden in Deutschland und als stellvertretender Vorsitzender des Auschwitz-Komitees in der Bundesrepublik tätig. Hans Frankenthal starb am 22. Dezember 1999 in Dortmund. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof in Hagen-Eilpe begra- ben. In Erinnerung an ihn verleiht die Stiftung Auschwitz-Komitee seit 2010 einmal jährlich den Hans-Frankenthal- Preis. Die 1999 im Fischer-Verlag erschienene Erstausgabe der Biografie von Hans Frankenthal enthielt ein Begriffsglossar und einen Plan des Kon- zentrationslagers Auschwitz-Monowitz. Sowohl der Lagerplan als auch das Glossar – um neue Stichworte ergänzt – sind in der 2012 im Metro- pol Verlag Berlin publizierten Neuauflage der Biografie nicht mehr Teil der Buchausgabe, sondern im Internet als kostenloses PDF-Dokument online verfügbar gemacht. Inhalt »Arbeitseinsatz« > »Geschlossener Arbeitseinsatz« ............................... 5 »Arisierung« -

They Helped Modernize Turkey's Medical Education and Practice
Gesnerus 65 (2008) 56–85 They Helped Modernize Turkey’s Medical Education and Practice: Refugees from Nazism 1933–1945* Arnold Reisman Summary This paper discusses a dimly lit and largely unknown bit of 20th century history. Starting in 1933, Turkey reformed its medical health care system using invitees fleeing the Nazis and for whom America was out of reach because of restrictive immigration laws and wide-spread anti-Semitic hiring bias at its universities. Among the invitees were several medical scholars who played a large role in westernizing the new Turkish republic’s medical practice and research as well as its school curricula. Keywords: Jewish doctors under Nazism; history of medicine in Turkey; medical education Introduction Starting in 1933, the Nazis’ plan to rid themselves of Jews beginning with intellectuals with Jewish roots or spouses became a windfall for Ataturk’s determination to modernize Turkey. A select group of Germans with a record of leading-edge contributions to their respective disciplines was invited with Reichstag’s backing to transform Turkey’s higher education and the new Turkish state’s entire infrastructure. This arrangement, occurring before the activation of death camps, served the Nazis’ aim of making their universities, professions, and their arts judenrein, cleansed of Jewish influence and free from intelligentsia opposed to fascism. Because the Turks needed the help, Germany could use it as an exploitable chit on issues of Turkey’s neutrality * This paper is based on Arnold Reisman, Turkey’s Modernization: Refugees from Nazism and Ataturk’s Vision, New Academia Publishers (Washington DC 2006). Arnold Reisman, PhD, PE, 18428 Parkland Drive, Shaker Heights, Ohio 44122, USA ([email protected]).