Auschwitz Und Staatssicherheit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dieter Schenk
KRAKAU UND DER WAWEL 1933 - 1945 Auf einem Hügel, der Wawel genannt wird, entstand über dem Weichselbogen und den Dächern der Stadt die Burg von Krakau. Es handelt sich um das Königsschloss und die Kathedrale als Bischofssitz. Seit 1076 war Krakau königliche Hauptstadt und politisches Zentrum des Landes, und seit 1320 wurden mehr als 30 polnische Könige und Königinnen auf dem Wawel gekrönt und zu Grabe getragen. Das Schicksal des Wawel ist so zerrissen wie die Historie Polens. Mehrfach erobert, verteidigt, belagert, ausgeplündert, von der Pest heimgesucht, abgebrannt und zu neuer Blüte gebracht, betrachtet Polen den Wawel als nationales Heiligtum, das immer wieder in Gefahr geriet, wenn Polen durch seine Gegner, wie u.a. die Russen, Preußen und Österreicher, von der Landkarte getilgt werden sollte. So geschehen bei den Teilungen 1772, 1793 und 1795. Die letzte dieser Teilungen dauerte 123 Jahre, als der Wawel zu einer österreichischen Zitadelle herabsank. Eine besondere Rolle in dieser Entwicklung spielten immer auch die Juden, die teils diskriminiert und teils geduldet im Stadtteil Kazimierz ansässig waren. Während die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen friedlich verlief, erfolgte die vierte Teilung 1939 durch den Hitler-Stalin-Pakt. Die Sowjetunion vereinnahmte Ostpolen, während die westlichen Gebiete dem Deutschen Reich zufielen und in Zentralpolen das Generalgouvernement geschaffen wurde, eine Art Kolonialgebiet ohne Völkerrechtsstatus. Da Hitler die Metropole Warschau zu einer Provinzstadt herabwürdigen wollte, wurde Krakau als Hauptstadt des Generalgouvernements bestimmt und der Reichsrechtsführer Hans Frank, bislang Reichsrechtsführer und Minister ohne Geschäftsbereich, zum Generalgouverneur ernannt. Mit dem Verlust des Wawel hatte Polen wieder einmal seine nationale Identität verloren. Als Sitz des Generalgouverneurs war die Burg der Kristallisationspunkt, um den sich die Naziverbrechen in dieser Region drehten. -

Überseehafen Rostock: East Germany’S Window to the World Under Stasi Watch, 1961-1989
Tomasz Blusiewicz Überseehafen Rostock: East Germany’s Window to the World under Stasi Watch, 1961-1989 Draft: Please do not cite Dear colleagues, Thank you for your interest in my dissertation chapter. Please see my dissertation outline to get a sense of how it is going to fit within the larger project, which also includes Poland and the Soviet Union, if you're curious. This is of course early work in progress. I apologize in advance for the chapter's messy character, sloppy editing, typos, errors, provisional footnotes, etc,. Still, I hope I've managed to reanimate my prose to an edible condition. I am looking forward to hearing your thoughts. Tomasz I. Introduction Alexander Schalck-Golodkowski, a Stasi Oberst in besonderen Einsatz , a colonel in special capacity, passed away on June 21, 2015. He was 83 years old. Schalck -- as he was usually called by his subordinates -- spent most of the last quarter-century in an insulated Bavarian mountain retreat, his career being all over three weeks after the fall of the Wall. But his death did not pass unnoticed. All major German evening TV news services marked his death, most with a few minutes of extended commentary. The most popular one, Tagesschau , painted a picture of his life in colors appropriately dark for one of the most influential and enigmatic figures of the Honecker regime. True, Mielke or Honecker usually had the last word, yet Schalck's aura of power appears unparalleled precisely because the strings he pulled remained almost always behind the scenes. "One never saw his face at the time. -

Publikationen Schmaltz 10-2012
Dr. Florian Schmaltz Goethe Universität Frankfurt Historisches Seminar Arbeitsgruppe Wissenschaftsgeschichte Schriftenverzeichnis (Stand: Oktober 2012) Bücher mit Moritz Epple (Hg.), The History of Fluid Mechanics in the 20th Century, Stuttgart: Steiner-Verlag, im Erscheinen, ca. 350 S. Hans Frankenthal, Verweigerte Rückkehr. Erfahrungen nach dem Judenmord. Unter Mitarbeit von Babette Quinkert, Andreas Plake und Florian Schmaltz (Neuauflage), Berlin: Metropol-Verlag, 2012, 191 S. Ludwik Fleck, Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa. [Denkstil und Fakten. Artikel und Zeugnisse.] hrsg. v. Sylwia Werner, Claus Zittel und Florian Schmaltz, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2007, 418 S. Kampfstoff-Forschung im Nationalsozialismus. Zur Kooperation von Kaiser-Wilhelm- Instituten, Militär und Industrie, Göttingen: Wallstein-Verlag, 2005 (= Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, Hrsg. von Reinhard Rürup und Wolfgang Schieder im Auftrag der Präsidentenkommission der Max-Planck-Gesellschaft, Bd. 11), 676 S. Hans Frankenthal, Unwelcome One – Returning Home from Auschwitz. In collaboration with Andreas Planke, Babette Quinkert & Florian Schmaltz, Chicago: Chicago University Press, 2002, 169 S. Hans Frankenthal, Verweigerte Rückkehr. Erfahrungen nach dem Judenmord. Unter Mitarbeit von Babette Quinkert, Andreas Plake und Florian Schmaltz, hrsg. von Wolfgang Benz, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1999, 188 S. 1 Zeitschriften- und Buchbeiträge mit Andreas Plake -
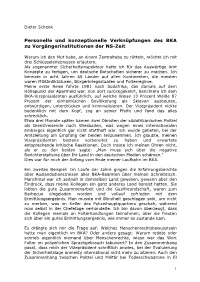
Bka-Historie-Schenk.Pdf
Dieter Schenk Personelle und konzeptionelle Verknüpfungen des BKA zu Vorgängerinstitutionen der NS-Zeit Warum ich den Mut habe, an einem Zentraltabu zu rütteln, möchte ich mit drei Schlüsselerlebnissen erläutern. Als sogenannter Sicherheitsinspekteur hatte ich für das Auswärtige Amt Konzepte zu fertigen, um deutsche Botschaften sicherer zu machen. Ich bereiste in acht Jahren 65 Länder auf allen Kontinenten, die meisten waren Militärdiktaturen, Bürgerkriegsstaaten und Folterregime. Meine erste Reise führte 1981 nach Südafrika, das damals auf dem Höhepunkt der Apartheid war. Von dort zurückgekehrt, berichtete ich dem BKA-Vizepräsidenten ausführlich, auf welche Weise 13 Prozent Weiße 87 Prozent der einheimischen Bevölkerung als Sklaven ausbeuten, entwürdigen, unterdrücken und kriminalisieren. Der Vizepräsident nickte bedenklich mit dem Kopf, zog an seiner Pfeife und fand das alles schrecklich. Etwa drei Monate später kamen zwei Obristen der südafrikanischen Polizei als Dienstreisende nach Wiesbaden, was wegen eines internationalen Embargos eigentlich gar nicht statthaft war. Ich wurde gebeten, bei der Amtsleitung am Empfang der beiden teilzunehmen. Ich glaubte, meinen Vizepräsidenten bestens vorbereitet zu haben und erwartete entsprechende kritische Reaktionen. Doch traute ich meinen Ohren nicht, als er zu den beiden sagte: „Man muss sich über die negative Berichterstattung über Ihr Land in den deutschen Medien schämen.“ Dies war für mich der Anfang vom Ende meiner Laufbahn im BKA. Ein zweites Beispiel: Im Laufe der Jahre gingen die Erfahrungsberichte über Auslandsdienstreisen aller BKA-Beamten über meinen Schreibtisch. Manchmal war ich zeitnah in demselben Land gewesen, gewann aber den Eindruck, dass meine Kollegen ein ganz anderes Land bereist hatten. Sie lobten die gute Zusammenarbeit und die Gastfreundschaft, waren zum Barbecue eingeladen worden und vollauf zufrieden mit dem Ermittlungsergebnis. -

Vorläufiges Findbuch Sekretariate Der Stellvertreter Des Ministers Neiber, Mittig Und Schwanitz Im Ministerium Für Staatssicherheit Der DDR
Vorläufiges Findbuch Sekretariate der Stellvertreter des Ministers Neiber, Mittig und Schwanitz im Ministerium für Staatssicherheit der DDR Archiv zur DDR-Staatssicherheit im Auftrag der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik herausgegeben von Dagmar Unverhau Band 10 _____________ LIT Abteilung Archivbestände der BStU (Hrsg.) Vorläufiges Findbuch Sekretariate der Stellvertreter des Ministers Neiber, Mittig und Schwanitz im Ministerium für Staatssicherheit der DDR Bearbeitet von Elisabeth Larssen und Jana Florczak _____________ LIT Die Deutsche Bibliothek – CIP - Einheitsaufnahme Vorläufiges Findbuch Sekretariate der Stellvertreter des Ministers Neiber, Mittig und Schwanitz im Ministerium für Staatssicherheit der DDR / hrsg. Abteilung Archivbestände der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. - Münster: LIT, 2008 (Archiv zur DDR-Staatssicherheit ; 10 ) ISBN 978-3-8258-1106-8 NE: Elisabeth Larssen, Jana Florczak [Bearbeiter] © LIT VERLAG Berlin Chausseestr. 128 D-10115 Berlin Tel. +49 30-280 40 880 Fax +49 30-280 40 882 E-Mail: [email protected] http://www.lit-verlag.de Inhalt Vorbemerkungen 1 Überlieferung und Benutzung VII 2 Über die Stellvertreter des Ministers – Geschichte und Struktur VIII 3 Sekretariat des Stellvertreters des Ministers, Gerhard Neiber XIX 3.1 Aufgaben und Struktur XIX 3.2 Überlieferungslage und archivische Bearbeitung XXV 3.3 Inhalt der überlieferten Unterlagen XXIX 3.4 Suche nach dem Bernsteinzimmer -

Volker Mall, Harald Roth, Johannes Kuhn Die Häftlinge Des KZ
Volker Mall, Harald Roth, Johannes Kuhn Die Häftlinge des KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfingen Daten und Porträts aller Häftlinge I A bis K Herrenberg 2020 1 Die Recherchen Die Recherchen von Volker Mall, Harald Roth und Johannes Kuhn dauern nun schon über 15 Jahre. Im Staatsarchiv Ludwigsburg fanden sie in den Akten des Hechinger Prozesses das sog. Natzweiler Nummernbuch1. Die dort enthaltene Namensliste der 600 jüdischen Häftlinge stellte die Basis für alle weiteren personenbezogenen Recherchen dar. Weitere wichtige Quellen waren die Totenmeldungen und das Einäscherungsverzeichnis der 99 im Krematorium in Reutlingen eingeäscherten Opfer2 und 269 Häftlingspersonalkarten aus dem Archiv des KZ Stutthof. Alle diese 269 Häftlinge kamen mit dem Transport im Oktober 1944 von Auschwitz nach Stutthof3. Auf 260 dieser Karten ist jeweils die Auschwitznummer angegeben. Außerdem enthielten die bruchstückhaften Listen des Transportes von Auschwitz nach Stutthof4 Namen und Nummern von ca. 160 Häftlingen, die nach Tailfingen kamen. Unter ihnen „zusätzliche“ 64, deren Häftlingspersonalkarten nicht erhalten sind. Von weiteren 40 Häftlingen (v.a. bei den Überlebenden) konnten die Nummern durch andere Quellen erschlossen werden. So konnten mithilfe des Auschwitzkalendariums5 Datum und Herkunft des Transports von über 350 Häftlingen festgestellt werden. Dazu kommen noch etwa 35 Häftlinge, die nachweislich nach Auschwitz kamen, ohne dass ihre Nummer bekannt ist. (In den Transportlisten Dautmergen- Dachau/Allach werden die Häftlinge unter ihrer Natzweiler-Nummer, in den Hailfinger Totenmeldungen unter der Stutthof-Nummer geführt). Danuta Drywa (Stutthof-Archiv) teilte außerdem die Daten von einigen Häftlingen mit (aus dem Einlieferungsbuch Stutthof), die in verschiedenen Transporten aus dem Baltikum nach Stutthof deportiert wurden und von dort aus nach Hailfingen kamen. -

Eli Zborowski Dr
Vol. 33-No.1 ISSN 0892-1571 September/October 2006-Elul/Tishrei 5767 ELI ZBOROWSKI DR. MIRIAM & SHELDON G. ADELSON LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD YAD VASHEM REMEMBRANCE AWARD ne of Eli Zborowski’s most cherished childhood memories is sitting with his r. Miriam Adelson was born and raised in Israel with the shadow of the father, Moshe, in the comfort of their Zarki home on Shabbat afternoon Holocaust ever-present in her life. Her parents, the Ochshorns, fled Poland Oreading and exploring the pearls of wisdom found in Pirkei Avot, The Ethics Djust prior to the war. But significant portions of their families, who chose to of the Fathers. That warm and nurturing weekly interlude came to an abrupt halt in stay, perished during the Shoah. As Miriam so poignantly reveals, “I am the daugh- 1942 when the deportations to the death camps began. Soon after, Moshe ter of a mother who, when she was a teen, lost almost her entire family. One day Zborowski was murdered by the Poles. This thrust Eli, the oldest son, into his first everyone disappeared. I grew up feeling my mother’s pain.” Miriam recalls that fol- of many lifelong leadership roles. During the lowing the war, there was suddenly an influx of cousins in her life whom she had pre- war he was a member of the Jewish Fighters viously not known. Responding to the needs of young family members who lost their Organization, serving as a liaison between parents, the Ochshorns ghettos and non-Jewish partisan units. The brought them from family, his mother, sister, younger brother and Europe and helped himself survived the war in hiding with the help them to become estab- of righteous Poles. -

Katalog, Einzelseiten
Begleitpublikation Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Geleitwort 5 DIE ERRICHTUNG DES KONZENTRATIONSLAGERS 7 BUNA-MONOWITZ 1. Was war die I.G. Farben? 8 2. Die Gründung der I.G. Auschwitz im April 1942 10 3. Das Konzentrationslager Auschwitz 14 4. Zwangsarbeiter bei der I.G. Auschwitz 16 5. Die SS 20 6. Die Mitarbeiter der I.G. Farben 24 DIE HÄFTLINGE IM KONZENTRATIONSLAGER 28 BUNA-MONOWITZ 7. Deportation 30 8. Ankunft 34 9. Zwangsarbeit 37 10. Fachleute 40 11. Hierarchien unter den Häftlingen 42 12. Willkür und Misshandlungen 45 13. Verpflegung 47 14. Hygiene 48 15. Krankheit 50 16. Selektion – Die »Auswahl zum Tode« 53 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | Inhaltsverzeichnis 3 17. Widerstand 56 18. Bombenangriffe 59 19. Todesmärsche 61 20. Befreiung 64 21. Die Zahlen der Toten 66 DIE I.G. FARBEN NACH 1945 UND DIE JURISTISCHE 67 AUFARBEITUNG IHRER VERBRECHEN 22. Die I.G. Farben nach 1945 68 23. Der Nürnberger Prozess gegen die I.G. Farben 70 (1947/48) 24. Die Urteile im Nürnberger Prozess 72 25. Der Wollheim-Prozess 76 (1951 – 1957) 26. Aussagen aus dem Wollheim-Prozess 78 (1951 – 1957) 27. Frankfurter Auschwitz-Prozesse 80 (1963 – 1967) 28. Die politische Vereinnahmung des 81 Fischer-Prozesses durch das SED-Regime 29. Das Ende der I.G. Farben i.L. 82 (1990 – 2003) Impressum 85 4 5 Geleitwort Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz Wirtschaft und Politik im Nationalsozialismus ZUR AUSSTELLUNG Der Chemiekonzern I.G. Farben ließ ab 1941 in unmittelbarer Nähe zum Konzen- trationslager Auschwitz eine chemische Fabrik bauen, die größte im von Deutsch- land während des Zweiten Weltkriegs eroberten Osteuropa. -

La Sucia Historia De IG Farben
Startseite home (engl) francais italiano espanol Photo Artículos Fosgeno IG Farben Venezuela Tea Party Bayer USA BAYER Bhopal Bhopal EEUU Institute / USA La sucia historia de IG Farben 6 de diciembre de 2003 La sucia historia de IG Farben Entre 1933 y 1945 la explotación de los obreros alemanes voluntarios, forzados o esclavos y el monopolio químico tenía un nombre: IG Farben. Después de la derrota alemana las potencias victoriosas acabaron con el trust. Así nacieron BASF, Hoechst o Bayer, pero IG Farben siguio existiendo hasta ayer. El pasado 9 de noviembre el antiguo consorcio IG Farben, una especie de INI o SEPI germana, se ha declarado insolvente, pero ese hecho no significa que vaya a desaparecer de forma inmediata: sus acciones siguen siendo objeto de especulación en los corros bursátiles. La historia de la IG Farben se lee como el historial de un criminal. Fundada en 1925 por las mayores empresas alemanas de química, la IG Farben se convirtió en un importante actor en la política alemana de entreguerras. Fue el mayor agente financiero del partido nazi que lideraba Adolf Hitler. Cuando el "Führer" llegó al poder los grandes dirigentes de la IG Farben le aseguraron que habían solucionado el problema de la falta de petróleo: la fabricación de gasolina artificial. Gracias a los ingenieros y técnicos de la IG Farben, Hitler pudo empezar su guerra por el "espacio vital" en Europa. Los estrategas del trust tenían pensando hacerse con los mercados siguiendo a la victoriosa "Wehrmacht". Facilitaron informaciones sensibles al Comando Supremo y colocaron a agentes en sus sucursales. -

Goethe in Dachau“
Jörg Wollenberg „Goethe in Dachau“. Das Konzentrationslager als Lernort zur Selbstbehauptung in Grenzsituationen Beitrag zur 27. Konferenz des Arbeitskreises zur Aufarbeitung historischer Quellen der Erwachsenenbildung – Deutschland – Österreich – Schweiz - vom 20. bis 23. November 2007 im Wissensturm Linz/Österreich Musikalischer Einstieg: Aus der Mauthausen Trilogie von Mikis Theodorakis (CD 2000 Verlag ‚pläne’88840). In Erinnerung an die Befreiung am 7. Mai 1945, 1995 uraufgeführt im KZ Mauthausen; Nr. 1: Das Hohelied („Ihr Mädchen aus Auschwitz, Ihr Mädchen aus Dachau, Habt ihr meine Liebste nicht gesehn?“, gesungen von Elinoar Moav Veniadis, Auszug aus dem Stück von 3.33 Minuten). Dazu Folie 1: Programm des Osterkonzerts im KZ Sachsenhausen im Block 28 am 26. April 1943 mit Beteiligung des tschechischen Streichquartetts unter Leitung von Bohumir Cervinka (vgl. Kuna,1998, S.260). Das nicht weit von Linz entfernte, kurz nach dem „Anschluss“ Österreichs an das „Dritte Reich“ eingerichtete KZ Mauthausen erlangte mit seinen rund 40 Außenlagern in der ersten Kriegshälfte mit der Lagerstufe III die politische Funktion eines Tötungslagers, in dem mehr als die Hälfte der über 200.000 Häftlinge aus Europa und den USA zwischen 1938 und 1945 ums Leben kamen. Mehrere tausend Häftlinge wurden ab Sommer 1941 im Rahmen der Aktion 14 f 13 in die am Rande von Linz gelegene Tötungsanstalt Hartheim gebracht und mittels Giftgas erstickt.1 Selbst nach der Umwandlung in ein Zwangsarbeitslager für die Rüstungsindustrie verzeichnete die Lagerleitung Todesraten ab 1942 von 30 bis 40 Prozent. Im Gegensatz zu den anderen großen Konzentrationslagern und Ghettos im „Deutschen Reich“ blieben die individuellen Überlebensstrategien der Häftlinge in Mauthausen auch deshalb eingeschränkt, weil sie kaum auf kulturelle Freizeitaktivitäten zurückgreifen konnten. -

England and Wales High Court (Queen's Bench Division) Decisions >> Irving V
[Home ] [ Databases ] [ World Law ] [Multidatabase Search ] [ Help ] [ Feedback ] England and Wales High Court (Queen's Bench Division) Decisions You are here: BAILII >> Databases >> England and Wales High Court (Queen's Bench Division) Decisions >> Irving v. Penguin Books Limited, Deborah E. Lipstat [2000] EWHC QB 115 (11th April, 2000) URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2000/115.html Cite as: [2000] EWHC QB 115 [New search ] [ Help ] Irving v. Penguin Books Limited, Deborah E. Lipstat [2000] EWHC QB 115 (11th April, 2000) 1996 -I- 1113 IN THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION Before: The Hon. Mr. Justice Gray B E T W E E N: DAVID JOHN CADWELL IRVING Claimant -and- PENGUIN BOOKS LIMITED 1st Defendant DEBORAH E. LIPSTADT 2nd Defendant MR. DAVID IRVING (appered in person). MR. RICHARD RAMPTON QC (instructed by Messrs Davenport Lyons and Mishcon de Reya) appeared on behalf of the first and second Defendants. MISS HEATHER ROGERS (instructed by Messrs Davenport Lyons) appeared on behalf of the first Defendant, Penguin Books Limited. MR ANTHONY JULIUS (instructed by Messrs Mishcon de Reya) appeared on behalf of the second Defendant, Deborah Lipstadt. I direct pursuant to CPR Part 39 P.D. 6.1. that no official shorthand note shall be taken of this judgment and that copies of this version as handed down may be treated as authentic. Mr. Justice Gray 11 April 2000 Index Paragraph I. INTRODUCTION 1.1 A summary of the main issues 1.4 The parties II. THE WORDS COMPLAINED OF AND THEIR MEANING 2.1 The passages complained of 2.6 The issue of identification 2.9 The issue of interpretation or meaning III. -
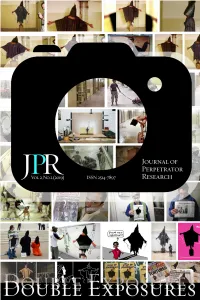
Untitled
The Journal of Perpetrator Research (JPR) is an Issue Editors inter-disciplinary, peer-reviewed, open access Dr Susanne C. Knittel (Utrecht University) journal committed to promoting the scholarly Dr Stéphanie Benzaquen-Gautier study of perpetrators of mass killings, political (University of Nottingham) violence, and genocide. The journal fosters scholarly discussions General Editors about perpetrators and perpetratorship across Dr Susanne C. Knittel (Utrecht University) the broader continuum of political violence. Dr Emiliano Perra (University of Winchester) JPR does not confine its attention to any Dr Uğur Ümit Üngör (Utrecht University) particular region or period. Instead, its mission is to provide a forum for analysis of perpetrators Advisory Board of genocide, mass killing and political violence Dr Stephanie Bird (UCL) via research taking place within the fields of Dr Tomislav Dulic (Uppsala University) history, criminology, law, forensics, cultural Prof. Mary Fulbrook (UCL) studies, sociology, anthropology, philosophy, Prof. Alexander L. Hinton (Rutgers University) memory studies, psychology, politics, litera- Prof. A. Dirk Moses (University of Sydney) ture, film studies and education. In providing Prof. Alette Smeulers (University of Tilburg) this interdisciplinary and cross-disciplinary Prof. Sue Vice (University of Sheffield) space the journal moves academic research on Prof. James Waller (Keene State College) this topic beyond, and between, disciplinary boundaries to provide a forum in which robust Copyeditor and interrogative research and cross-curricular Sofía Forchieri (Utrecht University) discourse can stimulate lively intellectual en- gagement with perpetrators. Layout & Typesetting JPR thus not only addresses issues related Sofía Forchieri (Utrecht University) to perpetrators in the past but also responds Dr Kári Driscoll (Utrecht University) to present challenges.