PDF Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bern Solothurn Biel/Bienne
Breitenbach / Zwingen Waldenburg Egerkingen Passwang Langenbruck Glovelier Delémont Industrie 282 Olten Choindez La Charbonnière 281 Lajoux Neuendorf Cras-des-Mottes 353 343 344 Balsthal Oberbuchsiten Olten Belprahon 279 280 345 Niederbuch- Lajoux siten Oensingen Moutier Wolfisberg 352 Wolfwil/Olten Oberbalmberg Wiedlisbach Farnern Niederbipp Olten Bellelay Unterer Gänsbrunnen Grenchenberg 216 Murgenthal Les Reussilles 253 Wangen bif. sur Montfaucon a. d. Aare 193 191 Saignelégier Tramelan Reconvilier 215 Riedholz Lommiswil Les Reussilles 252 251 Wangen- 351 341 342 ried Le Noirmont Grenchen 201 200 Solothurn 195 Les Breuleux Mont-Tramelan 321 Romont BE Grenchen Nord Selzach 190 Les Breuleux-Eglise Inkwil Reuchenette-Péry Ziegelei Derendingen Gaswerk Langenthal 322 331 Bolken Frinvillier- Lengnau Grenchen Süd Taubenloch Horriwil Aeschi Wanzwil Mont-Soleil Arch Pieterlen Lohn- Etziken Centre Lüterkofen Industrie Krieg- Evilard/ Boujean stetten 325 Leubringen West 250 323 196 Magglingen/ 194 300 Büren St-Imier Macolin Steinhof Herzogen- Thunstetten Biel Mett Safnern a.d. Aare 192 Les Prés-d‘Orvin Biel/Bienne Gächliwil Bätter- Utzenstorf buchsee 315 kinden Grossdietwil Nidau 229 324 Orpund 218 217 197 Renan BE Schnottwil Koppigen Grasswil Huttwil 152 Prêles Balm Aefligen Schwarzenbach La Chaux-de-Fonds Studen 153 Bellmund 311 Wynigen 301 180 314 Busswil Fraubrunnen Bielersee Ligerz Lac de Bienne 155 Lueg Hüswil Täuffelen Wengi b. B. Kirchberg- Lignières 228 Alchenflüh Affoltern-Weier 181 Lyss Messen 150 La 312 Wyssachen Eriswil Luzern Zeichenerklärung -

Bieler Jahrbuch Annales Biennoises
Bieler Jahrbuch Annales biennoises 2013 2013 Bieler Jahrbuch Annales biennoises 2013 Bieler Jahrbuch / Annales biennoises Redaktion und Lektorat/Rédaction et lecture: Herausgeber: Arbeitsausschuss Bieler Jahrbuch / Reto Lindegger, Biel/Bienne Comité de publication: Erich Fehr, Hans-Ueli Aebi, Virginie Borel, Nicoletta Cimmino, Edna Epelbaum, Layout und Druck/Mise en pages et impression: David Gaffino, Marie-Pascale Hauser, Tobias Kaestli, W. Gassmann AG, Biel/Bienne Brigitte Kübli, Reto Lindegger, Clemens Moser, Marie-Thérèse Sautebin, Esther Thahabi. © 2014 Präsidialdirektion der Stadt Biel / 2014 Mairie de la Titelbild/Couverture: ville de Bienne Schlussfeier am Eidgenössischen Turnfest 2013. Foto: Enrique Muñoz Garcia ISSN 1423-7091 Table des matières | Annales biennoises 2013 | III 1. Teil: Allgemeine Beiträge 1re partie: Documentation d’intérêt général Princesse Mahi Ailleurs 2 (Mahité Orban) Sanja Josipovic Warten 7 Sanja Josipovic Wochenmarkt 8 Eva Leuenberger s’entreferir 9 Marie-Pierre Walliser Bielmatten, par 47.13600 Nord et 07.24995 Est 12 (-Klunge) Antonia Jordi «Mit Gott mit Ehren soll sich mein glükh mehren» Bieler Kompanien in Fremden Diensten (17. Jahrhundert) 18 Peter Fasnacht Mente et malleo: Mit Geist und Hammer! 32 Dr. Max Antenen Ein historischer Rückblick auf die geologische Erforschung des Seelandes und des Juras in der Umgebung von Biel 34 Nicoletta Cimmino Biel – weg vom schlechten Image des medialen Sorgenkindes 77 IV | Bieler Jahrbuch 2013 | Inhaltsverzeichnis 2. Teil: Beiträge zum Jahr 2013 2e partie: Documentation concernant l’année 2013 WIRTSCHAFT | ÉCONOMIE Sibylle Thomke Technik zum Anfassen statt Broschüren 80 Esther Thahabi Das WIBS Jahr 2013 83 KULTUR | CULTURE Alexandre Wenger SYS 2013 ou «L’aventure qui continue» 88 Werner Hadorn Neues Leben im alten Keller Wie es nach gut vier Jahrzehnten «Kulturtäter» im Kellertheater Théâtre de Poche weitergehen soll. -

PDF Download
I I I t I '. i* .-*.Jß{ffrtllr' r 5'!'s€iE***i'*" I I -*[:,!$$FT I ,nL !81 I 1 ,\!r , '..,t ?ilt 10O% AfChäOlOgie SChWeiZ i00 der schönsten archäologischen objekte der schweiz: ein Führer 1OO% ArCh6OlOgie SUiSSe Les 100 plus beaux sites arch6ologiques de Suisse: un guide .i t: .. I ilF,r 100% AfCheOlOgia SViZzefa 100 fra i piü bei siti archeologici della Svizzera: una guida r ;p I ,. i, l, r Archäologie Schweiz - Arch6ologie Suisse - Archeologia Svizzera, Basel 2007 n n r-t Herausgegeben von Archäologie Schweiz l-1 rlr- 'l- ln Zusammenarbeit mit den kantonalen archäologischen Diensten \l- -l Projektleitung: Urs Niffeler, Catherine May Castella, r'1 Simonetta Biaggio Simona und Urs Leuzinger f-l Verfasst von zahlreichen Autorinnen und Autoren (s. S. 123) Entstanden dank der Mitarbeit vieler Beteiligter (s. S. 125) .{ {*^l Die Herstellung wurde unterstützt durch die {-- I Loterie Romande Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW Avec le soutien de la @ i1 lsBN 978-3-908006-69-5 O by Archäologie Schweiz - Arch6ologie Suisse - Archeologia Svizzera, Basel 2007 n n r f n n tl TT : t-r tl {l 1OO% AfChäOlOgie SChWeiZ 100 der schönsten archäotogischen objekte der schweiz: ein Führer C lOO% Afch6ologie Suisse Les 100 plus beaux sites archdologiques de Suisse: un guide {__, 1OO% AfCheOlOgia SVizzerä 100 fra i piü beisiti archeologicidetta Svizzera: una guida U U U L Archäologie Schweiz - Archdologie Suisse - Archeologia Svizzera, Basel 2007 Reiter, Hund und Pflanze. Bronzene SchildbeschläSteile (Sespiegelt) aus einem Langobardenkriegergrab in Stabio fl, Z lh. n.Chr. Höhe Pferd plus Reiter 8,2 cm. -

Contribution À L'étude Des Cluses Du Jura Septentrional
Université de Neuchâtel Institut de géologie Contribution à l'étude des cluses du Jura septentrional Thèse présentée à (a Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel par Michel Monbaron Licencié es sciences Avril 1975 Imprimerie Genodruck, Bienne IMPRIMATUR POUR LA THESE Contribution al Jura septentrional deMQns.i.eur....Mii:hel...JïlDZLhar.Qn. UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL FACULTÉ DES SCIENCES La Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, sur le rapport des membres du jury, .Ml*...ae.s....px.QÍfis.s.eur.s....D*..Jiub.ert.+...P>...XMu.Y£.„„ _(BêSan£QrJ^_J_c£ autorise l'impression de la présente thèse sans exprimer d'opinion sur les propositions qui y sont contenues. Neuchâtel, le 9.~ms,xs....l9l6. Le doyen : P. Huguenin Thèse publiée avec l'appui de : l'Etat de Neuchâtel et l'Etat de Berne. Ce travail a obtenu Le Prix des Thèses 1976 de la Société Jurassienne d'Emulation. IV RESUME Une cluse jurassienne caractéristique, celle du Pichoux, est étudiée sous divers aspects. La localisation de la cluse dans l'anticlinal de Raimeux dépend en premier lieu d'un ensellement- d'axe au toit de l'imperméable oxfordien, ainsi que d'un relais axial dans le coeur de Dogger. Les systèmes de fissuration, principalement les deux sys tèmes cisaillants dextre et sénestre, ont fourni la trame sur laquel le s'est imprimée la cluse. Hydrogéologiquement, celle-ci fait office de niveau de base karstique pour de vastes territoires situés surtout à l'W ("bordure orientale des Franches-Montagnes). La principale sour ce karstique qui y jaillit est celle de Blanches Fontaines: surface du bassin 48,8 km^; débit moyen annuel 1,25 m3/sec; valeur moyenne de l'ablation karstique totale: 0,082 mm/an. -

Liniennetz Biel Und Umgebung Plan Du Réseau Bienne Et Environs
Liniennetz Biel und Umgebung Plan du réseau Bienne et environs Magglingen La Chaux-de-Fonds Reuchenette-Péry Linien / Lignes 314 Gare End der Welt 315 79 Evilard Les Prés-d’Orvin école Le Grillon 70 315 73 321 Vorhölzli–Stadien Magglingen Leubringen 1 Bois-Devant–Stades 79 Evilard Plagne Plagne Zum Alten Schweizer Evilard Orvin Mösliacker–Orpundplatz Alte Chapelle Spitalzentrum Place du Cerf Bas du Village 2 La Lisière Beaumont Bellevue Frinvillier Frinvillier Gare Vauffelin Petit-Marais–Place d’Orpond Sporthalle Centre hospitalier Orvin Cheval BlancOrvinMoulin Petit- Epicerie Orvin place du village Village Rte de Plagne Nidau–Löhre Place du village église Frinvillier Vauffelin posteLes OeuchesVauffelin RomontRte BEde Vauffelin 4 Kapellenweg 5 Les Prés-d’OrvinCh. des CernilsSous les Roches bif. sur Vauffelin Champs-Verlets 71 Romont BE Nidau–Mauchamp Helvetiaplatz 6 Frinvillier 5 Biel Bahnhof–Spitalzentrum Seilbahn Place Helvetia bif. sur Bienne Bienne Gare–Centre hospitalier 301 Vauffelin Vauffelin Port/Nidau–Spitalzentrum PavillonwegTschärisplatzPlace deGrausteinweg la CharrièreChemin Pierre-GriseSydebuswegChemin des Chatons Eichhölzli KlooswegChemin du ClosHöhewegLa Haute-Route 6 Magglingen Suze Port/Nidau–Centre hospitalier Chemin du Pavillon Petit-Chêne / Macolin s Brügg–Goldgrube Alpenstrasse Spiegel Mahlenwald bif. sur Plagne 7 Brügg–Mine d’Or Forêt de Malvaux Rue des Alpes Miroir Schüs Dynamic Test Center Hohfluh Biel Reuchenettestr. 8 Klinik Linde–Fuchsenried Franz. Kirche Leubringenbahn Katholische KircheSonnhalde Pilatusstrasse Ried Bienne Rte de Reuchenette Fuchsenried Clinique des Tilleuls–Fuchsenried 301 Eglise catholique Eglise française Funi Evilard Rue du Pilate Schiffländte–Schulen Linde Rebenweg 8 9 Débarcadère–Ecoles Tilleul Ch. des Vignes Biel Bahnhof–Rebenweg 11 Juraplatz 11 Place du Jura Lienhardstrasse SchlössliSchulhaus Bienne Gare–Ch. -

Erfrischende Aktivitäten Activités Autour De L'eau
JURA BERNOIS BIEL/BIENNE SEELAND WANDERUNGEN AB AUF‘S VELO WASSERAKTIVITÄTEN BADESPASS RANDONNÉES À VÉLO ACTIVITÉS AQUATIQUES BAIGNADE ERFRISCHENDE AKTIVITÄTEN HIKES ON YOUR BIKE! WATER ACTIVITIES BATHING ACTIVITÉS AUTOUR DE L‘EAU REFRESHING ACTIVITIES Die schönsten Wanderungen entlang des Wassers. Die Region Biel Erfrischende Fahrradtouren am Wasser. Die Velotouren rund um den Abenteuerliche Entdeckungstouren auf dem Wasser. Über das Wasser Strände und Badeplätze in der Region. Geniessen Sie während der Seeland und der Berner Jura bieten eine Vielfalt von Wanderungen an Bielersee oder entlang der Aare sind ein schönes Tagesprogramm für zu gleiten ist eine bezaubernde Aktivität und bietet die Möglichkeit, die heissen Sommertage erfrischende Stunden am Wasser. Für Erholung den Ufern der Gewässer. Umgeben von Weinreben bewundern Sie das die ganze Familie. Die relativ flachen Routen bieten unterwegs viele Natur aus einer anderen Perspektive zu entdecken. Die Wassersportzen- sorgen die kleinen, einsamen Kiesel- und Sandstrände am Bielersee, für glitzernde Blau des Bielersees in Kontrast mit den grünen Hügeln des Gelegenheiten für einen Sprung ins kühle Nass oder ein kräftetankendes tren des Bielersees vermieten Pedalos, Stand Up Paddle Boards sowie Trubel und Spass ist in den Badis mit Wasserrutschen, Sprungtürmen, Unsere Tipps | Nos Seelandes und den weissen Alpen in der Ferne. An besonders heissen Picknick. Entdecken Sie wunderschöne, sehenswerte Ortschaften, wie Kanus und Kajaks für abenteuerliche Ausflüge. Auch begleitete Touren Restaurants und Spielplätzen gesorgt. Ein Badeerlebnis für Gross und conseils | Our Tipps: Tagen locken die zahlreichen Schluchten mit tausend und einem Wasser- Büren an der Aare, Aarberg oder die Winzerdörfer am Nordufer des sind auf Anfrage möglich. Egal ob sportlich oder gemütlich, jeder kann Klein! j3l.ch/aqua fall und sorgen mit ihrer Frische für Erholung in unberührter Natur. -

„Unterwegs Sein“
Schweizer-Wegstrecken - (Broschüren im PDF-Format) „Unterwegs sein“ 1 - Konstanz - Einsiedeln („Schwabenweg“) 2 - Rorschach - Einsiedeln („Rorschacher Ast““) 3 - Einsiedeln-Flüeli-Ranft - Brünig („Innerschweizer Weg“) auf dem Jakobsweg 4 - Brünig-Interlaken-Amsoldingen („Berner Oberland Weg“) 5- Amsoldingen-Fribourg-Romont („Gantrisch/Freiburg Weg“) in der Schweiz 6 - Romont-Lausanne-Genève („Romandie Weg“) 7 - Luzern-Rüeggisberg-Schwarzenburg („Luzerner-Weg“) 8 - Rankweil - Einsiedeln („Vorarlberg-Appenzeller Weg“) 9 - Thurgauer Klosterweg (Randen/Schaffhausen - Tobel) 10 - Basel-Jura-DreiSeen Weg (Basel-Payerne) X - Fahrrad-Jakobsweg Schweiz Kontaktadresse Geschäftsstelle Jakobsweg.ch Unter den Häusern 12, Postfach 115 CH-3800 Unterseen Tel 0041 (0)33 655 04 00 Mail: [email protected] Beherbergung/Verpflegung: www.jakobsweg.ch Notfall-Telefonnummer in der Schweiz (Ambulanz): 144 Wichtiger Hinweis Der Weg wurde im Projekt Pilgerjahr 2010 von frei schaffenden Autoren und Vereinsmitgliedern in Freiwilligenarbeit, nach einer Begehung und basierend auf dem jeweiligen Wissensstand beschrieben. Die Genauigkeit der Inhalte und des Wegverlaufs kann sowohl von den Autoren als auch vom Verein jakobsweg.ch m Sinne einer Produkthaftung, nicht garantiert werden. Pil- gerinnen und Pilger werden deshalb gebeten, immer den offziellen gelebn Wegweisern der Schweizer-Wanderwege zu folgen und uns allfällige Unstimmigkeiten zu melden. Wir danken! (10) Basel-Jura-Dreiseen - Weg „Anschlussweg Basel-Payerne“ Impressum 2011, Projektgruppe Anschlussweg, Leitung: -

Liniennetz Bern
www.fahrplanfelder.ch 2021 1 Region 30.000 Region Bern Liniennetz Bern Liniennetz Bern Münchenbuchsee Hüslimoos Seedorf–Lyss Wahlendorf Zollikofen 105 104 Bahnhof Jetzikofen- KirchlindachKirchlindach Oberlindach Webergut- Schäferei Blinden- Wydacker strasse Kirche Friedhof Käserei strasse schule Weissenstein Abzw. 107 Säriswil 106 Hirzenfeld 36 102 34 Biel/Bienne Möriswil Abzw. Schützenrain Solothurn Burgdorf 113 101 Schulhaus Kreuz Schulhaus GeisshubelErlachplatz Schüpfenried Ortschwaben Betagten- Oberzollikofen Gehracker heim 34 Alte Post Bahnhof Post Postgasse Unterzollikofen 41 Breitenrain Aarberg Uettligen Dorf KänelgasseGrubenwegReichen- Bahnhof Altikofen Nord Heimenhaus bach Aeschebrunnmatt Steinibach West 100 Schule Aarmattweg Herrenschwanden Bahnhof Illiswil Riedhaus Ausserort- Oeschenweg Altikofen Süd Fischrainweg schwaben Dorf Aarestrasse Schaufelacker Friedhagweg 33 Talgut Zentrum Oberdettigen BremgartenKunoweg Bremgarten Bremgarten 36 Breitenrain Oberwohlen 21 Post Worblaufen Sandhof Schloss Bahnhof Wylergut Wohlen Gemeindehaus Mööslimatt Kalchacker 26 Bennenboden Chutze Scheibenrain Thalmatt Jaunweg Stauffacher- brücke 36 M‘buchsee Hüslimoos Hinterkappelen Fährstr. Pillonweg Wylerbad West Post Aumatt Ländli Sustenweg Schulhaus Wyler- Felsenau- Tiefenau Wylergut Winkelriedstr. Kappelenring Nord 101 Schlossmatt strasse huus Seftau Dändliker- 20 33 Breitfeld Rossfeld Felsenau weg 41 Ost Hinterkappelen Bernstrasse Halenbrücke Äussere Enge Bahnhof Aare kirche Wankdorf Innere Enge Schützen- Markus- Eymatt Camping 11 Haldenstr. -

Liniennetz Solothurn–Oberaargau Balsthal
Liniennetz Solothurn–Oberaargau Balsthal Wolfisberg Niederbippstrasse Rumisberg Schoren Weissacker 58 Niederbipp Industrie Olten/Basel/Zürich Oensingen Farnern Jura 58 Wolfisberg Alpenblick Rumisberg Bären Niederbipp Wiedlisbach Pflegeheim Wiedlisbach Oberbipp Buchli NiederbippScharnageln Dorf Holzhäusern Bannwil Olten/Basel/Zürich Bahnhof Attiswil Kirchgasse Stockrain Roggwil-Wynau Wiedlisbach Wangenstrasse Aarwangen Schloss Flumenthal Langenthal Basel/ Aarwangen Industrie Nord Kaltenherberg Delémont/ Wangen a. A. Aarenbrücke Moutier Riedholz Aarwangen Vorstadt 63 Roggwil Schmitten Aare Hard-Mumenthal Bei den Weihern Nencki Wangen a. A. Zytglogge Langenthal Gaswerk 51 Roggwil Dorf Feldbrunnen Gaswerkstrasse 58 Hardau Roggwil Buchägerten Wangen a. A. Bahnhof Schulen Hard St. Katharinen Bäregg Wangen a. A. Unterführung St. Urban Solothurn Sternen Walliswil Seilerei Waldhof Walliswil Post Langenthal Bahnhof BützbergUnterdorfLangenthal Zelgli 63 Wangenried Unterdorf Sonne Dreilinden Wiesenstrasse St. Urban 51 Spital Solothurn Käserei 64 Tell/Kantonal- 63 Ziegelei Linde Stalden Zelgligasse Baseltor 52 bank Elzmatte Walliswil Tal Tell 64 Schoren- Lindenhof Ochsen Passhöchi Elzweg Wangenried Schule Heimenhausen Riedgasse Neuquartier Schorenstrasse Rössli Luterbach-Attisholz Wangenried Sägerei Bleichestrasse Schützenhaus Heimenhausen Post Bützberg Wyssenried Löwenplatz Röthenbach Neuhüsli Langenthal Neuhof Deitingen Post Mittelstrasse Chrump Obersteckholz Post Inkwil Bahnhof Blumenstrasse Wanzwil Post Obersteckholz Am Wald Herzogenbuchsee Jurablick -

Biel the Town of Biel, the Metropolis of Swiss Watchmaking, Lies at the Eastern End of Lake Biel, at the Foot of the Jura in the Delightful Lake Region
Biel The town of Biel, the metropolis of Swiss watchmaking, lies at the eastern end of Lake Biel, at the foot of the Jura in the delightful Lake Region. The charm of bilingualism, the intact old town and its location as the gateway to the three peripheral Jura lakes (Lakes Biel, Neuchâtel and Murten) make the town an attractive starting point, but also a destination for excursions. Tourismus Biel Seeland Bahnhofplatz 2501 Biel/Bienne T +41 (0)32 329 84 84 F +41 (0)32 329 84 85 [email protected] http://www.biel-seeland.ch 200 m 1000 ft Biel is the only town in Switzerland in which German and French are spoken side by side in equal measure. One senses the relaxed mentality here resulting from the mixture of these two languages. In 2002, Biel was one of the four exhibition locations for EXPO. Architecturally, Biel is a town of many facets. The modern part of the city with its high-rise buildings lies at lake level which then gives way, on a slight incline, to the intact old town with its gothic town church stemming from the 15th century. In 2004, Biel was awarded the Wakker Prize by the Swiss Heritage Society for the exemplary manner in which it conserved its, in part, outstanding stock of © MySwitzerland.com - Schweiz Tourismus - Page 1/15 20th century buildings. Examples can be found in the new town, where uniform districts built in the ‘new construction’ style came into being in the 1920s and ‘30s. General Info Canton: Berne The town of Biel is a tradition-imbued watch metropolis in which this Swiss craft is still fostered. -

The Duties of the Swiss Federal Roads Office
Contents 2006/2007 Page The duties of the Swiss Federal Roads Office (FEDRO) 2 Classification of motorways 3 Redistribution of financial responsibility: a reform project with significant consequences 4/5 FEDRO regional offices: locations, areas of responsibility 6 Via sicura – enhancing road safety in Switzerland 7/8 Status of construction work as of the end of 2006 9 Road works on the motorway network 10-13 1.321 billion Swiss francs for motorway construction in 2007 14 European trunk roads passing through Switzerland 15 Swiss motorway sections scheduled to be opened to traffic in 2007 16/17 Subsidised areas 18 Swiss motorway and main roads network 19 Total length by road category 20/21 List of motorway tunnels 22 Tunnel safety 23 Motorway service stations 24 Motorway police stations 25 Heavy goods vehicle inspections in 2006 26/27 Traffic volume on Swiss motorways in 2005/2006 28 Traffic volume on the north-south transit axes: statistics for 2006 29 Traffic flow on Switzerland’s motorways in 2005 30 Traffic jams on Switzerland’s motorways 31 Main causes of traffic jams in 2005 32 Registration of new road vehicles 33 2006 statistics for cars and motor cycles in Switzerland 34 Number of cars per capita in Europe 35 Administrative measures: statistics for 2006 36 New legal provisions governing road traffic 37/38 Approval of vehicle types and modifications 39 Cantonal civil engineering and motorway authorities 40 Cantonal police headquarters 41 Road traffic departments 42 Motorway maintenance offices 43 Financing 44 Construction, maintenance and operating costs 45 Income and expenditure in the roads sector 46/47 Useful web sites 48 2006/2007 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera 2 Confederaziun svizra BSwiss Federal Roads Office FEDRO THE DUTIES OF THE The Swiss Federal Roads Office (FEDRO) is the Swiss authority that SWISS FEDERAL ROADS is responsible for the country’s road infrastructure and private road OFFICE transport. -
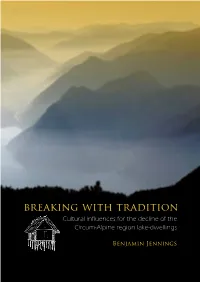
Breaking with Tradition Breaking
Jennings breaking with tradition Over 150 years of research in the Circum-Alpine region have produced a vast with tradition breaking amount of data on the lakeshore and wetland settlements found throughout the area. Particularly in the northern region, dendrochronological studies have provided highly accurate sequences of occupation, which have correlated, in turn, to palaeoclimatic reconstructions in the area. The result has been the general conclusion that the lake- dwelling tradition was governed by climatic factors, with communities abandoning the lakeshore during periods of inclement conditions, and returning when the climate was more favourable. Such a cyclical pattern occurred from the 4th millennium BC to 800 BC, at which time the lakeshores were abandoned and never extensively re- occupied. Was this final break with a long-lasting tradition solely the result of climatic fluctuation, or were cultural factors a more decisive influence for the decline of lake- dwelling occupation? Studies of material culture have shown that some of the Late Bronze Age lake- dwellings in the northern Alpine region were significant centres for the production and exchange of bronzework and manufactured products, linking northern Europe to the southern Alpine forelands and beyond. However, during the early Iron Age the former lake-dwelling region does not show such high levels of incorporation to long-distance exchange systems. Combining the evidence of material culture studies with occupation patterns and burial practices, this volume proposes an alternative to the climatically-driven models of lake-dwelling abandonment. This is not to say that climate change did not influence those communities, but that it was only one factor among many.