PDF Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SCHNITZTURM Weltweit | Europa | Schweiz | Kanton Nidwalden | Stansstad
| | News Burgen Literatur Links Glossar Exkursionen Forum Gastautoren SCHNITZTURM Weltweit | Europa | Schweiz | Kanton Nidwalden | Stansstad Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! Direkt ans Wasser gebauter mittelalterlicher Wohnturm, der in die weitläufigen Uferbefestigungen von Stansstad integriert war und damit den nördlichen Zugang nach Unterwalden überwachte. Eine permanente Ausstellung mit ausführlichen Informationen und Modellen des Turms befindet sich unmittelbar vor der Anlage. Geografische Lage (GPS) WGS84: 46° 58' 51.36" N, 08° 20' 15.62" E Höhe: 435 m ü. M Topografische Karte/n Schweizer Landeskarte: 668.400 / 203.710 Kontaktdaten Gemeindekanzlei Stansstad | CH-6362 Stansstad Tel: +41 (0)79 338 02 22 | E-Mail: [email protected] Warnhinweise / Besondere Hinweise zur Besichtigung keine Anfahrt mit dem PKW Stansstad liegt am südwestlichen Ende des Vierwaldstättersees direkt an der Autobahn A2. Parkplätze im Zentrum vorhanden. Anfahrt mit Bus oder Bahn Regelmässige direkte Bahnverbindung von Luzern nach Stansstad. Wanderung zur Burg Der Schnitzturm befindet sich unmittelbar am Seeufer und ist vom Bahnhof und vom Dorfzentrum her in wenigen Schritten zu Fuss erreichbar. Öffnungszeiten Die Ausstellung zum Turm befindet sich im Freien und ist jederzeit frei zugänglich. Der Turm selbst kann jeweils vom 1. Mai bis zum 30. September von 8 bis 17 Uhr bestiegen werden. Eintrittspreise k.A. Einschränkungen beim Fotografieren und Filmen ohne Beschränkung Gastronomie auf der Burg keine Öffentlicher Rastplatz keiner Übernachtungsmöglichkeit auf der Burg keine Zusatzinformation für Familien mit Kindern keine Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer für Aussenbesichtigung möglich Klicken Sie in das jeweilige Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! Das ehemalige Fischerdorf Stansstad liegt am kürzesten Weg von Luzern nach Unterwalden. -

Bern Solothurn Biel/Bienne
Breitenbach / Zwingen Waldenburg Egerkingen Passwang Langenbruck Glovelier Delémont Industrie 282 Olten Choindez La Charbonnière 281 Lajoux Neuendorf Cras-des-Mottes 353 343 344 Balsthal Oberbuchsiten Olten Belprahon 279 280 345 Niederbuch- Lajoux siten Oensingen Moutier Wolfisberg 352 Wolfwil/Olten Oberbalmberg Wiedlisbach Farnern Niederbipp Olten Bellelay Unterer Gänsbrunnen Grenchenberg 216 Murgenthal Les Reussilles 253 Wangen bif. sur Montfaucon a. d. Aare 193 191 Saignelégier Tramelan Reconvilier 215 Riedholz Lommiswil Les Reussilles 252 251 Wangen- 351 341 342 ried Le Noirmont Grenchen 201 200 Solothurn 195 Les Breuleux Mont-Tramelan 321 Romont BE Grenchen Nord Selzach 190 Les Breuleux-Eglise Inkwil Reuchenette-Péry Ziegelei Derendingen Gaswerk Langenthal 322 331 Bolken Frinvillier- Lengnau Grenchen Süd Taubenloch Horriwil Aeschi Wanzwil Mont-Soleil Arch Pieterlen Lohn- Etziken Centre Lüterkofen Industrie Krieg- Evilard/ Boujean stetten 325 Leubringen West 250 323 196 Magglingen/ 194 300 Büren St-Imier Macolin Steinhof Herzogen- Thunstetten Biel Mett Safnern a.d. Aare 192 Les Prés-d‘Orvin Biel/Bienne Gächliwil Bätter- Utzenstorf buchsee 315 kinden Grossdietwil Nidau 229 324 Orpund 218 217 197 Renan BE Schnottwil Koppigen Grasswil Huttwil 152 Prêles Balm Aefligen Schwarzenbach La Chaux-de-Fonds Studen 153 Bellmund 311 Wynigen 301 180 314 Busswil Fraubrunnen Bielersee Ligerz Lac de Bienne 155 Lueg Hüswil Täuffelen Wengi b. B. Kirchberg- Lignières 228 Alchenflüh Affoltern-Weier 181 Lyss Messen 150 La 312 Wyssachen Eriswil Luzern Zeichenerklärung -

Essays on British Women Poets B Studi Di Letterature Moderne E Comparate Collana Diretta Da Claudia Corti E Arnaldo Pizzorusso 15
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Florence Research ESSAYS ON BRITISH WOMEN POETS B STUDI DI LETTERATURE MODERNE E COMPARATE COLLANA DIRETTA DA CLAUDIA CORTI E ARNALDO PIZZORUSSO 15 SUSAN PAYNE ESSAYS ON BRITISH WOMEN POETS © Copyright 2006 by Pacini Editore SpA ISBN 88-7781-771-2 Pubblicato con un contributo dai Fondi Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo di Firenze Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall’editore. to Jen B CONTENTS Introduction . pag. 7 Renaissance Women Poets and the Sonnet Tradition in England and Italy: Mary Wroth, Vittoria Colonna and Veronica Franco. » 11 The Poet and the Muse: Isabella Lickbarrow and Lakeland Romantic Poetry . » 35 “Stone Walls do not a Prison Make”: Two Poems by Alfred Tennyson and Emily Brontë . » 59 Elizabeth Barrett Browning: The Search for a Poetic Identity . » 77 “Love or Rhyme”: Wendy Cope and the Lightness of Thoughtfulness . » 99 Bibliography. » 121 Index. » 127 B INTRODUCTION 1. These five essays are the result of a series of coincidences rather than a carefully thought out plan of action, but, as is the case with many apparently haphazard choices, they reflect an ongoing interest which has lasted for the past ten years. -
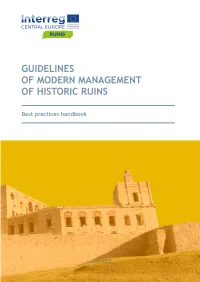
Guidelines of Modern Management of Historic Ruins : Best Practices
Institutions participating in the elaboration of the publication: Lublin University of Technology (Poland) Matej Bel University (Slovakia) The Institute of Theoretical and Applied Mechanics of The Czech Academy of Sciences (Czech Republic) Polish National Committee of The International Council on Monuments and Sites Icomos (Poland) City of Zadar (Croatia) Links Foundation – Leading Innovation and Knowledge for Society (Italy) Italian Association for The Council of Municipalities and Regions of Europe (Italy) Venetian Cluster (Italy) Municipality of Velenje (Slovenia) Zadar County Development Agency Zadra Nova (Croatia) Team of authors: Bugosław Szmygin (project coordinator) Maciej Trochonowicz Miloš Drdácký Alenka Rednjak Bartosz Szostak Jakub Novotný Marija Brložnik Andrzej Siwek Patrizia Borlizzi Rudi Vuzem Anna Fortuna-Marek Antonino Frenda Marko Vučina Beata Klimek Silvia Soldano Jernej Korelc Katarzyna Drobek Marco Valle Darja Plaznik Ivan Murin Raffaella Lioce Danijela Brišnik Dagmara Majerová Dario Bertocchi Breda Krajnc Jana Jaďuďová Camilla Ferri Urška Todorovska-Šmajdek Iveta Marková Daniele Sferra Milana Klemen Kamila Borseková Sergio Calò Lucija Čakš Orač Anna Vaňová Maurizio Malè Branka Gradišnik Dana Benčiková Eugenio Tamburrino Urška Gaberšek Ivan Souček Patricija Halilović Krasanka Majer Jurišić Martin Miňo Rok Poles Boris Mostarčić Jiří Bláha Marija Ževart Iva Papić Dita Machová Helena Knez Wei Zhang Drago Martinšek Publication within project “RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences”, supported by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme funded under the European Regional Development Fund. GUIDELINES OF MODERN MANAGEMENT OF HISTORIC RUINS BEST PRACTICES HANDBOOK Guidelines for modern management of historic ruins. -

Lago Di Garda • Lake Garda • Gardasee
GARD MORE LAGO DI GARDA • LAKE GARDA • GARDASEE SALÒ LAZISE EVENTS ITINERARIES OF GARDA ISSN 2499-7730 ANNO 4 • N. 7 | PRIMAVERA 2019 | € 3,50 CIERRE GRAFICA “L’UNIONE FA LA FORZA” nei tempi moderni. OUR SERVICES - promozione d el territorio in - d epliant web - loc and ine - menu - app native - c artelline - - le a 360° info@ga rda -ma rketing.com LAKEGARDA Lago di Garda - Lake Garda www.pilandro.com PILANDRO WINE SHOP Degustazioni - Wine tasting - Wein proben Orari di apertura / Opening Hours / Öffnungszeiten Lunedì-Sabato / Monday-Saturday / Montag-Samstag 8.30-12.30/14.00-18.00 Domenica / Sunday / Sonntag 8.30-12.30 Località Pilandro, 1 - Desenzano del Garda (BS) (Uscita/Exit/Ausfahrt: A4 Sirmione) GPS: N 45° 44’ 10” E 10° 61’ 17” T. +39 030 991 0363 www.pilandro.com - [email protected] - [email protected] GARD MORE ADVERTISERS THANKS TO ANNO 4 • N. 7 | PRIMAVERA 2019 YEAR 4 • No. 7 | SPRING 2019 JAHRGANG 4 • Nr. 7 | FRÜHLING 2019 II Web, Print and Ideas Garda Marketing Semestrale di Territorio, Turismo, Cultura Registro Stampa n. 2073, Tribunale di Verona Wine tasting Direttore Responsabile Claudia Farina - 347 42 82 583 1 [email protected] Pilandro Redazione Alvaro Ioppi - 349 23 26 094 Collaboratori Shopping Francesca Gardenato, Stefano Ioppi, Elisa Turcato 6-7 Elnòs Shopping Progetto grafco e impaginazione Marco Castagna Traduzioni logoService - Brescia Stampa Cierre Grafca Fashion & Design Via Ciro Ferrari 5, Caselle di Sommacampagna (VR) 28-29 tel. 045 8580900 - www.cierrenet.it Pelletteria Charlotte Distributore per Verona e Lago di Garda Ag. Sidetra s.r.l. -

CASTELLAN MEETINGS 2010 San Colombano Al Lambro – March 21St, 2010 Piacenza – June 2Nd, 2010 Rovato – September 26Th, 2010 Vigoleno of Vernasca – October 10Th, 2010
Tansini.it – Historical research and divulgation CASTELLAN MEETINGS 2010 San Colombano al Lambro – March 21st, 2010 Piacenza – June 2nd, 2010 Rovato – September 26th, 2010 Vigoleno of Vernasca – October 10th, 2010 What: researches about Middle and Modern Ages fortifications. Where: San Colombano al Lambro (Milan), Piacenza, Rovato (Brescia), Vigoleno of Vernasca (Piacenza). How: informal meetings (Italian language). When: from March to October 2010. Info: mobile (+39) 349 2203693, e-mail [email protected]. A topic not much tackled in divulgation works concerning the fortified architecture’s its influence upon historical developments which led to our days’ reality. In facts, the explanations given to the public often confine themselves to examine some structure details or to exalt – if not ‘reinventing’ – some chronicle episodes; vice versa, they can result technical and sectorial, suitable only for ‘experts’. What Davide Tansini proposes with Castellan meetings [Incontri castellani] it’s a particular approach to castled architecture: well-contextualized and documented discussions, in a strongly interactive relation with the people who take part in. Simpleness, consistency and clearness are the ingredients of this communicative formula, which amalgamates a scrupulous historic-scientific method to a reserved and cordial conversation. The subject chosen for 2010 are the connections among some types of fortifications: borgo, castle, rocca, town walls and citadel. Title of this meetings series is …not to trust’s better! […non fidarsi è meglio!], which sums up the problematical cohabitation among the different elements which every day referred to the fortifications: civilian and military, social and environmental, economical and cultural. Four the localities chosen to outline thanks their ancient fortalices Castellan meeting’s tread. -

Bieler Jahrbuch Annales Biennoises
Bieler Jahrbuch Annales biennoises 2013 2013 Bieler Jahrbuch Annales biennoises 2013 Bieler Jahrbuch / Annales biennoises Redaktion und Lektorat/Rédaction et lecture: Herausgeber: Arbeitsausschuss Bieler Jahrbuch / Reto Lindegger, Biel/Bienne Comité de publication: Erich Fehr, Hans-Ueli Aebi, Virginie Borel, Nicoletta Cimmino, Edna Epelbaum, Layout und Druck/Mise en pages et impression: David Gaffino, Marie-Pascale Hauser, Tobias Kaestli, W. Gassmann AG, Biel/Bienne Brigitte Kübli, Reto Lindegger, Clemens Moser, Marie-Thérèse Sautebin, Esther Thahabi. © 2014 Präsidialdirektion der Stadt Biel / 2014 Mairie de la Titelbild/Couverture: ville de Bienne Schlussfeier am Eidgenössischen Turnfest 2013. Foto: Enrique Muñoz Garcia ISSN 1423-7091 Table des matières | Annales biennoises 2013 | III 1. Teil: Allgemeine Beiträge 1re partie: Documentation d’intérêt général Princesse Mahi Ailleurs 2 (Mahité Orban) Sanja Josipovic Warten 7 Sanja Josipovic Wochenmarkt 8 Eva Leuenberger s’entreferir 9 Marie-Pierre Walliser Bielmatten, par 47.13600 Nord et 07.24995 Est 12 (-Klunge) Antonia Jordi «Mit Gott mit Ehren soll sich mein glükh mehren» Bieler Kompanien in Fremden Diensten (17. Jahrhundert) 18 Peter Fasnacht Mente et malleo: Mit Geist und Hammer! 32 Dr. Max Antenen Ein historischer Rückblick auf die geologische Erforschung des Seelandes und des Juras in der Umgebung von Biel 34 Nicoletta Cimmino Biel – weg vom schlechten Image des medialen Sorgenkindes 77 IV | Bieler Jahrbuch 2013 | Inhaltsverzeichnis 2. Teil: Beiträge zum Jahr 2013 2e partie: Documentation concernant l’année 2013 WIRTSCHAFT | ÉCONOMIE Sibylle Thomke Technik zum Anfassen statt Broschüren 80 Esther Thahabi Das WIBS Jahr 2013 83 KULTUR | CULTURE Alexandre Wenger SYS 2013 ou «L’aventure qui continue» 88 Werner Hadorn Neues Leben im alten Keller Wie es nach gut vier Jahrzehnten «Kulturtäter» im Kellertheater Théâtre de Poche weitergehen soll. -

Dante's Inferno</H1>
Dante's Inferno Dante's Inferno The Divine Comedy of Dante Alighieri Translated by Henry Wadsworth Longfellow Volume 1 This is all of Longfellow's Dante translation of Inferno minus the illustrations. It includes the arguments prefixed to the Cantos by the Rev. Henry Frances Carey, M,.A., in his well-known version, and also his chronological view of the age of Dante under the title of What was happening in the World while Dante Lived. If you find any correctable errors please notify me. My email addresses for now are [email protected] and [email protected]. David Reed Editorial Note page 1 / 554 A lady who knew Italy and the Italian people well, some thirty years ago, once remarked to the writer that Longfellow must have lived in every city in that county for almost all the educated Italians "talk as if they owned him." And they have certainly a right to a sense of possessing him, to be proud of him, and to be grateful to him, for the work which he did for the spread of the knowledge of Italian Literature in the article in the tenth volume on Dante as a Translator. * * * * * The three volumes of "The Divine Comedy" were printed for private purposes, as will be described later, in 1865-1866 and 1877, but they were not actually given to the public until the year last named. Naturally enough, ever since Longfellow's first visit to Europe (1826-1829), and no doubt from an eariler date still, he had been interested in Dante's great work, but though the period of the incubation of his translation was a long one, the actual time engaged in it, was as he himself informs us, exactly two years. -

Contribution À L'étude Des Cluses Du Jura Septentrional
Université de Neuchâtel Institut de géologie Contribution à l'étude des cluses du Jura septentrional Thèse présentée à (a Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel par Michel Monbaron Licencié es sciences Avril 1975 Imprimerie Genodruck, Bienne IMPRIMATUR POUR LA THESE Contribution al Jura septentrional deMQns.i.eur....Mii:hel...JïlDZLhar.Qn. UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL FACULTÉ DES SCIENCES La Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, sur le rapport des membres du jury, .Ml*...ae.s....px.QÍfis.s.eur.s....D*..Jiub.ert.+...P>...XMu.Y£.„„ _(BêSan£QrJ^_J_c£ autorise l'impression de la présente thèse sans exprimer d'opinion sur les propositions qui y sont contenues. Neuchâtel, le 9.~ms,xs....l9l6. Le doyen : P. Huguenin Thèse publiée avec l'appui de : l'Etat de Neuchâtel et l'Etat de Berne. Ce travail a obtenu Le Prix des Thèses 1976 de la Société Jurassienne d'Emulation. IV RESUME Une cluse jurassienne caractéristique, celle du Pichoux, est étudiée sous divers aspects. La localisation de la cluse dans l'anticlinal de Raimeux dépend en premier lieu d'un ensellement- d'axe au toit de l'imperméable oxfordien, ainsi que d'un relais axial dans le coeur de Dogger. Les systèmes de fissuration, principalement les deux sys tèmes cisaillants dextre et sénestre, ont fourni la trame sur laquel le s'est imprimée la cluse. Hydrogéologiquement, celle-ci fait office de niveau de base karstique pour de vastes territoires situés surtout à l'W ("bordure orientale des Franches-Montagnes). La principale sour ce karstique qui y jaillit est celle de Blanches Fontaines: surface du bassin 48,8 km^; débit moyen annuel 1,25 m3/sec; valeur moyenne de l'ablation karstique totale: 0,082 mm/an. -

Dante Alighieri's Divine Comedy – Inferno
DIVINE COMEDY -INFERNO DANTE ALIGHIERI HENRY WADSWORTH LONGFELLOW ENGLISH TRANSLATION AND NOTES PAUL GUSTAVE DORE´ ILLUSTRATIONS JOSEF NYGRIN PDF PREPARATION AND TYPESETTING ENGLISH TRANSLATION AND NOTES Henry Wadsworth Longfellow ILLUSTRATIONS Paul Gustave Dor´e Released under Creative Commons Attribution-Noncommercial Licence. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ You are free: to share – to copy, distribute, display, and perform the work; to remix – to make derivative works. Under the following conditions: attribution – you must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work); noncommercial – you may not use this work for commercial purposes. Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. English translation and notes by H. W. Longfellow obtained from http://dante.ilt.columbia.edu/new/comedy/. Scans of illustrations by P. G. Dor´e obtained from http://www.danshort.com/dc/, scanned by Dan Short, used with permission. MIKTEXLATEX typesetting by Josef Nygrin, in Jan & Feb 2008. http://www.paskvil.com/ Some rights reserved c 2008 Josef Nygrin Contents Canto 1 1 Canto 2 9 Canto 3 16 Canto 4 23 Canto 5 30 Canto 6 38 Canto 7 44 Canto 8 51 Canto 9 58 Canto 10 65 Canto 11 71 Canto 12 77 Canto 13 85 Canto 14 93 Canto 15 99 Canto 16 104 Canto 17 110 Canto 18 116 Canto 19 124 Canto 20 131 Canto 21 136 Canto 22 143 Canto 23 150 Canto 24 158 Canto 25 164 Canto 26 171 Canto 27 177 Canto 28 183 Canto 29 192 Canto 30 200 Canto 31 207 Canto 32 215 Canto 33 222 Canto 34 231 Dante Alighieri 239 Henry Wadsworth Longfellow 245 Paul Gustave Dor´e 251 Some rights reserved c 2008 Josef Nygrin http://www.paskvil.com/ Inferno Figure 1: Midway upon the journey of our life I found myself within a forest dark.. -

Liniennetz Biel Und Umgebung Plan Du Réseau Bienne Et Environs
Liniennetz Biel und Umgebung Plan du réseau Bienne et environs Magglingen La Chaux-de-Fonds Reuchenette-Péry Linien / Lignes 314 Gare End der Welt 315 79 Evilard Les Prés-d’Orvin école Le Grillon 70 315 73 321 Vorhölzli–Stadien Magglingen Leubringen 1 Bois-Devant–Stades 79 Evilard Plagne Plagne Zum Alten Schweizer Evilard Orvin Mösliacker–Orpundplatz Alte Chapelle Spitalzentrum Place du Cerf Bas du Village 2 La Lisière Beaumont Bellevue Frinvillier Frinvillier Gare Vauffelin Petit-Marais–Place d’Orpond Sporthalle Centre hospitalier Orvin Cheval BlancOrvinMoulin Petit- Epicerie Orvin place du village Village Rte de Plagne Nidau–Löhre Place du village église Frinvillier Vauffelin posteLes OeuchesVauffelin RomontRte BEde Vauffelin 4 Kapellenweg 5 Les Prés-d’OrvinCh. des CernilsSous les Roches bif. sur Vauffelin Champs-Verlets 71 Romont BE Nidau–Mauchamp Helvetiaplatz 6 Frinvillier 5 Biel Bahnhof–Spitalzentrum Seilbahn Place Helvetia bif. sur Bienne Bienne Gare–Centre hospitalier 301 Vauffelin Vauffelin Port/Nidau–Spitalzentrum PavillonwegTschärisplatzPlace deGrausteinweg la CharrièreChemin Pierre-GriseSydebuswegChemin des Chatons Eichhölzli KlooswegChemin du ClosHöhewegLa Haute-Route 6 Magglingen Suze Port/Nidau–Centre hospitalier Chemin du Pavillon Petit-Chêne / Macolin s Brügg–Goldgrube Alpenstrasse Spiegel Mahlenwald bif. sur Plagne 7 Brügg–Mine d’Or Forêt de Malvaux Rue des Alpes Miroir Schüs Dynamic Test Center Hohfluh Biel Reuchenettestr. 8 Klinik Linde–Fuchsenried Franz. Kirche Leubringenbahn Katholische KircheSonnhalde Pilatusstrasse Ried Bienne Rte de Reuchenette Fuchsenried Clinique des Tilleuls–Fuchsenried 301 Eglise catholique Eglise française Funi Evilard Rue du Pilate Schiffländte–Schulen Linde Rebenweg 8 9 Débarcadère–Ecoles Tilleul Ch. des Vignes Biel Bahnhof–Rebenweg 11 Juraplatz 11 Place du Jura Lienhardstrasse SchlössliSchulhaus Bienne Gare–Ch. -

Erfrischende Aktivitäten Activités Autour De L'eau
JURA BERNOIS BIEL/BIENNE SEELAND WANDERUNGEN AB AUF‘S VELO WASSERAKTIVITÄTEN BADESPASS RANDONNÉES À VÉLO ACTIVITÉS AQUATIQUES BAIGNADE ERFRISCHENDE AKTIVITÄTEN HIKES ON YOUR BIKE! WATER ACTIVITIES BATHING ACTIVITÉS AUTOUR DE L‘EAU REFRESHING ACTIVITIES Die schönsten Wanderungen entlang des Wassers. Die Region Biel Erfrischende Fahrradtouren am Wasser. Die Velotouren rund um den Abenteuerliche Entdeckungstouren auf dem Wasser. Über das Wasser Strände und Badeplätze in der Region. Geniessen Sie während der Seeland und der Berner Jura bieten eine Vielfalt von Wanderungen an Bielersee oder entlang der Aare sind ein schönes Tagesprogramm für zu gleiten ist eine bezaubernde Aktivität und bietet die Möglichkeit, die heissen Sommertage erfrischende Stunden am Wasser. Für Erholung den Ufern der Gewässer. Umgeben von Weinreben bewundern Sie das die ganze Familie. Die relativ flachen Routen bieten unterwegs viele Natur aus einer anderen Perspektive zu entdecken. Die Wassersportzen- sorgen die kleinen, einsamen Kiesel- und Sandstrände am Bielersee, für glitzernde Blau des Bielersees in Kontrast mit den grünen Hügeln des Gelegenheiten für einen Sprung ins kühle Nass oder ein kräftetankendes tren des Bielersees vermieten Pedalos, Stand Up Paddle Boards sowie Trubel und Spass ist in den Badis mit Wasserrutschen, Sprungtürmen, Unsere Tipps | Nos Seelandes und den weissen Alpen in der Ferne. An besonders heissen Picknick. Entdecken Sie wunderschöne, sehenswerte Ortschaften, wie Kanus und Kajaks für abenteuerliche Ausflüge. Auch begleitete Touren Restaurants und Spielplätzen gesorgt. Ein Badeerlebnis für Gross und conseils | Our Tipps: Tagen locken die zahlreichen Schluchten mit tausend und einem Wasser- Büren an der Aare, Aarberg oder die Winzerdörfer am Nordufer des sind auf Anfrage möglich. Egal ob sportlich oder gemütlich, jeder kann Klein! j3l.ch/aqua fall und sorgen mit ihrer Frische für Erholung in unberührter Natur.