Dissertation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Info Bulletin
Info Bulletin 42. Mitgliederversammlung VSAM, 25. April 2020, Thun 3 Jahresbericht 2019 des Präsidenten VSAM 4 Bilanz – Erfolgsrechnung – Budget 12 Nachruf Markus Hubacher «Hubi» 15 Mörser und Werfer der Schweizer Artillerie 16 Geschichte der Schweizer Armee vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart 18 Unbekanntes Objekt im Info-Bulletin 2/19 identifiziert 20 Legate – Soldatenmarken: Mitarbeiter/-in gesucht – Freiwillige gesucht 22 Ergänzung zum Artikel über Diastimeter im Info-Bulletin 3/19 24 Jahresprogramm des Museums im Zeughaus Schaffhausen für das Jahr 2020 26 Die Gradabzeichen der Unteroffiziere und Gefreiten 27 1|20 www.armeemuseum.ch Mitgliederversammlung VSAM Einladung zur 42. ordentlichen 25. April 2020, ab 9.00 Uhr, Thun, Alte Reithalle (Expo Thun) Mitgliederversammlung Sehr geehrte Damen und Herren Traktandenliste Ich freue mich, Sie zur 42. ordentlichen Mitglieder- 1. Begrüssung versammlung des VSAM vom Samstag, 25. April 2. Wahl der Stimmenzähler 2020, in die Alte Reithalle (Expo Thun) in Thun ein- 3. Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 zuladen. Es ist folgender Ablauf vorgesehen: (Info-Bulletin VSAM 2/19) ab 9.00 Uhr Eintreffen, Kaffee und Gipfeli 4. Jahresbericht VSAM 2019 (Bulletin VSAM 1/20) 10.00 Uhr Beginn der Mitgliederversammlung a) Ergänzungen des Präsidenten Anschl. Referat von Prof. Rudolf Jaun b) Diskussion/Genehmigung zu seiner neusten Publikation 5. Stiftung Historisches Material der Schwei- «Geschichte der Schweizer Armee» zer Armee. Orientierung durch den Präsi- 12.00 Uhr Aperitif denten des Stiftungsrates, 12.45 Uhr Mittagessen Div. Ad Urs Gerber 15.00 Uhr Abschluss der Veranstaltung 6. Finanzen a) Jahresrechnung 2019 Abfahrt der Busse am Bahnhof Thun: – Parkplätze stehen im Areal Expo Thun zur b) Revisionsbericht 2019 8.45, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50 10.00 Uhr (Bus nach Lerchenfeld) Verfügung. -
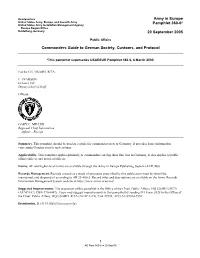
Commander's Guide to German Society, Customs, and Protocol
Headquarters Army in Europe United States Army, Europe, and Seventh Army Pamphlet 360-6* United States Army Installation Management Agency Europe Region Office Heidelberg, Germany 20 September 2005 Public Affairs Commanders Guide to German Society, Customs, and Protocol *This pamphlet supersedes USAREUR Pamphlet 360-6, 8 March 2000. For the CG, USAREUR/7A: E. PEARSON Colonel, GS Deputy Chief of Staff Official: GARY C. MILLER Regional Chief Information Officer - Europe Summary. This pamphlet should be used as a guide for commanders new to Germany. It provides basic information concerning German society and customs. Applicability. This pamphlet applies primarily to commanders serving their first tour in Germany. It also applies to public affairs officers and protocol officers. Forms. AE and higher-level forms are available through the Army in Europe Publishing System (AEPUBS). Records Management. Records created as a result of processes prescribed by this publication must be identified, maintained, and disposed of according to AR 25-400-2. Record titles and descriptions are available on the Army Records Information Management System website at https://www.arims.army.mil. Suggested Improvements. The proponent of this pamphlet is the Office of the Chief, Public Affairs, HQ USAREUR/7A (AEAPA-CI, DSN 370-6447). Users may suggest improvements to this pamphlet by sending DA Form 2028 to the Office of the Chief, Public Affairs, HQ USAREUR/7A (AEAPA-CI), Unit 29351, APO AE 09014-9351. Distribution. B (AEPUBS) (Germany only). 1 AE Pam 360-6 ● 20 Sep 05 CONTENTS Section I INTRODUCTION 1. Purpose 2. References 3. Explanation of Abbreviations 4. General Section II GETTING STARTED 5. -
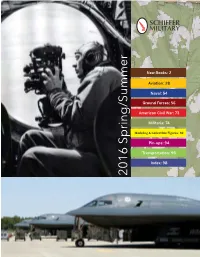
2016 Spring/Summer
SCHIFFER MILITARY New Books: 2 Aviation: 28 Naval: 54 Ground Forces: 56 American Civil War: 73 Militaria: 74 Modeling & Collectible Figures: 92 Pin-ups: 94 Transportation: 96 Index: 98 2016 Spring/Summer 2 2016 NEW BOOKS the 23rd waffen ss volunteer panzer grenadier division contents nederland 2016 new books 10 Enter the uavs: the 27th waffen ss the faa and volunteer drones in america grenadier division 7 langemarck 10 harriet quimby: training the right soldiers flying fair lady stuff: the at the doorstep: aircraft that civil war lore 4 produced america's jet 11 pilots 7 project mercury: suppliers to the matterhorn—the america in space confederacy, v. ii operational history series of the us xx bomber 11 command from india 8 and china, 1944–1945 5 project gemini: last ride of the a pictorial history america in space valkyries: the rise of the b-2a series and fall of the spirit stealth wehrmachthelfer- bomber 8 innenkorps during 5 wwii 12 the history of the german u-boat waffen-ss dyess air force base at lorient, camouflage base, 1941 to the france, august 1942– uniforms, vol. 1 present august 1943, vol. 3 13 6 9 german u-boat ace waffen-ss jet city rewind: peter cremer: camouflage the patrols of aviation history uniforms, vol. 2 u-333 in of seattle and the world war ii pacific northwest 13 6 9 2016 NEW BOOKS 3 german military travel papers of the second world war 14 united states american the model 1891 navy helicopter heroes quilts, carcano rifle patches past and present 24 15 19 united states mitchell’s new a collector’s marine corps general atlas guide to the emblems: 1804 to 1860 savage 99 rifle world war i 20 15 25 privateers american ferrer-dalmau: of the revolution: breechloading art, history, and war on the new mobile artillery miniatures jersey coast, 1875–1953 1775–1783 21 26 16 fighting for making leather bombshell: uncle sam: knife sheaths, the pin-up art of buffalo soldiers vol. -

Men at Arms Books
Osprey Men-at-Arms PUBLISHING German Army Elite Units 1939-45 Gordon Williamson * Illustrated by Ramiro Bujeiro CONTENTS INTRODUCTION ‘GROSSDEUTSCHLAND’ ‘FELDHERRNHALLE* GORDON WILLIAMSON was INFANTERIE-REGIMENTER 119 & 9 ‘LIST’ born in 1951 and currently works for the Scottish Land Register. He spent seven years with the Military Police PANZERGRENADIER-DIVISION TA end has published a ‘BRANDENBURG* number of books and articles on the decorations of the Third Reich and their winners. KAVALLERI E-REGIMENT 5 He is author of a number of World War II titles for Osprey. ‘FELDMARSCHALL VON MACKENSEN’ 44. REICHSGRENADIER-DIVISION ‘HOCH UND DEUTSCHMEISTER’ 116. PANZER-DIVISION {‘Windhund’) 21. PANZER-DIVISION 24. PANZER-DIVISION (130.) PANZER-LEHR-DIVISION RAMIRO BUJEIRO has illustrated many Osprey titles including Warrior 23; US 3. GEBIRGS-DIVISION Afanne in Vietnam and Men- at-Arms 357: Allied Women's 5. GEBIRGS-DIVISION Service. He is an experienced commercial artist who lives and works in his native city THE TIGER TANK BATTALIONS of Buenos Aires, Argentina. His main interests are the political and military history THE PLATES of Europe in the first half of the 20th century. INDEX first published In Great Britain In 2002 by Osprey Publishing. Artist’s Note Qms Court. Chapel Way. BotJay, Oxford 0X2 9LB United Kingdom GERMAN ARMY ELITE UNITS Email] info® osprey publishing, com Readers may care to note that the original paintings from which the colour plates in this book were prepared are available for private © 2002 Osprey Publishing Ltd. sale. All reproduction copyright whatsoever is retained by the 1939-45 Publishers, All enquiries should be addressed to: All rights reserved- Apart From any fair dealing for the purpose of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright, Designs end Ramiro Sujeiro, GC 28, 1602 Florida, Argentina Patents Act, 1983. -

Generalarzt Der Luftwaffe Flugmedizinisches Institut Der Luftwaffe
Herausgeber: OTA Dr. Pongratz GENERALARZT DER LUFTWAFFE FLUGMEDIZINISCHES INSTITUT DER LUFTWAFFE ISBN 3-00-016306-9 Vorwort Generalarzt Dr. med. Erich Rödig Generalarzt der Luftwaffe Mit dem nunmehr vorliegenden „Kompendium der Flugmedizin“ stellt sich eine deutsche Publikation unseres Fach- gebietes vor, welches – wie kein anderes – durch interdisziplinäre An- und Herausforderungen und entsprechendes Denken und Handeln geprägt ist. Die Flugmedizin verbindet zahlreiche präventive, diagnostische und therapeutische Teilgebiete zu ei- nem Gebiet, der Luft- und Raumfahrtmedizin, die ihren Anspruch aus den psychophysischen Einwir- kungen auf den menschlichen Körper im dreidimen- sionalen Raum ableitet. Begriffe, wie flugmedizini- sche Begutachtung, Flugphysiologie, Flugunfallmedi- zin, Lufttransport Verwundeter und Kranker, Human Factors, werden der heutigen Bedeutung der Luft- und Raumfahrtmedizin jedoch längst nicht mehr ge- recht. Alle klinischen Fächer, einschließlich der Phy- siologie, haben ihren Anteil am Verständnis des komplexen Fachgebietes Luft- und Raumfahrtmedi- zin. Zeitkritisches Erkennen, Entscheiden und folge- richtiges Handeln prägen das Bild des Flugmedizi- ners. Als „Generalist“ mit speziellen Fähigkeiten deckt er die flugmedizinischen Kernforderungen aller Fachgebiete gleichmäßig ab. Darüber hinaus wachsen an ihn die unterschiedlichsten Anfor- derungen, die die Luft- und Raumfahrt an einen Flugmediziner stellt. Hierzu gehört auch not- fallmedizinsche Kompetenz. In diesem Sinne haben sich die Autoren bemüht, eine Publikation -

AUTOGRAPHEN 1 BARKS, CARL, (1901-2000), US-Comic-Autor U
AUTOGRAPHEN 1 BARKS, CARL, (1901-2000), US-Comic-Autor u. Zeichner, bekanntester Disney-Zeichner, (u. a. 90 € Donald u. Dagobert Duck), Tinten OU auf s/w Foto, 24x18 cm, um 1990; Beilagen <964683F I- 2 DENTON, A. COOLEY (*1920), US-Herzchirug, 1968 erste erfolgreiche Herztransplantation, OU 20 € auf farb. Foto-AK, m. Versand-Kuvert, Houston 2012 <942071F I- 3 DISNEY, ROY, US-Zeichentrickfilmer, (1930-2009), Sohn v. Walt Disney u. Mitbegründer d. Walt 70 € Disney-Company, Tinten OU auf Farbfoto, 13x12 cm; dazu Buch „Die Disney-Story“, Ron Groover, Bln. 1992, Farbfotos, 416 S., Pappband/SU <964682F I- 4 DISNEY, WALT, US-Amerikanischer Zeichentrick-Filmer, (1901-1966), OU in weißer 300 € Pinselfarbe, auf schwarzem Karton m. Druckportrait, A 4, um 1960; dazu 2 Bücher, „Disneys Welt“, R. Schickel; „Die Welt des Walt Disney“, A. Platthaus, Bln. 2001, Fotos, Abb., ges. 558 S., Pappbde., SU <964681F I- 5 DISNEY, WALT, US-Amerikanischer Zeichentrickfilmer, (1901-1966), Tinten-OU auf 600 € Portraitfoto, Stempel „Foto Felicitas München“, um 1960, 20x15 cm; dazu 4 Führer d. Disneyland, 1957, 1958, u. 1963, sowie Heft „Vacationland-Disneyland“ 1958, m. Zertificat, alle m. zahlr. Farb- fotos <964680F I- 6 FRITSCH, THEODOR, (1852-1933), antijüdischer Verleger in Leipzig, (Hammer-Verlag), hand- 70 € schriftliche Widmung an Heinrich N. Clausen, Lpz., Weihnachten 1926, im Vorsatz d. 1. Bd. „Erinnerung einer Respektlosen“ v. Edith Gräfin Saalburg, Hammer-V. 1927, (Bd. 2 v. 1931 auch vorhanden), 1 Portr., 224 u. 272 S., gld.gepr. Ln. <944815F I- 7 FUCHS, DR. ERIKA, (1906-2005), Dt. Comic-Übersetzerin, (Micky Maus Hefte v. 1951-1988), 4 60 € Farbfotos m. -

Militärische Grundbegriffe
Militärische Grundbegriffe Objekttyp: Group Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung Band (Jahr): 40 (1964-1965) Heft 9 PDF erstellt am: 28.09.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch dert sich in die laufenden Ausgaben rakter, der von einer Periode zur andern Militärische Grundbegriffe (ordentliche Ausgaben) und die Rüstungs- wechseln kann. Die Rüstungsmaßnahmen ausgaben (außerordentliche Ausgaben). werden in eigenen Programmen — meist Bei diesen beiden Kategorien handelt es eigentlichen «Rüstungsprogrammen» — Das Militärbudget sich um folgendes: zusammengefaßt, die von den eidgenös- Der Begriff «laufenden Ausgaben» um- sischen Räten grundsätzlich genehmigt Das Budget der Eidgenossenschaft schließt die jährlich wiederkehrenden, werden. -

Preisliste Bundeswehr
Preisliste Bundeswehr Alles für einen guten Soldaten! Automatenstickerei Adler GmbH |Römersbühlerstr. 35 | 92655 Grafenwöhr Tel: 09641/2140 | Fax: 09641/1022 | E-Mail : [email protected] | Internet: www.stickadler.de Artikelnummerzusammenstellung: Stofffarbe: Garnfarbe: Legende: Die ersten Ziffern vor dem Punkt xxx.01.xx = schwarz xxx.xx.01 = schwarz 100.xxx.xx = Artikelnummer xxx.02.xx = oliv xxx.xx.02 = bronze Die Ziffern nach dem ersten Punkt xxx.03.xx = tarnfleck xxx.xx.03 = silber xxx.02.xx = Stofffarbe xxx.04.xx = wüstentarn xxx.xx.04 = gold Die Ziffern nach dem zweiten Punkt xxx.05.xx = khaki xxx.xx.05 = braun xxx.xx.01 = Garnfarbe xxx.06.xx = dunkelblau xxx.xx.06 = blau xxx.07.xx = weiß Beispiel: xxx.08.xx = dunkelblau xxx.xx.xx K = mit aufgn. Klett 001.02.01 = Tätigkeitsabz. Techn. Pers., oliver Stoff, schwarzes Garn (Stickerei) xxx.09.xx = Tuch grau Bitte bei der Bestellung Stoff- und Garnfarbe angeben. Seite 2 Inhalt Seite 3 Namensstreifen/Plastiknamen Seite 4 Tätigkeitsabzeichen/Springerabzeichen Seite 5 Leistungsabzeichen/ Amerikanische Schießabzeichen Seite 6 Dienstgradabzeichen Luftwaffe/Heer Seite 7 Dienstgradabzeichen Marine Seite 8 Einsatzabzeichen und Sonstige Abzeichen Gerne fertigen wir auch Sonderwünsche, sofern diese realisierbar sind Kontaktieren Sie uns doch einfach einmal. Die Versandkosten betragen zwischen 4,00Euro im Innland. Bei gößeren Bestellungen oder höheren Warenwert versenden wir versichert per DPD für 7,90 Euro Ab einen Bestellwert von 12,00 € entfällt der Kleinmengenzuschlag von 2,50€ Ab einen Bestellwert von 250,00 € gewähren wir 5% Rabatt Automatenstickerei Adler GmbH |Römersbühlerstr. 35 | 92655 Grafenwöhr Tel: 09641/2140 | Fax: 09641/1022 | E-Mail : [email protected] | Internet: www.stickadler.de Namensstreifen ( 6er Pack) Artikel Nr. -

Symposium: Ambulantes Gesundheitssystem Bundeswehr
ANMELDUNG VERANSTALTUNG & ORGANISATION Aktuelle Informationen und Anmeldung online unter: Ü Veranstaltungsort www.dgwmp.de oder per Fax: 0228 698533 Ringberg Hotel SYMPOSIUM: AMBULANTES Senden Sie bitte das ausgefüllte Anmeldeformular per Fax: 0228 698533 bis spätestens 20. Februar 2020 zurück oder melden Sie sich online unter Ringberg 10 www.dgwmp.de an. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine An- 98527 Suhl GESUNDHEITSSYSTEM meldebestätigung. Tel: 03681 389-814 Fax: 03681 389-890 BUNDESWEHR Verbindliche Angaben: Ich nehme teil: E-Mail: [email protected] www.ringberghotel.de Medizinische Berufsorientierte Rehabilitation c Symposium: „Ambulantes Gesundheitssystem Bundeswehr“ Ü Zimmerreservierung Die Buchung der Hotelzimmer vom 25. - 27.03.2020 muss aus organisatorischen Fortbildungsveranstaltung c Workshop Migräne, Do., 26.03.2020 Gründen zwingend unabhängig von der Anmeldung zur Fortbildungsveranstal- DGWMP Suhl 2020 c Abendveranstaltung, Do., 26.03.2020 tung erfolgen! Für die Übernachtung können Sie Zimmer bis zum 12.02.2020 aus unserem c Ich bin DGWMP-Mitglied Kontingent im Ringberg Hotel, c Ich bin an einer Mitgliedschaft interessiert Ringberg 10, c Ich nehme teil als Teilnehmer 98527 Suhl, Tel: 03681 389-0, Fax: 03681 389-890, c Ich nehme teil als Referent E-Mail: [email protected], www.ringberghotel.de, 25. - 27. März 2020 unter dem Stichwort „Ambulantes Gesundheitssymposium Bundeswehr“ buchen. c Ich nehme teil als Standbetreuer Der Übernachtungspreis beträgt für ein Einzelzimmer pro Nacht inkl. Frühstücks- Ringberg Hotel, Suhl buffet 69,- €, für ein Doppelzimmer pro Person und Nacht inkl. Frühstücksbuffet 59,- €. Titel, Name, Vorname Ü Veranstalter Deutsche Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie e. V. (DGWMP) Dienstgrad Arbeitskreis Zahnmedizin, Neckarstraße 2a, 53175 Bonn Tel.: 0228 632420 - Fax: 0228 698533 E-Mail: [email protected] - www.dgwmp.de Dienststelle/Institution Ü Allgemeine Hinweise Kaffeepausen: Gesamte Tagung Getränkepauschale p. -

Die Entwicklung Der Österreichischen Streitkräfte Der 2. Republik Bis Zur Heeresreform Der Regierung Kreisky Von General I.R
Die Entwicklung der österreichischen Streitkräfte der 2. Republik bis zur Heeresreform der Regierung Kreisky Von General i.R. Albert Bach An der Entwicklung der Streitkräfte der 2. Republik habe ich als aktiver Offizier in verschiedenen Verwendungen teilgenommen und mitgewirkt. Dies bereitete mir oft Freude. Ich litt aber auch oft unter der tatsächlichen Entwicklung unserer Streitkräfte, da sie immer wieder ganz anders verlief, als wir Soldaten sie erhofft hatten. Bei meiner Schilderung der Entwicklung der österreichischen Streitkräfte werde ich nicht nur berichten, welche Ziele bei der Entwicklung erreicht werden konnten, sondern auch von den großen Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden waren, welche wichtigen Entwicklungsziele nicht erreicht werden konnten und welche Gründe dafür bestimmend waren. Die Schilderung ist zum Teil auch meine persönliche Einsicht in die Ereignisse. Ich beende sie mit meinem Übertritt in den Ruhestand Ende 1972. Einleitung Die 2. Republik ist 1995 50 Jahre alt geworden. Das österreichische Bundesheer ist zehn Jahre jünger, da mit seiner Aufstellung erst nach Wirksamwerden des Staatsvertrages im Herbst 1955 begonnen werden konnte. Das österreichische Volk hat beim Aufbau der 2. Republik aus den Trümmern, die der 2. Weltkrieg zurückgelassen hatte, große, zum Teil großartige Leistungen erbracht, vor allem auf dem Gebiet der Wirtschaft, bei der Errichtung des Rechts- und Sozialstaates sowie auf dem Gebiet des Bildungswesens und der Kultur. Im Bereich der Umfassenden Landesverteidigung (ULV) und insbesondere auch beim Aufbau seiner Streitkräfte blieben jedoch die Anstrengungen des österreichischen Staates weit hinter denen strategisch vergleichbarer Staaten, insbesondere hinter denen der Schweiz, zurück. Die hauptsächlichen Ursachen für die relativ geringen Anstrengungen Österreichs für seine Landesverteidigung liegen im wesentlichen auf geistigem und nur zum geringen Teil auf materiellem Gebiet. -
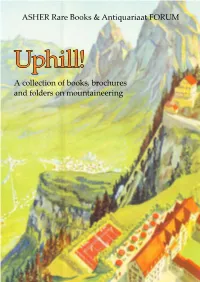
A Collection of Books, Brochures and Folders on Mountaineering ASHER
ASHER Rare Books & Antiquariaat FORUM Uphill! A collection of books, brochures and folders on mountaineering - 1 - UPHILL! A collection of books, brochures and folders on mountaineering [MOUNTAINEERING]. [A collection of brochures and folders on mountaineering]. [Austria and Switzerland, ca. 1920- ca. 1980]. Ca. 653 brochures (including a few duplicates and variant issues). With: [A collection of books relating to mountaineering]. [Various places, ca. 1830- ca. 2000]. Ca. 875 books (including a few duplicates and variant issues, and several multiple-volume titles). Price on request An extensive and wide-ranging collection of brochures, folders and books on climbing, hiking and other subjects related to mountaineering, mainly concerning the Central European mountainous areas. The brochures and folders concentrate on the decisive factor in that far-reaching process: the emergence of tourism. This part of the collection, comprising 653 rare and beautifully designed travel brochures and folders, gives a color- ful and fascinating overview of summer tourism in the central European mountainous areas (mainly the Austrian and Swiss Alps) as it developed beginning in the 1920s: from an exclusive hiking and climbing area for the Europe- an elite during the first half of the 20th century to the very popular and well facilitated commercial centers that we know today. Many of these were designed by well-known poster and other graphic artists such as Herbert Matter (especially interesting for the photomontage techniques used), Hubert Mumelter, Martin Peikert, Franz Stümvoll, Hans Thoni, and contain numerous photographs by leading photographers as well as various panorama's and maps by Josef Rueb, Heinrich Caesar Berann, Max Bieder, Füssli, Wolfgang Hausamann and A. -

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG Füus Forum
BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG FüUS forum BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG FüUSforum 2/2014 BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG FMTS-international/national FMTS-international/national FüUS international / national Bericht von der Evaluierungsübung der 7. Jägerbrigade anschlag auf einen Transport-Konvoi oder Bergung einer im Minenfeld ver- letzten Person mittels Hubschrauber. Übung „Pacemaker 07“ Vizeleutnant Neufeld und ich (An- gehörige der Fernmeldetruppenschule), waren während des gesamten Übungs- verlaufes in der IPST (Informations- und Unter der Beteiligung verschiedener Nationen (Deutschland, Belgien, Serbien, Pressestelle) der 7. JgBrig in Peygarten Slowenien, Frankreich und Österreich) wurde im Zeitraum von 19. November bis eingeteilt. Nach einigen kleineren An- 7. Dezember 2007 eine der größten Übungen der letzten Jahre durchgeführt. laufschwierigkeiten konnte der Vollbe- trieb aufgenommen werden. Die Aufga- be der IPST bestand darin, die breite Öf- Mit der Phase II, begann der fentlichkeit durch Presseaussendungen, Durchmarsch durch WEEKLAND Betreuung der Bundesheer-Homepage (Niederösterreich) in Richtung DMZ mit Berichten und Bildern zu informie- Allentsteig. Diese Marschbewegun- ren bzw. die anwesenden Journalisten gen wurden bereits durch Sympathi- entsprechend zu betreuen. Eine weitere santen von A-Land und B-Land ge- Aufgabe war das VOB (Visitor Observer Die Menge versuchte lautstark die Friedenstruppe zu behindern.