Bistum Limburg Kirchenmusik
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
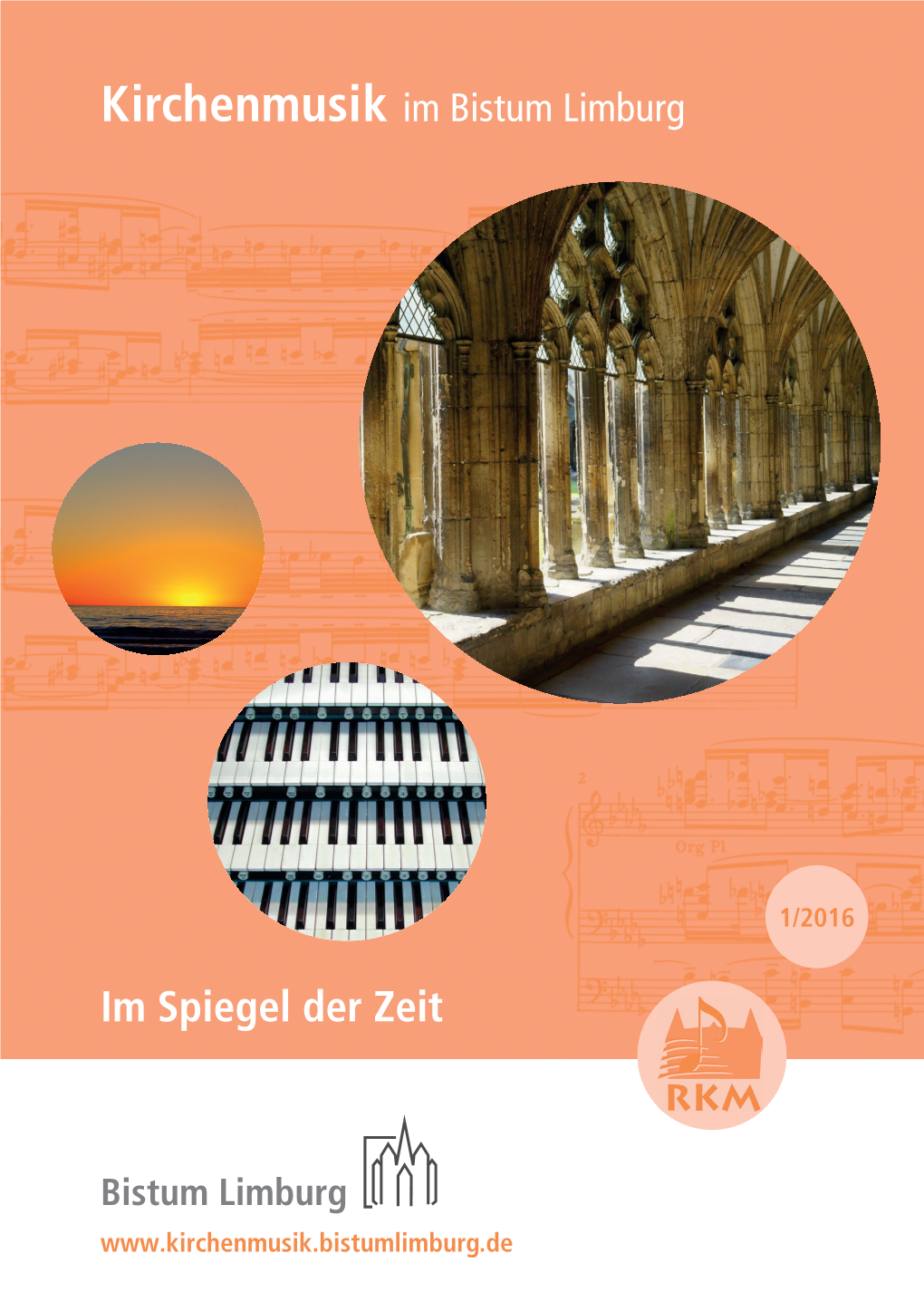
Load more
Recommended publications
-
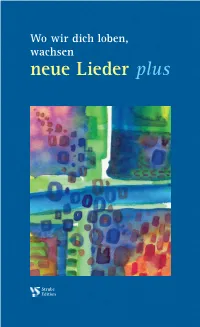
Neue Lieder Plus
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus Strube Edition ALPHABETISCHES VERZEICHNIS Accorde-nous la paix .............. 202 Christe, der du trägst Adieu larmes, peines .............. 207 die Sünd der Welt .................. 110 Aimer, c’est vivre .................... 176 Christ, ô toi qui portes Allein aus Glauben ................. 101 nos faiblesses ........................ 110 Allein deine Gnade genügt ....102 Christ, ô toi visage de Dieu .... 111 Alléluia, Venez chantons ........ 174 Christus, Antlitz Gottes ........... 111 Alles, was atmet .................... 197 Christus, dein Licht .................. 11 Amazing love ......................... 103 Christus, Gottes Lamm ............ 12 Amen (K) ............................... 104 Christus, höre uns .................... 13 An den Strömen von Babylon (K) ... 1 Christ, whose bruises An dunklen, kalten Tagen ....... 107 heal our wounds ................... 111 Anker in der Zeit ...................... 36 Con alegria, Atme in uns, Heiliger Geist ..... 105 chantons sans barrières ......... 112 Aube nouvelle dans notre nuit .. 82 Con alegria lasst uns singen ... 112 Auf, Seele, Gott zu loben ........ 106 Courir contre le vent ................. 40 Aus den Dörfern und aus Städten .. 2 Croix que je regarde ............... 170 Aus der Armut eines Stalles ........ 3 Danke für die Sonne .............. 113 Aus der Tiefe rufe ich zu dir ........ 4 Danke, Vater, für das Leben .... 114 Avec le Christ ........................... 70 Dans la nuit Bashana haba’a ..................... 183 la parole de Dieu (C) .............. 147 Behüte, Herr, Dans nos obscurités ................. 59 die ich dir anbefehle .............. 109 Das Leben braucht Erkenntnis .. 14 Bei Gott bin ich geborgen .......... 5 Dass die Sonne jeden Tag ......... 15 Beten .................................... 60 Das Wasser der Erde .............. 115 Bis ans Ende der Welt ................ 6 Da wohnt ein Sehnen Bist du mein Gott ....................... 7 tief in uns .............................. 116 Bist zu uns wie ein Vater ........... -

„Unterwegs“ 4/2011 (Drei Philosophen Auf Der Suche)
B 1964F ISSN 0930-1313 Nr. 4/2011 Die Mitgliederzeitung des Deutschen Katecheten-Vereins e.V. des steinernen Podestes entspannt niederge- Um den Fels mit seiner Lichtgrotte würdigen Thema lassen. Die Werkzeuge eines Geometers hält er zu können, muss man wissen, dass das Bild untätig in den Händen und blickt nach oben. am linken Rand „stark beschnitten“ ist, der Seine ganze Aufmerksamkeit gilt einer Erschei- zerklüftete Fels ursprünglich also dominanter Drei Philosophen nung im dunklen Felsen über ihm. Dort öffnet gewirkt hat. Damit gewinnt der Betrachtungs- sich eine lichterfüllte Grotte. Ein Licht, das gegenstand des Jüngsten an Bedeutung. auf der Suche nicht von der Sonne erzeugt sein kann, denn die versinkt gerade im Westen am blauen Ho- Ausdeuten rizont hinter den Philosophen. Das geheim- Drei Geistesgrößen unterwegs. Wer sind sie? Könnte es sich bei den drei „Weisen“ um nisvolle Licht in der östlichen Felsgrotte muss die „Heiligen Drei Könige“ des Evangeliums Was suchen sie am Waldrand? In der ersten „ganz anderer“ Art sein... Erwähnung des Giorgione-Gemäldes (1525) (Mt 2,1-12) handeln? Das ist nicht zwingend, wird es „Die drei Philosophen“ benannt, und Hingebungsvoll schaut der junge Mann auf zu aber jedenfalls ist Giorgiones Bild offen auch bei diesem Bildtitel ist es geblieben. Sind dem Phänomen, das sich ihm darbietet. Urbild für diese Deutung. Sie hat bis heute immer historische Vertreter kosmischer Gelehrsam- eines Schülers, dem mitten im Beobachtungs- wieder prominente, seriös argumentierende und Lerngeschäft eine neue Erkenntnis auf- Befürworter gefunden. Als das Gemälde 1932 keit gemeint? Sind die Gestalten allegorisch geht, „in a silent moment of spiritual awake- geröntgt wurde, zeigte sich, dass die erste Ver- zu deuten? „Inhaltliche Deutung umstritten“, ning“, wie man gemeint hat. -

Kirchen Musikalische Mi Eilungen
KIRCHEN MUSIKALISC HE MI EILUN GEN Nr. 143 AP RI L 2 01 8 Stuttgart Leutkirch Ellwangen DIÖZE SE RO ENBURG- STU GART ISSN 143 6- 0276 Inhaltsverzeichnis Liturgie aktuell 2 Gerhard Schneider , Leiter der neu geformten Hauptabteilung Liturgie St. Meinrad-Weg 6 · 72108 Rottenburg (mit Kunst und Kirchenmusik) und Berufungspastoral Telefon (07472) 169 953 Predigt im Pontifikalrequiem für Domkapitular em. Prälat Dr. Werner Groß † 31. Mai 2017 Telefax (07472) 169 955 • Bischof Dr. Gebhard Fürst www.amt-fuer-kirchenmusik.de Bürozeiten Jutta Steck 4 Verordnetes Schweigen oder erfüllte Stille? Vom Klang der Fastenzeit • Tobias Wittmann Mo-Fr: 8.00 – 12.00 Uhr 5 Zur Klanggestalt des Hochgebetes • Walter Hirt Mo: 14.00 – 16.00 Uhr Schwerpunktthema Leiter des Amtes für Kirchenmusik Diözesanmusikdirektor Walter Hirt 13 Teilbibliographie zu Prälat Dr. Werner Groß • Georg Ott-Stelzner e-Mail: [email protected] Stellvertretender Leiter des Amtes Aus der Praxis für Kirchenmusik · Fachstelle für das 18 Chornotenrecherche leicht(er) gemacht!?! • Regionalkantor Thomas Gindele Glockenwesen: Prof. Dr. Hans Schnieders Telefon (07472) 169 952 22 Hallo, Vermittlung? • Reiner Schulte N e-Mail: [email protected] E G N U L I Mitteilungen E Bürozeiten T T I Kirchenmusik: Mo und Do Vormittag M Glockenwesen: Di und Fr Vormittag 23 Amt für Kirchenmusik 30 Diözesancäcilienverband Roman Schmid 34 Pueri cantores Betreuung des Glockenwesens 35 Hochschule für Kirchenmusik Telefon: (07472) 169 956 36 Andere Institutionen e-Mail: [email protected] Bürozeiten: Mo und Di, -

Gottes- Dienst War Ein Zentrales Anliegen Des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65)
Hintergründe ∙ Geschichten ∙ Erklärungen zu einigen Kirchenliedern zusammengestellt von Beat Grögli und illustriert von Sophia Bihler 1 Weisst du auch, was du singst? Kirchenlieder erzählen Geschichten. Sie sind in einem bestimmten Kontext entstanden, sind verbunden mit den kulturellen und gesell- schaftlichen Strömungen ihrer Zeit, haben sich entwickelt und wurden neuen Begebenheiten angepasst. Wer etwas davon weiss, wird sie mit mehr Gewinn singen. In der Apostelgeschichte (8,30) fragt der Apostel Philippus einen Jerusa- lem-Wallfahrer, neben dessen Wagen er hergeht und der im Buch des Propheten Jesaja liest: Weisst du auch, was du liest? Die Erklärungen des Apostels erschliessen dem anderen den Sinn der Heiligen Schrift. Diese kleine Broschüre möchte eine Hilfe sein bei der Frage: Weisst du auch, was du singst? Kirchenlieder sind nicht verstaubt und langweilig, sondern spannend und schön! Die Erklärungen in dieser Broschüre sind kurz. Das hängt damit zusam- men, dass ich sie zuerst für den Anschlagkasten in der Wallfahrtskirche Heiligkreuz verfasste. Mehr als zwei Seiten Text hatten dort nicht Platz! Ich musste mich auf einige wesentliche Punkte konzentrieren. Eine weitere Einschränkung ist die Auswahl der Lieder, die ausschliesslich aus dem Katholischen Gesangbuch (KG) stammen. Die Darstellung folgt der dortigen Nummerierung. Eine grosse Hilfe bei der Zusammenstellung dieser Erläuterungen war mir das Buch Geistliches Wunderhorn. Grosse deutsche Kirchenlieder (im Folgenden abgekürzt mit GW), das 2001 im C.H. Beck-Verlag erschienen ist. Wer sich weiter vertiefen will, ist dort gut bedient. Herzlich danke ich Sophia Bihler aus dem Heiligkreuz für die Illustra- tionen, die sie mit jugendlichem Elan ins Werk gesetzt hat. St. Gallen, am Gedenktag der heiligen Cäcilia, 22. -

Impulse Zum Beten Kleine Pause Start in Den
Da formte Gott, der Herr, den Menschen, Staub vom Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet Erdboden, und blies in seine Nase den Lebensatem. finden; klopft an und es wird euch geöffnet! Denn wer So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer Genesis, 2,7 anklopft, dem wird geöffnet. Matthäus 7, 7-8 Start Start in den Tag Kleine Pause im namen des vaters Beten die welt betrachten indem man atmet die schöpfung die Augen schließt behutsam in die hände nehmen sich verwahrt das staunen üben sich auftut und schaut plant organisiert im namen des sohnes es gut machen will Nacht: Impulse zum Beten die Sache einrenkt die menschen wahrnehmen warmherzig und mit güte weiterdenkt mit ehrlichkeit Beten im Gehen und mit zärtlichkeit auf eigenen Beinen in und mit dieser Welt im namen des heiligen geistes das evangelium leben Arbeit als Gebet kirche lebendig machen die Phantasie und die Hoffnung die zukunft gestalten die Aufmerksamkeit mit vertrauen und freude der innere Ruck Vom Morgen bis zur das Telefongespräch am Schreibtisch Susanne Körber beim coffee to go Beten im Alltag in allem und jedem zu Hause das Glück duesseldorf.de das Glas in der Hand - Umarmung Gebet mit der Haut mit den Fingern der Zunge flingern - Gebet der Zärtlichkeit Beten jeden Tag neu der graue Morgen der Regentag und die Sonne im Herbst Als pdf verfügbar unter: verfügbar Als pdf www.katholisches und ach Gott einfach nur so und doch einfach Vertrauen einfach du Gott nach Lothar Zenetti, Beten durch die Schallmauer, S.25 Zachäus suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch Ich, ich selber werde meine Schafe weiden und ich, ich Er lässt deinen Fuß nicht wanken; er, der dich behütet, er konnte es nicht wegen der Menschenmenge; denn er selber werde sie ruhen lassen - Spruch GOTTES, des schläft nicht. -

Das Fußballstadion Als Stätte Inklusiver Kultur –
Titel „Das Fußballstadion als Stätte inklusiver Kultur – Eine Untersuchung der Interaktionen von Fans des 1. FSV Mainz 05 zur Teilhabe der Fans mit Behinderungen“ Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) eingereicht am gemeinsamen Promotionszentrum Soziale Arbeit der Hochschule RheinMain, der Hochschule Fulda, der Frankfurt University of Applied Sciences und der Hochschule Darmstadt Kerstin Steinfurth Dienheim Geb. 28.06.1963 in Nierstein Erstbetreuer: Prof. Dr. Petra Gromann Hochschule Fulda Zweitbetreuerin: Prof. Dr. Henning Daßler Hochschule Fulda Eingereicht im Juli 2020 Prüfungstermin 28. Oktober 2020 Erscheinungsort: Fulda im November 2020 Zusammenfassung ‚Inklusiv leben‘ heißt, selbstverständlich Teil einer Gesellschaft sein und bedeutet, sich einbringen und gut aufgehoben fühlen in einem Netzwerk von gewünschten Beziehungen. Danach strebt der Mensch, das ist Teil seines persönlichen Glücks. Menschen mit Behinderungen erfahren auch heute noch trotz grundsätzlicher rechtlicher Gleichstellung Stigmatisierungen und strukturelle Diskriminierung. Ziel der Studie ist es Gelin- gensbedingungen von inklusiven Lebensräumen zu untersuchen. Es wird davon ausgegangen, dass sich Men- schen durch die direkte Begegnung mit anderen als Teil der Gemeinschaft fühlen. Das Stadion des Fußballver- eins 1. FSV Mainz 05 erfüllt die strukturellen Voraussetzungen der barrierefreien Zugänglichkeit und bietet damit Fans mit und ohne Behinderungen die Möglichkeit zur Begegnung. Ob diese Begegnungen auch den qualitativen Anforderungen des persönlichen Wohlbefindens gerecht werden, wurde mittels der Grounded Theory Methode überprüft. Im Ergebnis bestätigen sich im Stadion des 1. FSV Mainz 05 die barrierefreie und sozialräumliche Ausgestaltung des Umfelds sowie der wertegetragene Umgang in den Begegnungen der Fans untereinander und des Vereins. Die Studie zeigt auf, dass Menschen mit und ohne Behinderungen die gleichen Interessen hinsichtlich des eigenen guten Lebens verfolgen. -

19-11-30 Programm SKM 1030 (Fortlaufend)
Der Eintritt zu den Stunden der Kirchenmusik ist frei. Wir bitten Sie herzlich um Ihren großzügigen Beitrag zur Finanzierung der Stunde der Kirchenmusik (Richtwert 10 €). Auch für Spenden sind wir sehr dankbar. Spendenkonto der Kilianskirche Heilbronn Evangelischen Kirchenpflege Heilbronn DE47 6205 0000 0000 0031 62 HEISDE66XXX; Stichwort „Kirchenmusik Kilianskirche Heilbronn“. Spendenquittungen werden zugesandt. Herzliche Einladung zu unseren nächsten Veranstaltungen: 1. Advent, 1. Dezember, 9:30 Uhr - Kantaten-Gottesdienst Stunde der Kirchenmusik Mittwoch, 4. Dezember, 20 Uhr – Gedenkkonzert am 75. Jahrestag der Zerstörung Heilbronns mit dem Philharmonischen Chor HN Samstag, 30. November 2019 Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis (1030) Samstag, 7. Dezember, 18 Uhr – Stunde der Kirchenmusik Kammerchor der Hochschule für Künste Bremen Wie schön leuchtet der Morgenstern Sonntag, 8. Dezember, 2. Advent, 10 Uhr – Gedenk-Gottesdienst Landesbischof Dr. Frank Otfried July, Vokalensemble Heilbronn Sonntag, 8. Dezember, 2. Advent, 17 Uhr – Oratorienkonzert Heinrich-Schütz-Chor Heilbronn – Saint-Saëns: Oratorio de Noël Samstag, 14. Dezember, 18-19 Uhr – Stunde der Kirchenmusik (1032) Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr – Oratorienkonzert Maranatha Bach: Weihnachtsoratorium, Kantaten I-III Bach-Chor Kilianskirche Heilbronn Jugendchor der Kilians- & Friedensgemeinde Orchester Ensemble Operino auf historischen Instrumenten Collegium Musicum Kilianskirche Tabea Schmidt (Sopran), Sigrun Bornträger (Alt), Christian Georg (Tenor), Kai Preußker (Bass), Leitung: KMD Stefan Skobowsky Samstag, 21. Dezember, 18 Uhr – Stunde der Kirchenmusik (1033) - Adventssingen ************ Wir laden ein zur Orgelmusik zur Marktzeit in der Kilianskirche jeden Samstag 11 Uhr bis etwa 11.30 Uhr – Eintritt frei! Sie finden das Programm der Stunde der Kirchenmusik freitags als PDF unter: http://www.kirchenmusik-heilbronn.de/veranstaltungen/stunde-der-kirchenmusik/ Stunde der Kirchenmusik ************ Samstag, 30. -

Lieder-Liste 140130 Für Geplante Cusic-Mappe Mit Quellen
Inhaltsverzeichnis der geplanten Cusic-Mappe 1-220 (01/2014) Quelle der Vorlage [mit Lied-Nr.] : Kzg. : Kreuzungen [von Martin Müller, Sasbach] E&H : Erdentöne-Himmelsklang [Schwabenv.] SmH : Singt mit Herz [Druck Hartmann, Han.] € pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro …) …) …) …) …) …) …) k+s : kommt und singt [Erzbistum Köln] GL : Neues Gotteslob [Bistümer Deutschlands] LZ : Liederzettel sehr unterschiedlicher Herkunft AnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlder Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen TonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonart : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle KostenKostenKostenKostenKostenKostenKostenKosten(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.- Nr. Liedtitel Quelle Autoren : Text / Musik Copyright ( ggf. Text / Musik ) s = € Bem. Hanna Lam / Wim ter Burg | Verlag G. F. Callenbach, Nijkerk NL | 113 Abraham, Abraham, verlass dein Land k+s 351 1 = dt. Übertr. Diethard Zils Gustav Bosse Verlag, Regensburg 032 Alle Knospen springen auf Kzg 11 Wilhelm Willms / Ludger Edelkötter KIMU Kindermusikverlag GmbH, Pullheim 1 = 143 Amen ! Amen ! Kzg 14 Spiritual 1 4+ 174 Ameni, Amen - All ihr Werke lobt -

Katalog 2019 2 >
Katalog 2019 2 > Wer nicht neugierig ist, singt nichts Neues. Das sind wir > Neue Noten! Digitale Noten! Neugierig? > www.dehm-verlag.de Katalog 2019 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm 3 Das sind wir ... < > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust, und mehr… Der Dehm Verlag ist ein Partner für kreative Köpfe, die ihr musikalisches Schaffen und ihre Ideen in die Öffentlichkeit bringen möchten. Weil uns die Musik am Herzen liegt, weil Musik belebt, verbindet und bewegt, arbeiten wir mit Musiker/innen und Texter/innen stets an neuen Liedern und Chorwerken. Das sind wir > Patrick Dehm Cornelius Dehm Jürgen Kandziora 2019 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm Verleger: Patrick Dehm Dehm Verlag e.K. Rechte & Lizenzen: Cornelius Dehm Auf der Unterheide 40 Notensatz: Jürgen Kandziora 65549 Limburg/Lahn Gestaltung: Ulrike Mahr, Tel. +49 (0) 6431-71905 Mahr Graphic & Performing Arts, Kronach Fax +49 (0) 6431-976016 Preisänderungen, Lieferbarkeit und Irrtümer [email protected] vorbehalten. (Stand: Februar 2019) www.dehm-verlag.de 4 > Das sind wir ... > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust, und mehr… > Notenmaterial und Fortbildung Das ist unser Beitrag, damit sich neue Chöre gründen und bestehende Chöre neue Nahrung finden. Chöre und Kirchengemeinden suchen nach zeitgenössischen Texten und Musik. Das nehmen wir ernst und bieten modernes Notenmaterial an. Das sind wir Um unser Ziel zu erreichen, Chören zu lebendiger Musik und zeitgemäßer Sprache zu > verhelfen, haben wir Seminare mit Tagesworkshops, halbtägigem und ganztägigem offenen Singen und einer einwöchigen Fortbildung entwickelt. Infos zu den Fortbildungen finden sich auf unserer Website www.neuesgeistlicheslied.de. -

Freiburger Chorbuch
Freiburger Chorbuch herausgegeben vom Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Cäcilienverband für Deutschland und dem Diözesan-Cäcilienverband der Erzdiözese Freiburg 2.075 Im Auftrag des Amts für Kirchenmusik der Erzdiözese Zur Auflage von 2014: Freiburg und in ständiger Abstimmung mit der Kommis- Anlässlich des Erscheinens des neuen GOTTESLOB sion für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg erarbeite- wurde das FREIBURGER CHORBUCH an die neue ten das FREIBURGER CHORBUCH in den Jahren 1991- Nummernzählung angepasst. In Klammern gesetzte 1994 als Chorbuch-Kommission: Liednummern weisen auf Textvarianten des neuen GOTTESLOB gegenüber der abgedruckten Fassung KMD Thomas Drescher hin. Sind nur einzelne Strophen betroffen, wurden le- (Mainz, früher Bezirkskantor in Tauberbischofsheim) diglich die betreffenden Strophennummern einge- Dommusikdirektor Martin Dücker klammert. In den Notentext wurden diese Änderun- (Stuttgart, früher Bezirkskantor in Rastatt) gen nicht übernommen, damit die Kompatibilität zu Bezirkskantor Jürgen Essl (Sigmaringen) früheren Auflagen des FREIBURGER CHORBUCHS Bezirkskantorin Brigitte Fröhlich (Mannheim) gewährleistet bleibt. Bezirkskantor und Münsterchordirektor Wilm Geismann (Konstanz), Präsident des PUERI-CANTORES-Verbands in der Erzdiözese Freiburg Bezirkskantor Mathias Kohlmann (Pforzheim) Bezirkskantor Jürgen Maag (Heidelberg) Bezirkskantor Leo Langer (Bruchsal) Bezirkskantor Jürgen Ochs (Breisach, Rastatt) Bezirks- und Münsterkantor Stephan Rommelspacher (Villingen). Darüber -
Inhaltsverzeichnis
Titel xxxxxxxxxx | 1 Inhaltsverzeichnis Wort zum Geleit 3 Einleitung 5 Andachten Morgen 7 Mittag 14 Abend mit Tagesrückblick 18 Abend mit Wochenrückblick 27 Beginn der Sitzung 36 Advent 40 Weihnachtszeit 49 Buße 58 Passion 65 Osterzeit 74 Ökumene 82 Dank 91 Schöpfung 100 Zeugen des Glaubens und Vorbilder der Nächstenliebe 108 Totengedächtnis 117 Unglücksfall 125 Erweiterungen und Alternativen Lichtfeier zum Beginn einer Abendandacht 135 Weihrauchspende 138 Taufgedächtnis 140 Alternative Gebete und Lieder 144 Fundstellen für alternative Bibeltexte 149 Quellenverzeichnis 150 Impressum 2 | Kleine ökumenische Andachten Wort zum Geleit | 3 Wort zum Geleit Das Buch, das Sie in den Händen halten, ist von einer gemeinsa- men Arbeitsgruppe von Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen aus der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und dem Bistum Hildesheim erar beitet worden. Es soll kleinen Gemein- schaften die Möglichkeit geben, ohne großen Aufwand und ohne aufwendige Vorbereitungsarbeiten ökumenische Andachten zu feiern. Gerade in kleineren Orten und in manchen Stadtteilen gibt es eine große Verbundenheit der Gläubigen mit „ihrer“ Kirche. Leider kön- nen die ordinierten Seelsorgerinnen und Seelsorger nicht mehr in jeder Kirche regel mäßig die Leitung von Gottesdiensten überneh- men. Mit dem Buch „Einfach gemeinsam feiern – Kleine ökumeni- sche Andachten“ verbinden wir Bischöfe die Hoffnung, dass sich Gläubige über die Konfessionsgrenzen hinaus zum regelmäßigen Gebet in der Kirche ihres Ortes bzw. ihres Stadtteiles treffen und unsere Kirchen auf diese Weise „durchbetete Räume“ bleiben. Nicht zuletzt entspricht das Feiern von ökumenischen Andach- ten der fünften Leitlinie der Charta Oecumenica, die die Kirchen Niedersachsens am 13. Mai 2007 unterzeichnet haben. Sie lautet: „Gemeinsam beten“. Auf dieser Grundlage möchten wir mit diesem Andachtsbuch ei- nen deutlichen ökumenischen Impuls setzen: Das gemeinsame Gebet ist der Grundpfeiler für alle ökumenischen Aktivitäten. -

Werkhilfe-Singheft-2009.Pdf (122,3 Kib)
Singheft’09 Werkhilfe 1 Was bei den Menschen unmöglich ist Die Postkarte (CS 60009) kann zur Erarbeitung für die Gemeinde sehr hilfreich sein. Der Kanon ist nicht ganz einfach. Wenn der Chor ihn gelernt hat und vollständig singt, kann die Gemeinde auch nur Teile übernehmen, z.B.: • Nur die 1. Zeile wiederholend oder • Zeile 1 und 2 einstimmig oder im Kanon oder • Zeile 1 und 3 einstimmig oder im Kanon. Bei der Erarbeitung muss die zweite Zeile als Variante der ersten verstanden werden. Als Beispiel (m)ein Einführungstext für die Erarbeitung: 1. Zeile „Wenn wir jetzt die Jahreslosung für dieses Jahre singen wollen, muss uns bewusst sein, dass wir ein Jesuszitat übernehmen. Die erste Zeile unseres Kanons hat musikalisch den Charakter von Glaubenssicherheit: Ja, ich glaube, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Weil ich das glaube, kann ich diesen Satz flüssig sprechen und gliedere ihn sinngemäß. So ist auch die Melodie gestaltet.“ Aufgabe: Vorsingen – nachsingen der ersten Kanonzeile. Man achte auf die Akzente: „…Menschen unmöglich, das ist…“. 2. Zeile „Wenn ich aber unsicher bin, dann – stockt meine – Sprache während meines Sprechens an – ganz unsinnigen – Stellen. Wenn der Zweifel, während ich spreche, mich überfällt, wenn ich also den Inhalt während des Sprechens infrage stelle, dann stockt der Text: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist – wirklich? – bei Gott möglich? So ist auch die Melodie gegliedert. Aufgabe: Vorsingen – nachsingen der zweiten Kanonzeile. Der Akzent liegt auf dem ers- ten „ist“! Erste und zweite Zeilen vor- und nachsingen. 3. Zeile Wenn wir den Zweifel überwunden haben, können wir – die langen Tönen deutlich set- zend – betonen, dass wir daran glauben, dass Gott alles möglich machen kann.