Das Fußballstadion Als Stätte Inklusiver Kultur –
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
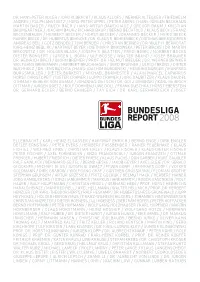
BUNDESLIGA REPORT 2008 Zur Lage Der Liga Die Geschäftsbereiche Europa Die Proficlubs Die Fakten
DR. REINHOLD LUNOW / PROF. DR. PETER LUTZ / FRANK MACKERODT / FELIX MAGATH / FRANZ DR. HANS-PETER ADLER / JÖRG ALBRACHT / KLAUS ALLOFS / WERNER ALTEGOER / FRIEDHELM MAGET / DR. ULRICH MALY / LOVRO MANDAC / THORSTEN MANSKE / WILLI MANTEL / RALF ANDRES / RALPH ANSTOETZ / HANS-PETER APPEL / PETER ARENS / HANS-JÜRGEN BACKHAUS ANTHEY / HELMUT MARKWORT / HERBERT MARONN / HORST MARSCHALL / BERNHARD MARTIN BADER / RUEDI BAER / HANS-ARTUR BAUCKHAGE / GREGOR BAUM / KRISTIAN MATTES / NORBERT MAURER / GERD E. MÄUSER / PETER MAYER / GERHARD MAYER- BÄUMGÄRTNER / JOACHIM BAUR / RICHARD BAUR / BERND BECHTOLD / KLAUS BECK / FRANZ STRUKTUREN DES PROFIFUSSBALLS VORFELDER / ANDREAS MECHLER / MICHAEL MEESKE / ELMAR MEIER / MICHAEL MEIER BECKENBAUER / HERBERT BECKER / HORST BECKER / JOHANNES BECKER / HEIKO BEECK MICHAEL MEIER / PER MERTESACKER / RAINER MEYER / ANDREAS MÜLLER / CHRISTIAN RAINER BEECK / DR. HUBERTUS BEHNCKE / DR. KLAUS R. BEHRENBECK / DIETMAR BEIERSDORFER Am 18. Dezember 2000, nach 39 Jahren in der Verantwortung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), unter- MÜLLER / DIETER MÜLLER / GERD MÜLLER / HORST MÜLLER / MANFRED MÜLLER / DR. ANDREAS BEIL / GÖTZ BENDER / TOM BENDER / CHRISTIAN BERNER / DR. WULF H. BERNOTAT nahmen die Vereine und Kapitalgesellschaften der Bundesliga und 2. Bundesliga mit der Gründung des Liga- WOLFGANG MÜLLER /ECKHART MÜLLER-HEYDENREICH / ANTON NAGL / BIRGER NASS KARL-HEINZ BEUL JR. / HARTMUT BEYER / DIETMAR P. BINKOWSKA / PETER BIRCKS / DR. MARTIN verbandes den Schritt in die Unabhängigkeit. Seither bilden Ligaverband und DFB die zwei großen Säulen MICHAEL NEITEMEIER / WILLI NEUBERGER / WOLFGANG NEUBERT / FRIEDRICH NEUKIRCH BISKOWITZ / DR. HOLGER BLASK / JOSEPH S. BLATTER / FREDI BOBIC / NORBERT BOCKS des deutschen Fußballs. Wie die Landesverbände des DFB ist der Ligaverband stimmberechtigtes, ordent- KONSTANTIN NEVEN DUMONT / GÜNTER NIEMEYER / TILL NOACK / PETER NØRRELUND / MARC DIETER BONGERT / JÜRGEN L. -

Lieder-Liste 140130 Für Geplante Cusic-Mappe Mit Quellen
Inhaltsverzeichnis der geplanten Cusic-Mappe 1-220 (01/2014) Quelle der Vorlage [mit Lied-Nr.] : Kzg. : Kreuzungen [von Martin Müller, Sasbach] E&H : Erdentöne-Himmelsklang [Schwabenv.] SmH : Singt mit Herz [Druck Hartmann, Han.] € pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro …) …) …) …) …) …) …) k+s : kommt und singt [Erzbistum Köln] GL : Neues Gotteslob [Bistümer Deutschlands] LZ : Liederzettel sehr unterschiedlicher Herkunft AnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlder Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen TonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonart : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle KostenKostenKostenKostenKostenKostenKostenKosten(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.- Nr. Liedtitel Quelle Autoren : Text / Musik Copyright ( ggf. Text / Musik ) s = € Bem. Hanna Lam / Wim ter Burg | Verlag G. F. Callenbach, Nijkerk NL | 113 Abraham, Abraham, verlass dein Land k+s 351 1 = dt. Übertr. Diethard Zils Gustav Bosse Verlag, Regensburg 032 Alle Knospen springen auf Kzg 11 Wilhelm Willms / Ludger Edelkötter KIMU Kindermusikverlag GmbH, Pullheim 1 = 143 Amen ! Amen ! Kzg 14 Spiritual 1 4+ 174 Ameni, Amen - All ihr Werke lobt -

Gewarnt, Motiviert Und Hellwach
Bundesliga 2016/17 € GEWARNT, MOTIVIERT AUSGABE 16 19.03.2017 · 1,00 UND HELLWACH Heute zu Gast: FC Schalke 04 www.mainz05.de Offizieller Premium-Partner So gut kann Bier schmecken. _0JEZW_Bitb_Anstossende_Pokale_der_Nullfuenfer_170x250+3.indd 1 06.03.17 10:14 Inhalt 3 Ausgabe 14, BUNDESLIGA 2016/17 20 20 INTERNATIONAL Fabian Frei hat in der Fußballwelt mehr erlebt als die meisten Nullfünfer. Der Schweizer erlebte die großen Turniere, mischte mit dem FC Basel in Champions und Europa League mit. Bei den Mainzern zieht der vielseitige Frei gerne im Zentrum die Fäden. 10 32 UNSER GAST Der FC Schalke 04 spielt eine Saison mit vie- len Aufs und Abs. Hätte die Elf von Trainer Markus Weinzierl am vorigen Spieltag den FC Augsburg nicht 3:0 geschlagen, wäre der Vorsprung zu Relegationsplatz 16 auf einen Punkt geschmolzen. 10 RÜCKKEHR Für viele Nullfünfer ist dieses Duell eine außer- gewöhnliche Geschichte. Ein Wiedersehen der emotionalen Sorte. Christian Heidel erlebt heute sein erstes Auswärtsspiel in Mainz - als Manager des FC Schalke 04 gegen seine Nullfünfer. 16 FÜNF FRAGEN Christian Heidel über sein erstes Auswärtsspiel in Mainz, den Unterschied zwischen Schalke 04 32 und Mainz 05 und eine Saison wie eine Achterbahnfahrt. klimaneutral natureOffice.com | DE-218-931712 Impressum gedruckt Herausgeber 1. FSV Mainz 05, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, [email protected], www.mainz05.de Verantwortlich Tobias Sparwasser (Geschäftsführer Medien/PR) Redaktion Silke Bannick, Daniel Haas, Lukas Schmidt, Kieran Brown Layout, Satz, Litho Mario Schick Weitere Autoren Andreas Böhm, Claus Höfling, Max Sprick, Matthias Schlenger Fotos Torsten Zimmermann, René Vigneron, Stefan Sämmer, Daniel Haas, Lukas Schmidt, Hasan Bratic, Tobias Jeschke, Imago, DFL (Getty Images) Druck odd GmbH & Co. -

Knappenschmiede Magazin 2016 / 2017 2
Knappenschmiede Magazin 2016 / 2017 2 www.knappenschmiede.de 3 instagram.com/knappenschmiede facebook.com/knappenschmiede twitter.com/knappenschmiede Snapchat: schmiedesnaps 4 VORWORT Der Sommer ist vorbei und unsere elf Teams aus der muss. Geduld ist ein entscheidender Faktor in der Knappenschmiede sind wieder am Ball. Die Saison Ausbildung und Förderung junger Spieler. 2016/2017 läuft und wie immer haben wir uns auch für diese Spielzeit viel vorgenommen. Auch die Konkurrenz gerade in unserer Region ist enorm und hat zuletzt viel Wert auf die Jugendarbeit Unser erstes, unser oberstes Ziel ist und bleibt, jun- gelegt. Woanders wird auch gut ausgebildet. Das ge Talenten auf dem Weg in den Profifußball sport- wissen wir, doch dies ist nur ein weiterer Ansporn lich und menschlich zu begleiten – im Idealfall für für uns. Ansporn, uns nicht zurückzulehnen, sondern die Arena, für uns, für den S04. Das ist uns in den alle Kräfte in unserer täglichen Arbeit mit den Jungs zurückliegenden Jahren immer wieder hervorragend zu bündeln. Nachwuchs ist Schalke wichtig, und wir gelungen. Absolventen der Knappeschmiede werden sind stolz auf das, was die Knappenschmiede, was zudem national wie international sehr geschätzt. der gesamte Club, was alle beteiligten Mitarbeiter Nachwuchsarbeit made in Schalke ist ein Gütesie- leisten: modernste Ausbildungsarbeit. gel, das für Qualität bürgt. Julian Draxler und jüngst Leroy Sane oder Max Meyer sind aktuelle Beispiele Überzeugen Sie sich selbst davon. Auf dem Platz bei dafür, ohne all die anderen vergessen zu wollen. einem Spiel unserer Junioren. In der VELTNS-Arena. Wenn sie Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwe- Unser zweites Ziel ist es natürlich, dass unsere des und Max Meyer im DFB-Trikot zuschauen. -

Werkhilfe-Singheft-2009.Pdf (122,3 Kib)
Singheft’09 Werkhilfe 1 Was bei den Menschen unmöglich ist Die Postkarte (CS 60009) kann zur Erarbeitung für die Gemeinde sehr hilfreich sein. Der Kanon ist nicht ganz einfach. Wenn der Chor ihn gelernt hat und vollständig singt, kann die Gemeinde auch nur Teile übernehmen, z.B.: • Nur die 1. Zeile wiederholend oder • Zeile 1 und 2 einstimmig oder im Kanon oder • Zeile 1 und 3 einstimmig oder im Kanon. Bei der Erarbeitung muss die zweite Zeile als Variante der ersten verstanden werden. Als Beispiel (m)ein Einführungstext für die Erarbeitung: 1. Zeile „Wenn wir jetzt die Jahreslosung für dieses Jahre singen wollen, muss uns bewusst sein, dass wir ein Jesuszitat übernehmen. Die erste Zeile unseres Kanons hat musikalisch den Charakter von Glaubenssicherheit: Ja, ich glaube, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Weil ich das glaube, kann ich diesen Satz flüssig sprechen und gliedere ihn sinngemäß. So ist auch die Melodie gestaltet.“ Aufgabe: Vorsingen – nachsingen der ersten Kanonzeile. Man achte auf die Akzente: „…Menschen unmöglich, das ist…“. 2. Zeile „Wenn ich aber unsicher bin, dann – stockt meine – Sprache während meines Sprechens an – ganz unsinnigen – Stellen. Wenn der Zweifel, während ich spreche, mich überfällt, wenn ich also den Inhalt während des Sprechens infrage stelle, dann stockt der Text: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist – wirklich? – bei Gott möglich? So ist auch die Melodie gegliedert. Aufgabe: Vorsingen – nachsingen der zweiten Kanonzeile. Der Akzent liegt auf dem ers- ten „ist“! Erste und zweite Zeilen vor- und nachsingen. 3. Zeile Wenn wir den Zweifel überwunden haben, können wir – die langen Tönen deutlich set- zend – betonen, dass wir daran glauben, dass Gott alles möglich machen kann. -

Wir Haben Am Samstag Was Vor!
Bundesliga 2016/17 € WIR HABEN AM SAMSTAG AUSGABE 6 29.10.2016 · 1,00 WAS VOR! Heute zu Gast: FC Ingolstadt 04 www.mainz05.de Offizieller Premium-Partner Wenn aus gemeinsamen Momenten besondere werden. Wenn aus Bier Bitburger wird. _0FZWE_Bitb_Mainz_DerNullfuenfer_Mannschaftsmotiv_Mainz_05_170x250+3.indd 1 05.10.16 17:57 Inhalt 3 Ausgabe 6, BUNDESLIGA 2016/17 20 32 BunDESLIGA-SAISON 2 Die Schanzer vom FC Ingolstadt 04 wollen nach dem Stotterstart den Anschluss wahren und so schnell wie möglich in sichere Gefilde. 12 52 18.562 EurO Der 05er Fanclub MAINZ 05 – LIEBE LEBEN LEIDENSCHAFT hat wieder für den guten Zweck Geld gesammelt, und erneut kam eine stolze Summe dabei rum. 12 SAMSTAG, 15.30 UHR Zur besten Bundesliga-Zeit empfangen die Mainzer die einzige Mannschaft, gegen die sie in der Bundesliga bisher nur verloren haben. 19 REISEFIEBER Wo relaxt Stefan Bell am liebsten? Und welches besondere Fußballspiel der Innenverteidiger selbst mal als Fan erleben will. 20 NUMMER 8 U21-Nationalspieler Levin Öztunali möchte bei Mainz 05 seinen nächsten Entwicklungsschritt machen 32 und alsbald zu den Leistungsträgern des Teams gehören. Impressum Herausgeber 1. FSV Mainz 05, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, [email protected], www.mainz05.de Verantwortlich Tobias Sparwasser (Geschäftsführer Medien/PR) Redaktion Silke Bannick, Daniel Haas, Lukas Schmidt, Kieran Brown Layout, Satz, Litho Mario Schick Weitere Autoren Andreas Böhm, Claus Höfling, Max Sprick, Matthias Schlenger klimaneutral Fotos Torsten Zimmermann, René Vigneron, Stefan Sämmer, Daniel Haas, Lukas Schmidt, Hasan Bratic, Tobias Jeschke, Imago, DFL (Getty Images) Druck odd GmbH & Co. KG Print + Medien, natureOffice.com | DE-218-687143 gedruckt Otto-Meffert-Straße 5, 55543 Bad Kreuznach, [email protected], www.odd.de Anzeigen Marketingabteilung des 1. -

„Der Himmel Geht Über Allen Auf“
Feiertag im Deutschlandradio Kultur Theologieprofessor Günter Ruddat aus Bochum „Der Himmel geht über allen auf“ Singen auf Evangelisch 28. Mai 2017 Heute morgen in Berlin, da erinnere ich mich an meinen ersten Kirchentag 1961 – kurz vor dem Mauerbau. Gerade frisch konfirmiert war ich als evangelischer Pfadfinder dabei, wohl einer der jüngsten unter den vielen Helferinnen und Helfern. Zum Abschluss der Gottesdienst im riesigen Olympiastadion, ein einziger Klangteppich. Damals ahnte kaum jemand: dieser Kirchentag sollte für lange Zeit der letzte gesamtdeutsche Kirchentag sein. Heute Mittag um 12 Uhr auf den Elbwiesen am Rande der Lutherstadt Wittenberg wollen Menschen aus aller Welt einen ganz besonderen Festgottesdienst feiern unter dem Motto „Von Angesicht zu Angesicht“. Sie feiern damit nicht nur den Abschluss des diesjährigen Evangelischen Kirchentags in Berlin und Witten- berg, sondern zugleich 500 Jahre Reformation. „Singen und Sagen“, unter diesem Motto löste vor 500 Jahren die Glaubensbewegung der Reformation so etwas wie eine ansteckende Singbewegung aus: die Menschenfreundlichkeit Gottes sollte auch in der Spra- che des Volkes lebendig werden. Aus vielen Volksliedern wurden so Kirchenlieder, die Menschen konnten im wahrsten Sinne des Wortes den Mund aufmachen und aus vollem Herzen singen im Gottesdienst, in den Schulen und zuhause. Heute in Wittenberg werden nicht nur evangelische Christinnen und Christen bewegt von der Losung „Du siehst mich“, sie feiern und stehen ein für ihren Glauben in der Gegenwart, teilen Brot und Wein, bunt, viel- sprachig, hoffnungsvoll. Erwartet werden mehr als 100.000 Menschen, sie wissen sich im Glauben verbunden, setzen ein Friedens- zeichen und zeigen: Gott ist bei uns. Gott verändert uns und unsere Welt. -

Gottesdienst Am 31. Mai 2020 St. Maria
Pfingstsonntag 2020 – nur für den privaten einmaligen gottesdienstlichen Gebrauch 1 GOTTESDIENST AM 31. MAI 2020 ST. MARIA EINZUG GL 347 DER GEIST DES HERRN ERFÜLLT 1. Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten; er krönt mit Jubel Berg und Tal, er lässt die Wasser fluten. Ganz überströmt von Glanz und Licht erhebt die Schöpfung ihr Gesicht,frohlockend: Halleluja. 2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist in Sehern und Propheten, der das Erbarmen Gottes weist und Heil in tiefsten Nöten. Seht, aus der Nacht Verheißung blüht; die Hoffnung hebt sich wie ein Lied und jubelt: Halleluja. T: Maria Luise Thurmair (1941)1946 | M: Melchior Vulpius 1609 BEGRÜßUNG KYRIE GL 165 SEND UNS DEINES GEISTES KRAFT K Send uns deines Geistes Kraft, / der die Welten neu erschafft: A Christus, Herr, erbarme dich. K Lass uns als Waisen nicht, / zeig uns des Trösters Licht: A Christus, erbarme dich. K Dass in uns das Herz entbrennt, / deiner Gnade Reich erkennt: A Christus, Herr, erbarme dich. T: MARIA LUISE THURMAIR 1952 | M: HEINRICH ROHR 1952 GLORIA GL 172 GOTT IN DER HÖH SEI PREIS UND EHR Gott in der Höh sei Preis und Ehr, / den Menschen Fried auf Erden. Allmächtger Vater, höchster Herr, / du sollst verherrlicht werden. Herrr Jesus Christus, Gottes Sohn, / wir rühmen Deinen Namen du wohnst mit Gott / dem heilgen Geist / im Licht des Vaters, Amen. T: EGB 1971 nach dem Gloria | M: Augsburg 1659/EGB ZWISCHENGESANG GL 346 ATME IN UNS, HEILIGER GEIST Kv Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm! 2 – nur für den privaten einmaligen gottesdienstlichen Gebrauch Pfingstsonntag 2020 3. -

Heurich, Winfried, *13. Febr. 1940 in Neuhof Bei Fulda
Heurich, Winfried , *13. Febr. 1940 in Neuhof bei Fulda, - Kirchenmusiker, Komponist Neuer Geistlicher Lieder. Ab dem 10. Lebensjahr erhielt W. Heurich Klavierunterricht, und ab dem 13. Lebensjahr Orgelunterricht. Die Organistenausbildung und die Lehre zum Speditionskaufmann (der anständige Beruf) liefen genauso parallel wie das Musizieren auf dem Tanzboden und der sonntägliche Organistendienst in seiner Heimatgemeinde ab dem 15. Lebensjahr. Nach Absolvierung der B-Organistenprüfung im Bistum Fulda entschloss sich W. Heurich 1962 zum Studium der Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Im Jahre 1966 schloss er dieses mit dem A-Examen ab und wurde zum hauptamtlichen Kirchenmusiker an der Frankfurter Liebfrauenkirche berufen, an der er bis Anfang 2000 wirkte. Dem Kirchenmusiker, in der von Kapuzinern geleiteten Pfarrei, boten sich im Spannungsfeld „Kunst" und „Kultur" viele musikalische Möglichkeiten, da sich in der Gemeinde auch zunehmend eine Segmentierung in so genannte „Milieus" oder „Zielgruppen" entwickelte: Die Männerschola sang Gregorianischen Choral, das Vokalensemble widmete sich in „Thematischen Gottesdiensten" dem Neuen Geistlichen Lied. Ein aus Mitgliedern der Frankfurter Oper gebildetes Vokalquartett sang an den hohen Feiertagen. Das Blechbläserquintett des Hessischen Rundfunks begleitete unter der musikalischen Leitung von W. Heurich nicht nur 25 Jahre lang die Stadtfronleichnamsfeiern auf dem Römerberg, sondern erfreute sich auch großer Beliebtheit bei festlichen Gottesdiensten in der Liebfrauenkirche. In über 60 Konzerten, während der 37 Dienstjahre Heurich's, wirkten nicht nur Chor und Orgel zusammen, -bekannte Schauspieler rezitierten Zwischentexte im Wechsel mit einem Saxophonquartett oder anderen solistischen Instrumenten. Neben dem umfangreichen Dienst an dieser City-Kirche interessierte sich Heurich ab den siebziger Jahren zunehmend für das Neue Geistliche Lied. -

Ostern Als Nagelprobe
Nummer 13 Mittwoch, 28. März 2018 17. Jahrgang Ostern als Nagelprobe Mehr noch als das Weihnachtsfest ist Ostern eine wahre Nagelprobe für uns Menschen, vor allem für unseren Glauben. Das höchste Fest der Christenheit zwingt uns nämlich zur Auseinandersetzung mit dem angespannten Verhältnis zwischen Leben und Tod, und zu einer Positionierung dazu. Bin ich der Überzeugung, dass mit dem Tod eben „alles aus“ ist, oder hege ich eine Hoffnung auf ein irgendwie geartetes „Danach“? Und: Braucht es wirklich das Kreuz für die Osterfreude? Alle Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, mogeln sich nicht am Kreuz vorbei in die Osterfreude hinein; sie begehen auch den Karfreitag und lassen sich daran erinnern, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde wie ein Verbrecher – zu unserer Rettung, wohlgemerkt! Dabei lassen sie sich aber zusagen, dass Gott auf diese Weise den Tod überwunden und – um auf das Foto Bezug zu nehmen – das Kreuz sozusagen „an den Nagel gehängt“ hat. In seinem Sohn Jesus hat er alles für die Welt und die Menschen gegeben, nicht einfach nur Peanuts, sondern sein Wertvollstes; und Jesus hat die vielen Kreuze unseres Lebens mit ans Kreuz genommen und dadurch „an den Nagel gehängt“: Das Kreuz unserer Gebrechlichkeiten und Krankhei- ten; das Kreuz unserer Schuld und unseres Versagens; das Kreuz der Gewalt, des Terrors und des Krieges; das Kreuz eigener Unzulänglichkeit und Ohnmacht; das Kreuz der Hoffnungslosigkeit und der Angst... Einfach verschwinden werden all diese Kreuze nicht, das wissen wir nur zu gut. Aber sie verändern sich in ihrer -

Thomas Tuchel Thomas Tuchel Daniel Meuren Tobias Schächter Die Biografie ZU DEN AUTOREN
Daniel MeurenTobias Schächter Thomas Tuchel Die Biografie Thomas Tuchel Tobias Schächter Daniel Meuren ZU DEN AUTOREN Daniel Meuren, Jahrgang 1973, arbeitet als Sportredakteur bei der Frank- furter Allgemeinen Zeitung und hat Bücher zu fußballhistorischen Themen und Frauenfußball im Verlag Die Werkstatt veröffentlicht. Meuren sprach Thomas Tuchel erstmals als U19-Trainer von Mainz 05 rund um den Gewinn des deutschen A-Juniorenmeistertitels 2009. Tobias Schächter, Jahrgang 1970, ist nach freier Tätigkeit (u. a. für Süd- deutsche Zeitung, die tageszeitung) inzwischen Redakteur bei den Badischen Neuesten Nachrichten in Karlsruhe. Er hat ein Buch zum Fußball in der Türkei verfasst. Schächter begegnete Tuchel zuerst auf dem Rasen: Mitte der 1990er-Jahre spielte er in der Regionalliga mit dem VfR Mannheim gegen Tuchel und den SSV Ulm. INHALT „Es gibt keinen Spannungsabfall!“ ................................. 7 Das Prinzip Tuchel Plötzlich Bundesligatrainer ...................................... 12 Vom Jugend- zum Cheftrainer in der ersten Fußballbundesliga Mit Al Pacino zum Sieg über die Bayern .......................... 25 Psychotricks und Regeln brechen „This is an emergency case!“ .................................... 38 Weshalb der Spieler Tuchel es nicht nach oben schafft Ein Besessener, der Mittelmaß verabscheut ....................... 48 Erste Schritte hin zur Trainerbank Extremer Siegeswille, extremes Selbstbewusstsein ................. 57 ... und wie man Julian Nagelsmann zur Trainerkarriere überredet Die „Bruchweg Boys“ schlagen Bayern -

Die St.Galler Singtaglieder
Die St.Galler Singtaglieder www.ref-sg.ch/musik Titel Autor/-innen Singtag Am Abend der Welt C. Rüttlinger / D. Plüss 2011 Anker in der Zeit Albert Frey 2009 Atem Gottes Albert Frey 2012 Bei dir ist die Quelle des Lebens Monika und Reto Frischknecht 2014 Beten Christoph Zehendner / Manfred Staiger 2020 Bi an den Himmel René Schärer 2020 Bleib bei uns Martin Buchholz 2019 Bliib e treu Patrick Rufer 2012 Christus lebt! Natasha Hausammann 2014 Brich ein – brich auf Esther Wild-Bislin / Roman Bislin-Wild 2014 Da berühren sich Himmel und Erde Thomas Laubach 2009 Danke (für diesen Festtag heute) Unbekannt / Martin G. Schneider 2012 Danke für alles, was du gibst, Herr Albert Frey 2012 Da wohnt ein Sehnen Anne Quigley / Eugen Eckert 2019 Das wünsch ich dir Martin Buchholz 2011 Dein Herz fürchte sich nicht Martin Buchholz 2015 Dein Wort ist ein Licht (Thy Word) Amy Grant / M.W.Smith 2009 Der Herr segne dich Martin Pepper 2010 Der Herr segne dich (Stäheli) Irene Stäheli 2014 Der Herr ist mein Hirte Mitch Schlüter / Timo Böcking / 2020 Jelena Herder Die Zeit ist reif Christoph Zehendner / 2014 Andreas Hausammann Du Albert Frey 2009 Du bisch willkomme, du ghörsch dezue Roland Pöschl 2014 Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt Martin Pepper 2010 Du bist ewig M. Lönnebo / C. Bittlinger / J. Denke / 2014 D. Plüss Du bist heilig Fritz Baltruweit / Per Harling 2010 Du bist mein Zufluchtsort Michael Lender / Gitta Leuscher 2012 Durch das Dunkel Hans-Jürgen Netz / Christoph Lehmann 2012 Du hast Erbarmen Albert Frey 2010 Es Gschänk vom Himmel Andrew Bond