Willy Brandt Und Helmut Schmidt Geschichte Einer Schwierigen Freundschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
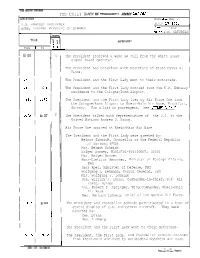
THE DAILY DIARY of PRESIDENT JIMMY CARTER DATE ~Mo
THE DAILY DIARY OF PRESIDENT JIMMY CARTER DATE ~Mo.. Day, k’r.) U.S. EMBASSY RESIDENCE JULY 15, 1978 BONN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY THE DAY 6:00 a.m. SATURDAY WOKE From 1 To R The President received a wake up call from the White House signal board operator. The President had breakfast with Secretary of State Cyrus R. Vance. 7: 48 The President and the First Lady went to their motorcade. 7:48 8~4 The President and the First Lady motored from the U.S. Embassy residence to the Cologne/Bonn Airport. 828 8s The President and the First Lady flew by Air Force One from the Cologne/Bonn Airport to Rhein-Main Air Base, Frankfurt, Germany. For a list of passengers, see 3PENDIX "A." 8:32 8: 37 The President talked with Representative of the U.S. to the United Nations Andrew J. Young. Air Force One arrived at Rhein-Main Air Base. The President and the First Lady were greeted by: Helmut Schmidt, Chancellor of the Federal Republic of Germany (FRG) Mrs. Helmut Schmidt Holger Borner, Minister-President, Hesse Mrs. Holger Borner Hans-Dietrich Genscher, Minister of Foreign Affairs, FRG Hans Apel, Minister of Defense, FRG Wolfgang J, Lehmann, Consul General, FRG Mrs. Wolfgang J. Lehmann Gen. William J. Evans, Commander-in-Chief, U.S. Air Force, Europe Col. Robert D. Springer, Wing Commander, Rhein-Main Air Base Gen. Gethard Limberg, Chief of the German Air Force 8:45 g:oo The President and Chancellor Schmidt participated in a tour of static display of U.S. -

Central Europe
Central Europe Federal Republic of Germany Domestic Affairs s JULY 1, 1979 Karl Carstens of the Christian Democratic Union (CDU) took office as the new president of the Federal Republic. He had been elected by the federal parliament to succeed Walter Scheel. Also in July CDU and the Christian Social Union (CSU), the opposition parties in the federal lower house, chose Franz Josef Strauss as their candidate for chancellor in the 1980 elections. In the state parliament elections in Berlin and Rhineland-Palatinate on March 18, the governing parties retained their majorities; the results in Berlin were CDU, 44 per cent; Social Democratic party (SDP), 43 per cent; and the Free Democratic party (FDP), 8 per cent; the results in Rhineland-Palatinate were CDU, 50 per cent; SPD, 42 per cent; FDP, 6 per cent; and the National Democratic party (NPD), .7 per cent. In the parliamentary election in the state of Schleswig-Holstein, on April 29, CDU maintained its absolute majority against SPD and FDP; the results were CDU, 48 per cent; SPD, 42 per cent; FDP, 6 per cent; and NPD, .2 per cent. In the election for the city-state parliament in Bremen, on October 7, SPD retained its absolute majority, while CDU and FDP lost a number of seats. The election for the first European parliament, in June, produced the following outcome in the Federal Republic: SPD, 40 per cent; CDU, 39 per cent; CSU, 10 per cent; FDP, 6 per cent; and the German Communist party (DK.P), .4 per cent. The voter turnout was 66 per cent. -

American Jewish Year Book
AMERICAN JEWISH YEAR BOOK A Record of Events iind Trends in American and World Jewish Life 1979 AMERICAN JEWISH COMMITTEE AND JEWISH PUBLICATION SOCIETY OF AMERICA The 1979 AMERICAN JEWISH YEAR BOOK, the seventy-ninth in the series, continues to offer a unique chronicle of developments in areas of concern to Jews throughout the world. The present volume features Professor Charles Liebman s "Leadership and Decision-making in a Jewish Federation." This in- depth study of the New York Fed- eration of Jewish Philanthropies provides important insights into the changing outlook of American Jews, and the impact this is having on Jewish communal priorities. Another feature is Professor Leon Shapiro's "Soviet Jewry Since the Death of Stalin," an authoritative overview of Jewish life in the So- viet Union during the past twenty- five years. Particularly noteworthy is Professor Shapiro's emphasis on religious life and cultural endeavors. The review of developments in the United States includes Milton Ellerin's "Intergroup Relations"; George Gruen's "The United States, Israel and the Middle East"; and Geraldine Rosenfield's "The Jewish Community Responds to (Continued on back flap) $15. American Jewish Year Book American Jewish Year Book 1 VOLUME 79 Prepared by THE AMERICAN JEWISH COMMITTEE Editors MORRIS FINE MILTON HIMMELFARB Associate Editor DAVID SINGER THE AMERICAN JEWISH COMMITTEE NEW YORK THE JEWISH PUBLICATION SOCIETY OF AMERICA PHILADELPHIA COPYRIGHT, 1978 BY THE AMERICAN JEWISH COMMITTEE AND THE JEWISH PUBLICATION SOCIETY OF AMERICA All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without permission in writing from the publisher: except by a reviewer who may quote brief passages in a review to be printed in a magazine or newspaper. -

Inhalt 1 Bundesminister Dr.-Ing. Hans-Christoph Seebohm 2
Inhalt 2.4.5 Das Verkehrsfinanzgesetz ..................... 71 2.4.5.1 Die Besteuerung als Mittel der Vorbemerkung ......................................................... 11 Verkehrspolitik........................................ 71 Der Anstoß zum Schreiben...................................... 11 2.4.5.2 Neuordnung der Abgaben des Der Wiederbeginn nach 1945.................................. 11 Verkehrs ................................................. 72 Das erste Jahrzehnt BMV........................................ 13 2.4.5.3 Lizenzierung des Werkfernverkehrs....... 74 2.4.5.4 Durchsetzung des Verkehrsfinanz- gesetzes ................................................. 74 1 Bundesminister 2.4.6 Die Reform der Pkw-Besteuerung ......... 81 Dr.-Ing. Hans-Christoph Seebohm 2.4.6.1 Reinfall auf Journalisten......................... 84 2.5 Unruhige Zeiten...................................... 86 1.1 Der Dienstantritt..................................... 20 2.6 Leiter der Unterabteilung Planung 1.2 Die Konkurrenten Adenauer und und Forschung ....................................... 87 Seebohm................................................ 20 2.6.1 Erste Kurskorrekturen ............................ 88 1.3 Erste Schritte ......................................... 21 2.6.2 Abschied von Georg Leber .................... 88 1.3.1 Eingewöhnung ....................................... 22 2.7 Der einzig Dreifach-Minister................... 89 1.3.2 Manöver-Einsatz in der Eifel.................. 22 2.7.1 Der Wissenschaftliche Beirat ................ -

Shaken, Not Stirred: Markus Wolfâ•Žs Involvement in the Guillaume Affair
Voces Novae Volume 4 Article 6 2018 Shaken, not Stirred: Markus Wolf’s Involvement in the Guillaume Affair and the Evolution of Foreign Espionage in the Former DDR Jason Hiller Chapman University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.chapman.edu/vocesnovae Recommended Citation Hiller, Jason (2018) "Shaken, not Stirred: Markus Wolf’s Involvement in the Guillaume Affair nda the Evolution of Foreign Espionage in the Former DDR," Voces Novae: Vol. 4 , Article 6. Available at: https://digitalcommons.chapman.edu/vocesnovae/vol4/iss1/6 This Article is brought to you for free and open access by Chapman University Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Voces Novae by an authorized editor of Chapman University Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Hiller: Shaken, not Stirred: Markus Wolf’s Involvement in the Guillaume A Foreign Espionage in the Former DDR Voces Novae: Chapman University Historical Review, Vol 3, No 1 (2012) HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES PHI ALPHA THETA Home > Vol 3, No 1 (2012) > Hiller Shaken, not Stirred: Markus Wolf's Involvement in the Guillaume Affair and the Evolution of Foreign Espionage in the Former DDR Jason Hiller "The principal link in the chain of revolution is the German link, and the success of the world revolution depends more on Germany than upon any other country." -V.I. Lenin, Report of October 22, 1918 The game of espionage has existed longer than most people care to think. However, it is not important how long ago it started or who invented it. What is important is the progress of espionage in the past decades and the impact it has had on powerful nations. -

Stenographischer Bericht 199. Sitzung
Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 199. Sitzung Bonn, Mittwoch, den 5. November 1975 Inhalt: Eintritt des Abg. Schetter in den Deutschen Erste Beratung des vom Bundesrat einge- Bundestag 13631 A brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Än- derung des Einkommensteuer- und Ge- Amtliche Mitteilung ohne Verlesung . 13631 B werbesteuergesetzes (Steueränderungsge- setz 1975) — Drucksache 7/3667 — Aussprache über den von der Bundesregie- Strauß CDU/CSU 13631 D rung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller SPD 13648 D über die Feststellung des Bundeshaushalts- plans für das Haushaltsjahr 1976 (Haus- Hoppe FDP 13656 D haltsgesetz 1976) Drucksache 7/4100 — Leicht CDU/CSU 13660 D in Verbindung mit Dr. Apel, Bundesminister BMF 13688 B Dr. Carstens (Fehmarn) CDU/CSU 13693 B Beratung des Finanzplans des Bundes 1975 bis 1979 — Drucksache 7/4101 — Dr. von Bülow SPD 13700 D in Verbindung mit Dr. Graf Lambsdorff FDP 13706 B Moersch, Staatsminister AA 13714 B Zweite und dritte Beratung des von der Dr. Müller-Hermann CDU/CSU 13717 C Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der Dr. Ehrenberg SPD 13723 A Haushaltsstruktur (Haushaltsstrukturgesetz) Dr. Friderichs, Bundesminister BMWi . 13727 B — Drucksachen 7/4127, 7/4193 — Bericht Dr. Sprung CDU/CSU 13729 C und Antrag des Haushaltsausschusses — Drucksachen 7/4224, 7/4243 — Blank SPD 13731 D in Verbindung mit Wohlrabe CDU/CSU 13732 C II Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 199. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 5. November 1975 Fragestunde -

Deutscher Bundestag
Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag Aktueller Begriff Vierzig Jahre Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen Ende der sechziger Jahre wurde in Wissenschaft und Öffentlichkeit zunehmend über Wissens- und Verständnisdefizite in den Debatten über Parlamentarismus in der Bundesrepublik Deutsch- land geklagt. Auch wenn die parlamentarische Demokratie bereits zwei Jahrzehnte erfolgreich praktiziert worden war, mangelte es der wissenschaftlichen und öffentlichen Parlamentarismus- diskussion nach Ansicht zahlreicher Beobachter nicht nur an fundierten Kenntnissen über die parlamentarischen Gegebenheiten, sondern auch an einem schnellen und leichten Zugriff auf Daten und Informationen über aktuelle Entwicklungen des Parlamentarismus. Dies hatte in den Augen der Kritiker die sachbezogene Beobachtung, Kritik und Mitwirkung – also essentielle Grundbedingungen jeder parlamentarischen Demokratie – in der Bundesrepublik beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund fanden sich Wissenschaftler, Parlamentarier, Journalisten und Mitarbei- ter der Bundestagsverwaltung zur Gründung einer Vereinigung zusammen, die durch die Bereit- stellung zuverlässiger parlamentsbezogener Informationen, Daten und Analysen die wissen- schaftliche und öffentliche Diskussion über Funktionsweise, Reformbedarf und Reformmöglich- keiten des parlamentarischen Systems befördern sollte. Am 21. Januar 1970 wurde sie in Bonn als Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen (DVParl) gegründet. In Konzeption und Ausrichtung orientierten sich die Gründerväter an der englischen Hansard -

Bd. 5: Deutsch- 29 Hs
willy brandt Berliner Ausgabe willy brandt Berliner Ausgabe Herausgegeben von helga grebing, gregor schöllgen und heinrich august winkler Im Auftrag der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung band 1: Hitler ist nicht Deutschland. Jugend in Lübeck – Exil in Norwegen 1928 – 1940 band 2: Zwei Vaterländer. Deutsch-Norweger im schwedischen Exil – Rückkehr nach Deutschland 1940 – 1947 band 3: Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947 – 1966 band 4: Auf dem Weg nach vorn. Willy Brandt und die SPD 1947 – 1972 band 5: Die Partei der Freiheit. Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 band 6: Ein Volk der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966 – 1974 band 7: Mehr Demokratie wagen. Innen- und Gesellschaftspolitik 1966 – 1974 band 8: Über Europa hinaus. Dritte Welt und Sozialistische Internationale band 9: Die Entspannung unzerstörbar machen. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1974 – 1982 band 10: Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1982 – 1992 willy brandt Berliner Ausgabe band 5 Die Partei der Freiheit Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 Bearbeitet von karsten rudolph Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung bedankt sich für die groß- zügige finanzielle Unterstützung der gesamten Berliner Ausgabe bei: Frau Ursula Katz, Northbrook, Illinois Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen Otto Wolff von Amerongen-Stiftung, Köln Stiftungsfonds Deutsche Bank im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., Essen Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg Bankgesellschaft Berlin AG Herlitz AG, Berlin Metro AG, Köln Schering AG, Berlin Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; dataillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. -

Tafeln (Page 1)
"Forgotten" History BERUFSVERBOTE Political Persecution in the Federal Republic of Germany 1. DEFINITION Berufsverbot? What is That? At the end of the 1960s, politicians, lawyers, police and secret Aim of Berufsverbot: Intimidation by Threat of Subsistence Deprivation services considered how to contain mass protests at universities and Political repression and political persecu- work places. The forms of repression practiced so far – surveillance, tion has happened and is still happening police raids, political trials and imprisonment – didn't seem to be in many areas of society. sufficient anymore. In particular, the state authorities were What was so special about the "Radikalen - concerned that a new generation with left-wing leanings could erlass"? Its aim was to abolish the mate- rial existence of the affected people in the permeate the governmental structures and change them from workplace. Those affected either could the inside. A working group commissioned in 1971 discussed not complete their education or could not possibilities to keep left-wing critics out of the civil service. practise their professions, because these The measures to be taken were meant to be intimidating and were monopolised by the state. Therefore, Berufsverbote have lifelong existential deterrent. On the basis of this, the Prime Ministers of the Länder consequences for those affected. under the chair of Chancellor Willy Brandt on January 28, 1972 passed what became known as the "Anti-radicals Decree*" (Radikalenerlass). The "Radikalenerlass" Violated Essential Basic and Human Rights: Hurry up, gentlemen, 1. The principle of equality and here is another radical who wants the non-dis crimination rule to get into the civil service. -

Deutscher Bundestag — 12
Plenarprotokoll 12/76 Deutscher Stenographischer Bericht 76. Sitzung Bonn, Donnerstag, den 13. Februar 1992 Inhalt: Begrüßung des Vorsitzenden des Obersten (Steueränderungsgesetz 1992) (Drucksa- Rates der Republik Litauen und seiner Dele- chen 12/1108, 12/1368, 12/1466, 12 /1506, gation 6273 A 12/1691, 12/2044) b) Beratung der Beschlußempfehlung des Glückwünsche zu den Geburtstagen der Ausschusses nach Artikel 77 des Grund- Abgeordneten Erika Reinhardt und Dr. gesetzes (Vermittlungsausschuß) zu dem Horst Ehmke 6273B Gesetz zur Aufhebung des Struktur- hilfegesetzes und zur Aufstockung des Namensänderung eines Ausschusses . 6273 B Fonds „Deutsche Einheit" (Drucksachen 12/1227, 12/1374, 12/1494, 12/1692, Nachträgliche Überweisung des 13. Subven- 12/2045) tionsberichts der Bundesregierung an den Hans H. Gattermann FDP . 6274 C Ausschuß für Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung 6273 B Dr. Wolfgang Schäuble CDU/CSU . 6276A Dr. Peter Struck SPD 6278B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- nung 6273C Dr. Hermann Otto Solms FDP . 6280 C Dr. Barbara Höll PDS/Linke Liste . 6282 A Tagesordnungspunkt 3: Nachwahl eines Mitglieds der Parlamen- Werner Schulz (Berlin) Bündnis 90/GRÜNE 6282 D tarischen Kontrollkommission: Wahlvor- Gerhard Schröder, Ministerpräsident des schlag der Fraktion der CDU/CSU Landes Niedersachsen 6283 C (Drucksache 12/2034) 6273 D Dr. Theodor Waigel, Bundesminister BMF 6285 C Ergebnis der Wahl . 6287 D Namentliche Abstimmung 6287 D Zusatztagesordnungspunkt 2: Beratung des Antrags der Fraktion der Ergebnis -

Resume Moses July 2020
A. Dirk Moses Department of History University of North Carolina 554A Hamilton Hall 102 Emerson Dr., CB #3195 Chapel Hill, NC 27599-3195 Email: [email protected] Web: www.dirkmoses.com ACADEMIC APPOINTMENTS Frank Porter Graham Distinguished Professor of Global Human Rights History, University of North Carolina, July 2020 Lecturer (later Professor of Modern History), University of Sydney, 2000-2010, 2016-2020 Professor of Global and Colonial History, European University Institute, Florence, 2011–2015. Research Fellow, Department of History, University of Freiburg, 1999–2000. EDUCATION Ph.D. Modern European History, University of California, Berkeley, USA, 1994–2000. M.A. Modern European History, University of Notre Dame, Indiana, USA, 1992–1994. M.Phil. Early Modern European History, University of St. Andrews, Scotland, 1988–1989. B.A. History, Government, and Law, University of Queensland, Brisbane, Australia, 1985–1987. FELLOWSHIPS, PRIZES, VISITING PROFESSORSHIPS Ina Levine Invitational Senior Scholar, Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, Washington, DC, 2019-2020. Declined. Senior Fellow, Lichtenberg Kolleg, University of Göttingen, October 2019 – February 2020. University of Sydney-WZB Berlin Social Science Center Exchange Program, September-October 2019. Visiting Professorship, Department of History, University of Pennsylvania, January-June 2019. Visiting Fellow, Institut für die Wissenschaften vom Menschen/Institute for Human Sciences, Vienna, November 2017-February 2018. Declined. Visiting Professor, Haifa Center for German and European Studies, University of Haifa, May 2013. Membership, Institute for Advanced Studies, Princeton, January–April 2011. Declined. Australian Scholar Fellowship, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC, October-December 2010. Visiting Senior Fellow, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies, August-September 2010. Visiting Scholar, Center for the Study of Human Rights, Columbia University, September- November 2009. -
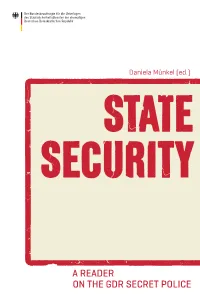
Bstu / State Security. a Reader on the GDR
Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Imprint Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former German Democratic Republic Department of Education and Research 10106 Berlin [email protected] Photo editing: Heike Brusendorf, Roger Engelmann, Bernd Florath, Daniela Münkel, Christin Schwarz Layout: Pralle Sonne Originally published under title: Daniela Münkel (Hg.): Staatssicherheit. Ein Lesebuch zur DDR-Geheimpolizei. Berlin 2015 Translation: Miriamne Fields, Berlin A READER The opinions expressed in this publication reflect solely the views of the authors. Print and media use are permitted ON THE GDR SECRET POLICE only when the author and source are named and copyright law is respected. token fee: 5 euro 2nd edition, Berlin 2018 ISBN 978-3-946572-43-5 6 STATE SECURITY. A READER ON THE GDR SECRET POLICE CONTENTS 7 Contents 8 Roland Jahn 104 Arno Polzin Preface Postal Inspection, Telephone Surveillance and Signal Intelligence 10 Helge Heidemeyer The Ministry for State Security and its Relationship 113 Roger Engelmann to the SED The State Security and Criminal Justice 20 Daniela Münkel 122 Tobias Wunschik The Ministers for State Security Prisons in the GDR 29 Jens Gieseke 130 Daniela Münkel What did it Mean to be a Chekist? The State Security and the Border 40 Bernd Florath 139 Georg Herbstritt, Elke Stadelmann-Wenz The Unofficial Collaborators Work in the West 52 Christian Halbrock 152 Roger Engelmann