Die Kunst Des Vernetzens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Landeszentrale Für Politische Bildung Baden-Württemberg, Director: Lothar Frick 6Th Fully Revised Edition, Stuttgart 2008
BADEN-WÜRTTEMBERG A Portrait of the German Southwest 6th fully revised edition 2008 Publishing details Reinhold Weber and Iris Häuser (editors): Baden-Württemberg – A Portrait of the German Southwest, published by the Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Director: Lothar Frick 6th fully revised edition, Stuttgart 2008. Stafflenbergstraße 38 Co-authors: 70184 Stuttgart Hans-Georg Wehling www.lpb-bw.de Dorothea Urban Please send orders to: Konrad Pflug Fax: +49 (0)711 / 164099-77 Oliver Turecek [email protected] Editorial deadline: 1 July, 2008 Design: Studio für Mediendesign, Rottenburg am Neckar, Many thanks to: www.8421medien.de Printed by: PFITZER Druck und Medien e. K., Renningen, www.pfitzer.de Landesvermessungsamt Title photo: Manfred Grohe, Kirchentellinsfurt Baden-Württemberg Translation: proverb oHG, Stuttgart, www.proverb.de EDITORIAL Baden-Württemberg is an international state – The publication is intended for a broad pub- in many respects: it has mutual political, lic: schoolchildren, trainees and students, em- economic and cultural ties to various regions ployed persons, people involved in society and around the world. Millions of guests visit our politics, visitors and guests to our state – in state every year – schoolchildren, students, short, for anyone interested in Baden-Würt- businessmen, scientists, journalists and numer- temberg looking for concise, reliable informa- ous tourists. A key job of the State Agency for tion on the southwest of Germany. Civic Education (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, LpB) is to inform Our thanks go out to everyone who has made people about the history of as well as the poli- a special contribution to ensuring that this tics and society in Baden-Württemberg. -

Dr. Johann Wadephul Eröffnet Ausstellung Zum 80. Geburtstag Von Dr
23.09.2008 | Nr. 325/08 Johann Wadephul: Dr. Johann Wadephul eröffnet Ausstellung zum 80. Geburtstag von Dr. Gerhard Stoltenberg Sperrfrist 19:00 Uhr Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Dr. Johann Wadephul, hat heute (23. September) den ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Dr. Gerhard Stoltenberg als „bleibendes Vorbild für die heutige Politikergeneration der CDU“ bezeichnet. Anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung zum 80. Geburtstag von Dr. Gerhard Stoltenberg in den Räumen der CDU-Fraktion im Kieler Landtag würdigte Wadephul die Leistungen Stoltenbergs in Bund und Land: „Gerhard Stoltenberg war ein ganz Großer. Ein Leuchtturm in der deutschen Politik. Groß war er nicht nur äußerlich durch Gestalt und Haltung, sondern als Autorität, die getragen war von umfassender Bildung, fachlicher Kompetenz und unbestrittener moralischer Integrität“, so Wadephul. Zur Eröffnung der gemeinsamen Ausstellung der CDU-Landtagsfraktion und der Hermann Ehlers Stiftung kamen über 100 Gäste, darunter die Tochter Gerhard Stoltenbergs, Susanne Stoltenberg. Die Ausstellung ist dem politischen Wirken des ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, Bundesminister und CDU- Landesvorsitzenden, gewidmet, der am 29. September dieses Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Stoltenberg verstarb am 23 November 2001 in Kiel. Fraktionschef Wadephul erinnerte daran, dass Stoltenberg bereits mit 26 Jahren in den Schleswig-Holsteinischen Landtag einzog. Besonders geprägt habe er Schleswig- Holstein in seiner Zeit als Ministerpräsident von 1971 bis 1982. Sein überwältigender Wahlsieg mit 51,7 Prozent bei der Landtagswahl 1971 habe einen Wiederaufstieg für die gesamte Bundes-CDU bedeutet. Insgesamt drei Mal hätten die Bürger zu Zeiten Stoltenbergs die CDU mit absoluter Mehrheit gewählt. Wadephul: „Sozusagen wählten die Bürger seines Landes Gerhard Stoltenberg dreimal mit absoluter Mehrheit zum Ministerpräsidenten.“ Stoltenberg habe wegen seines überragenden Sachverstandes über die Parteigrenzen hinweg Anerkennung gefunden. -

Bulletin of the GHI Washington Supplement 1 (2004)
Bulletin of the GHI Washington Supplement 1 (2004) Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. “WASHINGTON AS A PLACE FOR THE GERMAN CAMPAIGN”: THE U.S. GOVERNMENT AND THE CDU/CSU OPPOSITION, 1969–1972 Bernd Schaefer I. In October 1969, Bonn’s Christian Democrat-led “grand coalition” was replaced by an alliance of Social Democrats (SPD) and Free Democrats (FDP) led by Chancellor Willy Brandt that held a sixteen-seat majority in the West German parliament. Not only were the leaders of the CDU caught by surprise, but so, too, were many in the U.S. government. Presi- dent Richard Nixon had to take back the premature message of congratu- lations extended to Chancellor Kiesinger early on election night. “The worst tragedy,” Henry Kissinger concluded on June 16, 1971, in a con- versation with Nixon, “is that election in ’69. If this National Party, that extreme right wing party, had got three-tenths of one percent more, the Christian Democrats would be in office now.”1 American administrations and their embassy in Bonn had cultivated a close relationship with the leaders of the governing CDU/CSU for many years. -

Verzeichnis Der Abkürzungen
Verzeichnis der Abkürzungen APuZ Aus Politik und Zeitgeschichte BCSV Badisch-Christlich-Soziale Volkspartei BHE Block (Bund) der Heimatvertriebenen und Entrechteten BP Bayernpartei BVerfG Bundesverfassungsgericht BVP Bayrische Volkspartei CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands csu Christlich Soziale Union CVP Christliche Volkspartei DP Deutsche Partei DKP Deutsche Kommunistische Partei DNVP Deutschnationale Volkspartei DRP Deutsche Reichspartei DVP Deutsche Volkspartei DZP Deutsche Zentrumspartei EG Europäische Gemeinschaft EU Europäische Union EURATOM Europäische Atomgemeinschaft EVG Europäische Verteidigungsgemeinschaft FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung FDP Freie Demokratische Partei FR Frankfurter Rundschau GG Grundgesetz INFAS Institut ftir angewandte Sozialwissenschaft JÖR Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart KPD Kommunistische Partei Deutschlands LDPD Liberaldemokratische Partei Deutschlands MP Ministerpräsident MPen Ministerpräsidenten 395 NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands NZZ Neue Züricher Zeitung ÖVP Österreichische Volkspartei POS Partei des Demokratischen Sozialismus PVS Politische Vierteljahreszeitschrift RNZ Rhein-Neckar-Zeitung SBZ Sowjetische Besatzungszone SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs ssw Südschleswigscher Wählerverband sz Süddeutsche Zeitung Zentrum Deutsche Zentrumspartei ZParl Zeitschrift flir Parlamentsfragen 396 Tabellenverzeichnis Tabelle I: Einstellungen zur Auflösung von Landtagen -

Local Expellee Monuments and the Contestation of German Postwar Memory
To Our Dead: Local Expellee Monuments and the Contestation of German Postwar Memory by Jeffrey P. Luppes A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Germanic Languages and Literatures) in The University of Michigan 2010 Doctoral Committee: Professor Andrei S. Markovits, Chair Professor Geoff Eley Associate Professor Julia C. Hell Associate Professor Johannes von Moltke © Jeffrey P. Luppes 2010 To My Parents ii ACKNOWLEDGMENTS Writing a dissertation is a long, arduous, and often lonely exercise. Fortunately, I have had unbelievable support from many people. First and foremost, I would like to thank my advisor and dissertation committee chair, Andrei S. Markovits. Andy has played the largest role in my development as a scholar. In fact, his seminal works on German politics, German history, collective memory, anti-Americanism, and sports influenced me intellectually even before I arrived in Ann Arbor. The opportunity to learn from and work with him was the main reason I wanted to attend the University of Michigan. The decision to come here has paid off immeasurably. Andy has always pushed me to do my best and has been a huge inspiration—both professionally and personally—from the start. His motivational skills and dedication to his students are unmatched. Twice, he gave me the opportunity to assist in the teaching of his very popular undergraduate course on sports and society. He was also always quick to provide recommendation letters and signatures for my many fellowship applications. Most importantly, Andy helped me rethink, re-work, and revise this dissertation at a crucial point. -

1 Introduction
Notes 1 Introduction 1. What belongs together will now grow together (JK). 2. The well-known statement from Brandt is often wrongly attributed to the speech he gave one day after the fall of the Berlin Wall at the West Berlin City Hall, Rathaus Schöneberg. This error is understandable since it was added later to the publicized version of the speech with the consent of Brandt himself (Rother, 2001, p. 43). By that time it was already a well known phrase since it featured prominently on a SPD poster with a picture of Brandt in front of the partying masses at the Berlin Wall. The original statement was made by Brandt during a radio interview on 10 November for SFP-Mittagecho where he stated: ‘Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört’ (‘Now we are in a situation in which again will grow together what belongs together’). 3. The Treaty of Prague with Czechoslovakia, signed 11 December 1973, finalized the Eastern Treaties. 4. By doing this, I aim to contribute to both theory formation concerning inter- national politics and foreign policy and add to the historiography of the German question and reunification policy. Not only is it important to com- pare theoretical assumptions against empirical data, by making the theoretical assumptions that guide the historical research explicit, other scholars are enabled to better judge the quality of the research. In the words of King et al. (1994, p. 8): ‘If the method and logic of a researcher’s observations and infer- ences are left implicit, the scholarly community has no way of judging the validity of what was done.’ This does not mean that the historical research itself only serves theory formation. -
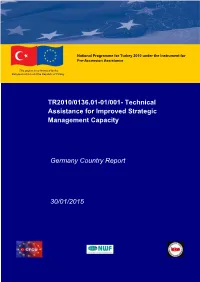
TR2010/0136.01-01/001- Technical Assistance for Improved Strategic
National Programme for Turkey 2010 under the Instrument for Pre-Accession Assistance This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey TR2010/0136.01-01/001- Technical Assistance for Improved Strategic Management Capacity Germany Country Report 30/01/2015 1 Table of Contents Page 1. General Information 4 1.1. Sources and Aims 4 1.2. Structural Aspects of the German State 4 1.3. Area and Population 7 1.4. GDP and Financial and Budgetary Situation 10 1.5. Main Economic and Commercial Characteristics 12 2. Government and Public Administration of the Federal Level 15 2.1. Federal Constitutional Structure (head of state, head of government, parliament, judiciary) 15 2.2. Central Bodies (chancellor, ministers) 16 2.3. Public Administration 17 2.3.1. Public Administration: employees 17 2.3.2. Public Administration: assessment and training 19 2.4. Reforms to the Structure of Government (past, in progress, planned) 22 3. Four Examples of Länder/Federal States (according to size, history, economic structure and geographic direction) 26 3.1. Baden-Württemberg - General Structure 28 3.1.1. Government and Public Administration 28 3.1.2. Reforms 30 3.2. Brandenburg - General Structure 32 3.2.1. Government and Public Administration 32 3.2.2. Reforms 33 3.3. Lower Saxony - General Structure 34 3.3.1. Government and Public Administration 35 3.3.2. Reforms 36 3.4. Saarland - General Structure 38 3.4.1. Government and Public Administration 38 3.4.2. Reforms 39 4. Strategic Planning and Public Budgeting 41 4.1. -

Bd. 5: Deutsch- 29 Hs
willy brandt Berliner Ausgabe willy brandt Berliner Ausgabe Herausgegeben von helga grebing, gregor schöllgen und heinrich august winkler Im Auftrag der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung band 1: Hitler ist nicht Deutschland. Jugend in Lübeck – Exil in Norwegen 1928 – 1940 band 2: Zwei Vaterländer. Deutsch-Norweger im schwedischen Exil – Rückkehr nach Deutschland 1940 – 1947 band 3: Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947 – 1966 band 4: Auf dem Weg nach vorn. Willy Brandt und die SPD 1947 – 1972 band 5: Die Partei der Freiheit. Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 band 6: Ein Volk der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966 – 1974 band 7: Mehr Demokratie wagen. Innen- und Gesellschaftspolitik 1966 – 1974 band 8: Über Europa hinaus. Dritte Welt und Sozialistische Internationale band 9: Die Entspannung unzerstörbar machen. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1974 – 1982 band 10: Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1982 – 1992 willy brandt Berliner Ausgabe band 5 Die Partei der Freiheit Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 Bearbeitet von karsten rudolph Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung bedankt sich für die groß- zügige finanzielle Unterstützung der gesamten Berliner Ausgabe bei: Frau Ursula Katz, Northbrook, Illinois Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen Otto Wolff von Amerongen-Stiftung, Köln Stiftungsfonds Deutsche Bank im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., Essen Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg Bankgesellschaft Berlin AG Herlitz AG, Berlin Metro AG, Köln Schering AG, Berlin Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; dataillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. -

Journalists and Religious Activists in Polish-German Relations
THE PROJECT OF RECONCILIATION: JOURNALISTS AND RELIGIOUS ACTIVISTS IN POLISH-GERMAN RELATIONS, 1956-1972 Annika Frieberg A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2008 Approved by: Dr. Konrad H. Jarausch Dr. Christopher Browning Dr. Chad Bryant Dr. Karen Hagemann Dr. Madeline Levine View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository ©2008 Annika Frieberg ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT ANNIKA FRIEBERG: The Project of Reconciliation: Journalists and Religious Activists in Polish-German Relations, 1956-1972 (under the direction of Konrad Jarausch) My dissertation, “The Project of Reconciliation,” analyzes the impact of a transnational network of journalists, intellectuals, and publishers on the postwar process of reconciliation between Germans and Poles. In their foreign relations work, these non-state actors preceded the Polish-West German political relations that were established in 1970. The dissertation has a twofold focus on private contacts between these activists, and on public discourse through radio, television and print media, primarily its effects on political and social change between the peoples. My sources include the activists’ private correspondences, interviews, and memoirs as well as radio and television manuscripts, articles and business correspondences. Earlier research on Polish-German relations is generally situated firmly in a nation-state framework in which the West German, East German or Polish context takes precedent. My work utilizes international relations theory and comparative reconciliation research to explore the long-term and short-term consequences of the discourse and the concrete measures which were taken during the 1960s to end official deadlock and nationalist antagonisms and to overcome the destructive memories of the Second World War dividing Poles and Germans. -

Villa Reitzenstein
Villa Reitzenstein Herzlich willkommen in der Villa Reitzenstein Das prächtige Gebäude in Stuttgarter Halbhöhenlage ist Amtssitz des Ministerpräsidenten und zugleich Sitz der Landesregierung und des Staatsministeriums von Baden-Württemberg. Wir laden Sie herzlich ein zu einem virtuellen Rundgang durch dieses Haus, das von der Baronin Helene von Reitzenstein zu Beginn des vorigen Jahrhunderts errichtet wurde und von einem herrlichen Park umgeben ist. Werfen Sie einen Blick in das Innere der Villa und erfahren Sie mehr über den Ort, von dem aus Baden-Württemberg regiert wird. Virtueller Rundgang durch die Villa Reitzenstein www.villa-reitzenstein.de © Staatsministerium Baden-Württemberg Villa Reitzenstein Innenansichten Eingangshalle Durch ein schweres messingbeschlagenes Portal betritt der Besucher die großzügige Eingangshalle der Villa Reitzenstein. Von hier aus erreicht man die Empfangs- und Repräsentationsräume des baden-württembergischen Regierungssitzes. Markant ist das kunstvolle Fußbodenmosaik aus italienischem Marmor. Ein großformatiges Gemälde erinnert an die Erbauerin der Villa, Baronin Helene von Reitzenstein, ein weiteres an ihren Ehemann, Baron Carl von Reitzenstein. In das gusseiserne Geländer entlang der ins Obergeschoss führenden Treppe ist ein Monogramm mit ihren Initialen „HR“ eingearbeitet. Schon die Eingangshalle vermittelt einen Eindruck von der Eleganz der schlossartigen Villa. Im Seitenflur hängen die gemalten Porträts der ehemaligen Ministerpräsidenten Reinhold Maier (1952 - 1953), Hans Filbinger (1966 - 1978), Lothar Späth (1978 - 1991) und Erwin Teufel (1991 - 2005). Virtueller Rundgang durch die Villa Reitzenstein www.villa-reitzenstein.de © Staatsministerium Baden-Württemberg Villa Reitzenstein Runder Saal Im Runden Saal empfängt der baden-württembergische Ministerpräsident Gäste aus nah und fern. Zahlreiche Staatsoberhäupter und königliche Hoheiten standen schon unter dem Kronleuchter der früheren Hausherrin, Baronin von Reitzenstein, und trugen sich in das Gästebuch des Landes ein. -

Deutscher Bundestag — 12
Plenarprotokoll 12/76 Deutscher Stenographischer Bericht 76. Sitzung Bonn, Donnerstag, den 13. Februar 1992 Inhalt: Begrüßung des Vorsitzenden des Obersten (Steueränderungsgesetz 1992) (Drucksa- Rates der Republik Litauen und seiner Dele- chen 12/1108, 12/1368, 12/1466, 12 /1506, gation 6273 A 12/1691, 12/2044) b) Beratung der Beschlußempfehlung des Glückwünsche zu den Geburtstagen der Ausschusses nach Artikel 77 des Grund- Abgeordneten Erika Reinhardt und Dr. gesetzes (Vermittlungsausschuß) zu dem Horst Ehmke 6273B Gesetz zur Aufhebung des Struktur- hilfegesetzes und zur Aufstockung des Namensänderung eines Ausschusses . 6273 B Fonds „Deutsche Einheit" (Drucksachen 12/1227, 12/1374, 12/1494, 12/1692, Nachträgliche Überweisung des 13. Subven- 12/2045) tionsberichts der Bundesregierung an den Hans H. Gattermann FDP . 6274 C Ausschuß für Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung 6273 B Dr. Wolfgang Schäuble CDU/CSU . 6276A Dr. Peter Struck SPD 6278B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- nung 6273C Dr. Hermann Otto Solms FDP . 6280 C Dr. Barbara Höll PDS/Linke Liste . 6282 A Tagesordnungspunkt 3: Nachwahl eines Mitglieds der Parlamen- Werner Schulz (Berlin) Bündnis 90/GRÜNE 6282 D tarischen Kontrollkommission: Wahlvor- Gerhard Schröder, Ministerpräsident des schlag der Fraktion der CDU/CSU Landes Niedersachsen 6283 C (Drucksache 12/2034) 6273 D Dr. Theodor Waigel, Bundesminister BMF 6285 C Ergebnis der Wahl . 6287 D Namentliche Abstimmung 6287 D Zusatztagesordnungspunkt 2: Beratung des Antrags der Fraktion der Ergebnis -

Inhaltsverzeichnis Das Bundesministerium Der Justiz Und Die Justizgesetzgebung 1949 -1989 Von Jan Schröder
Inhaltsverzeichnis Das Bundesministerium der Justiz und die Justizgesetzgebung 1949 -1989 von Jan Schröder I. Zur Vorgeschichte des Bundesministeriums der Justiz 9 II. Die Errichtung des Bundesministeriums der Justiz 1949-1953: Zuständigkeiten, Organisation, Unterbringung 11 1. Zuständigkeit 11 2. Innere Gliederung 12 III. Die Aufbaujahre 1949-1953 14 1. Wiederherstellung eines einheitlichen rechtsstaatlichen Gerichtsverfassungs- und Verfahrensrechts 14 2. Bereinigung des Strafrechts und erste Reformen 16 3. Rechtsbereinigung im Zivilrecht. Geschäftsraummieten- und Wohnungseigentumsgesetz 18 4. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Dehlers Kritik am Bundesverfassungsgericht 20 IV. 1953-1957 22 1. Das Gleichberechtigungsgesetz 1957 23 2. Das Kartellgesetz 24 3. Einleitung der großen Strafrechts- und Justizreform. Das Rechtspflegergesetz 1957 25 V. 1957-1961 27 1. Die Mietrechtsreform 1960 28 2. Der Abschluß der Gesetzgebung über die Rechtspflegeor gane 29 VI. 1961-1966 31 1. Die Vollendung der Reform des Wohnraummietrechts Die Strafprozeßnovelle 1964 31 2. Der Streit um die Verjährung von NS-Verbrechen. Buchers Rücktritt 33 3. Das Aktiengesetz und das Urhebergesetz 34 4. Das letzte Jahr der Regierung Erhard. Zur rechtspolitischen Bilanz der ersten siebzehn Jahre der Bundesrepublik Deutschland 38 VII. Die große Koalition 1966-1969 40 1. Die Strafrechtsreform 1969 41 2. Weitere strafrechtliche Reformen: Staatsschutz-Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht. Die dritte Verjährungsdebatte . 43 3. Das Nichtehelichengesetz 1969 45 VIII. Die ersten Jahre der sozialliberalen Koalition 1969-1972 48 IX. 1972-1976 52 1. Strafrecht: Die Neuregelung der Sexualdelikte und des Abtreibungsparagraphen. Das Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. Bekämpfung des Terrorismus 52 2. Strafprozeßrecht: Das erste Reformgesetz und die Terro- rismus-Gesetzgebung 56 3. Das Strafvollzugsgesetz 1976 57 4. Die Reform des Ehescheidungsrechts. Weitere familien- und personenrechtliche Neuerungen: Herabsetzung des Volljährigkeitsalters, neues Adoptionsrecht 58 5.