Sorben Im Fernsehen. Inaugural-Dissertation Zur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Das MIZ-Babelsberg, Vernetzt Mit Vielen Partnern, Einen Herausragenden Beitrag.‹
Das Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) ist eine Institution der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb). Die mabb ist eine unabhängige Anstalt des öffentlichen Rechts, finanziert durch Rundfunkbeiträge. RETHINKING Broadcasting JAHRESBERICHT 2013-2015 ›Sandra Weiß und das Team des MIZ-Babelsberg haben alle Zweifel verstummen lassen, ob Berlin-Brandenburg eine solche Einrichtung und ein solches Gebäude braucht. Der Public Service des Rundfunks, dem die mabb dient, kann in der digitalen Zukunft nur bestehen, wenn er neu definiert wird. Dazu leistet das MIZ-Babelsberg, vernetzt mit vielen Partnern, einen herausragenden Beitrag.‹ DR. HANS HEGE Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) Inhalt 8 DAS MIZ-BABELSBERG 10 RETHINKING BROADCASTING 12 VERANSTALTUNGEN 14 DER BEIRAT 20 DAS GEBÄUDE 26 RÄUME & NUTZUNG 28 FÖRDERUNG 30 PROGRAMME DER INNOVATIONSFÖRDERUNG 30 Innovationsförderung für Medienprofis, Studierende & Start-ups 31 Innovationsförderung mit Projektpartner für JournalistInnen & interdisziplinäre Teams 32 PROJEKTE DER INNOVATIONSFÖRDERUNG 34 Preise & Auszeichnungen 36 Yallah Deutschland 37 VR-A100 38 SCAPE 39 4531km.eu 40 Interactive Cloud Director 41 Radiorollenspiel 42 atterwasch. Eine Scroll-Doku 43 Thopia App Generator 44 Timetraveler 45 CATCH 46 RentsWatch 47 Holodeck Now! 48 Shelfd 49 Luminoise 50 wEYE 51 refer 52 LOKKR 53 Scope Player 54 ARD-Kurznachrichtenzentrale 55 dbate 56 Lobbyradar 57 CrowdStory 58 Klick. Klick. Star! 60 BILDUNG 64 DAS CROSSMEDIALE STUFENPROGRAMM 67 COACHINGS FÜR FÖRDERPROJEKTE 68 RUBIES IN -

Vind Een Veilige Plek Voor
20 Dagblad De Pers Media Edu-games Spel komt met mazzel in 2009 op de markt Vind een veilige plek voor Wat gebeurt er als twee sterren- stelsels botsen? Dat is het best uit te leggen met een spannende compu- tergame. Mischa de Bruijn ...AMSTERDAM Red de mensheid! Haal alles en ie- dereen weg uit dit deel van de Melk- Johan Cruijff bij Levante. HANS HEUS / HOLLANDSE HOOGTE weg en loods de evacuatievloot door asteroïdegordels, langs exploderende supernova’s, probeer gebruik te ma- Voetbal ken van de slingerkracht van sterren en planeten. En leer tegelijk een hele- boel over het heelal. Heb je iets inge- wikkelds uit te leggen aan een groot Het vorige Cruijff-effect publiek, dan kun je dat het beste doen in een computerspel. Want als de game leuk genoeg is, dan vind je in ‘Andere Tijden’ mensen geheel vrijwillig bereid om zich urenlang intensief met jouw ma- Mediaredactie len, maar nu achter de schermen? terie bezig te houden. Zie dat maar AMSTERDAM In Andere Tijden een reconstructie eens voor elkaar te krijgen met een ... van het Cruijff-effect in 1981. In dat lap tekst. Eigenlijk begint Andere Tijden pas in jaar speelt Cruijff bij het Spaanse Le- Onderzoekers aan de Universiteit mei met een samenwerkingsverband vante, de tweede club van Valencia. Utrecht ontwikkelen een game (zie met Studio Sport. Toen echter vorige ‘Maar hij draaide daar niet lekker’, www.collisiongame.nl) om mensen week bekend werd dat Johan Cruijf zegt toenmalig verdediger Peter Boe- te laten ervaren wat er gebeurt als orde op zaken zou komen stellen in ve. -

Fallstudien Zur Fernsehberichterstattung Über Den Rechtsextremismus in Deutschland 1998 - 2001
Fernsehberichterstattung Fernsehberichterstattung über den Rechtsextremismus 23 Hans-Jürgen Weiß, Cornelia Spallek Fallstudien zur Fernsehberichterstattung über den Rechtsextremismus in Deutschland 1998 - 2001 Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfR) Zollhof 2 40221 Düsseldorf Postfach 103443 40025 Düsseldorf Telefon 0211/77007-0 Telefax 0211/72 7170 E-Mail [email protected] Internet LfM-Dokumentation http://www.lfm-nrw.de Band 23 Hans-Jürgen Weiß, Cornelia Spallek Fallstudien zur Fernsehberichterstattung über den Rechtsextremismus in Deutschland 1998 - 2001 Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) Zollhof 2 40221 Düsseldorf Postfach 10 34 43 40025 Düsseldorf http://www.lfm-nrw.de Impressum Herausgeber: Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) Bereich Tagungen und Öffentlichkeitsarbeit Zollhof 2, 40221 Düsseldorf Verantwortlich: Dr. Joachim Gerth Redaktion: Antje vom Berg, Dagmar Rose Gestaltung: disegno visuelle kommunikation, Wuppertal Druck: Börje Halm, Wuppertal September 2002 Inhaltsverzeichnis 1. Problemstellung und Zielsetzung der Studie 7 2. Konzeption und Methode der Programmanalysen 13 2.1 Die Konzeption der Basisstudie 14 2.2 Die Methode der Vertiefungsanalyse 15 2.2.1 Die Stichprobe: Fernsehbeiträge zur Rechtsextremismus-Berichterstattung 16 2.2.2 Die Programmanalysen: Konzeption und Instrumente 19 2.3 Zum Aufbau des Untersuchungsberichts 20 3. Sieben Fallstudien zur Fernsehberichterstattung über den Rechtsextremismus in Deutschland 1998 - 2001 22 3.1 Programmstichprobe Frühjahr 1998 22 3.1.1 -

Mmm 8-9 2007
inhalt titelthema dpa studientrends kolumne / 8„Irgendetwas mit Medien“ 7Die üblichen Verdächtigen Von Susanne Stracke-Neumann Immer wieder verfassungs- Mettelsiefen 10 Überfüllte Säle widrige Ermittlungen Marcel to: Berliner FU-Studenten gegen Journalisten Fo organisieren selbst Praxisseminare aktuell rundfunk recht 11 Leipzig ohne Grundstudium Auch renommierte Studien- 5Gut zu wissen 17 Rücksichtsloses Profitkalkül 24 Das Ärgste konnte gänge kommen an Bologna Veranstaltungen Entlassungen bei Sat.1 auf dem verhindert werden nicht vorbei und Personalien Weg zum „Unterhaltungsdampfer“ Urheberrechtsreform: 12 Wetter-Volontär gesucht 21 NRW künftig 18 Fernsehen Zweiter Korb gepackt, Ob Journalistenschulen oder ohne taz-Ausgabe wann und wo man will den dritten beauftragt Volontariate: Stürmische Zeiten 21 Neues Jahrbuch des Streit um Digitaloffensive für Bewerber Deutschen Presserates von ARD /ZDF auf dem Medien- film 12 Ein Stück Handwerk 21 Bundesverband forum und zur IFA Ausbildung in der Bürgermedien geplant 20 Medienpolitik hinter 25 Stark belastet, journalistischen Königdisziplin verschlossenen Türen wenig abgesichert Reportage journalismus Flickwerk beim 10. Rundfunk- Arbeitsbedingungen von 13 Faire Praktika änderungsstaatsvertrag Filmschaffenden in den Medien 14 Journalistische Nachlese unter die Lupe genommen Journalistenverbände Der G8 Gipfel und die print 25 Tarifergebnis für die formulieren Richtlinien Verantwortung der Medien Kinobranche 15 Medien-Blackout 22 Gegen den Strom 26 Tatort Halberg porträt Bundstagsdebatte IHK Bremerhaven -

Religious Deep Structuresâ•Flunderstanding and Reaching
Godina: Religious Deep Structures—Understanding and Reaching Secular Peop 111 BOJAN GODINA Religious Deep Structures—Understanding and Reaching Secular People Interdisciplinary Scientific Basis of Religious Deep Structures Regarding the topics “Invisible Religion” (Luckmann 1967), “Implicit Religion” (Thomas 2001), “Religious Emotion” (Beile 1998), “Personality Independent Religious Emotions” (Godina 2003), or even the psychoso- matic significance of a “Positive Spontaneous Relationship with God” (Grossarth-Maticek 1999:110-113), research has been conducted in the past decades largely in the field of sociology, psychology, and even including the area of systemic epidemiology. A precise and interdisciplinary scien- tific presentation for the phenomenon of “religious deep structures” in the human being was provided in detail by me in 2007 at the faculty for Behavioral and Cultural Studies at Heidelberg University in Germany (Godina 2007:69-372) and thus the topic was introduced into scientific dis- cussion. It was shown through these interdisciplinary studies that the me- dia makers and marketing strategists successfully integrate elements of “invisible religion” into their products in order to address the subliminal human religious needs and desires and thus to increase product sales and media consumption. Within the framework of the Adventist Church as an institution in 2009, further scientific evidence for human religious deep structures were delivered in the evangelistic context by the IKU Institute at Friedensau Adventist University in Germany (Godina 2009: 61-172). In the following article, I will refrain from a detailed interdisciplinary scientific justification of the practice and instead will describe an applica- tion that is suitable for evangelistic practice. This article is a modified and advanced version of the evangelistic book Das Atelier (Godina 2009:69-103). -
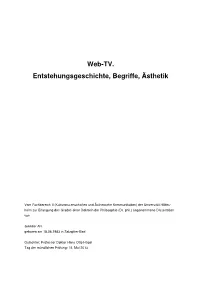
Dissertation Von J
Web-TV. Entstehungsgeschichte, Begriffe, Ästhetik Vom Fachbereich II (Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation) der Universität Hildes- heim zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) angenommene Dissertation von Jennifer Ahl geboren am 18.06.1983 in Salzgitter-Bad Gutachter: Professor Doktor Hans-Otto Hügel Tag der mündlichen Prüfung: 15. Mai 2013 Inhaltsverzeichnis 1 „Fernsehen war gestern?“ – Einführung .................................................................... 5 1.1 Eingrenzung des Themas .......................................................................................................... 7 1.2 Vorgehen und Zielsetzung ....................................................................................................... 11 1.2.1 Die ästhetische Perspektive ............................................................................................ 11 1.2.2 Struktur der Arbeit und Darstellung der Thesen .............................................................. 13 2 „How will we know ,television’ when we see it?“ – Kriterien zur Bestimmung von Fernsehartigkeit im World Wide Web .......................................................................16 2.1 Mediale Struktur ....................................................................................................................... 18 2.1.1 Programmfluss versus Hypertext..................................................................................... 18 2.1.2 Serialität als Strukturprinzip ............................................................................................ -

Zur Gewährleistung Des Funktionsauftrages Durch Den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk
Tenea/jurawelt 17 Brenner 22.11.2002 16:03 Uhr Seite 1 Zur Sicherung der Demokratie ist ein staatsfreier und vielfältiger Rundfunk erforderlich. Zur Sicherung von Vielfalt im Rundfunk ist in den Augen des Bundesverfassungsgerichts und sogar der Bd. 17 Europäischen Union ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht nur gerechtfertigt, sondern wird sogar gefordert. Damit nimmt der CHRISTIAN BRENNER Rundfunk eine Sonderstellung in der Rechtsordnung (Sondersitua- tion des Rundfunks) ein. Die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist es, Vielfalt im Rundfunk zu gewährleisten. Vielfalt kann es jedoch nicht zu jedem Preis geben; die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kön- nen in der dualen Rundfunkordnung nicht uneingeschränkt sein, Zur Gewährleistung des Funktionsauftrages durch vielmehr ist zwischen der größtmöglichen Programmvielfalt und den Interessen der Gebührenzahler sowie dem privaten Rundfunk den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. ein verhältnismäßiger Ausgleich zu erreichen. Das Bundesverfas- Eine Konkretisierung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen sungsgericht hat diese Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit den Begriffen »Grundversorgung« sowie »Funktionsauftrag« Rundfunks im Fernseh-, Hörfunk- und Online-Bereich belegt. Eine materiell-rechtliche Konkretisierung der Grundversor- / gung bzw. Funktionsauftrag ist bislang noch nicht erfolgt. Juristische Reihe TENEA/ Bd. 17 Ausgehend vom Grundgesetz, der Rechtsprechung des Bundesver- ENEA fassungsgerichts und der gegenwärtigen Situation im Rundfunk, soll T durch -

2008 Creative Industries in Berlin
Development and Potential ndustries in Berlin 2008 I Creative 2008 CREATIVE INDUSTRIES IN BERLIN Development and Potential European Union Co-financed by the European Regional Development Fund 2008 CREATIVE INDUSTRIES IN BERLIN Development and Potential Content Preface 1 Introduction 4 1.1 Terms and terminology policy 4 1.2 Creative industries and cultural policies 6 1.3 The complexity of an enabling industry 9 1.4 Education and training in the creative professions 11 1.5 Internationality 14 1.6 Creative industries as a policy field since 2004 15 1.7 Creative industries as a challenge for public policy 20 2 Economic significance of the creative industries for Berlin 22 2.1 Overview 22 2.2 Print media and publishing 28 2.3 Software development/games/telecommunications services 34 2.4 Advertising 39 2.5 Film, television and radio 44 2.6 Art market 51 2.7 Music industry 57 2.8 Architecture 63 2.9 Design industry 67 2.10 Performing arts 73 2.11 Women in the creative industries 77 2.12 Creative Industries in the context of promoting culture 80 3 Income dynamics and forms of work in Berlin‘s cultural and creative professions 86 3.1 Introduction 86 3.2 Supporting data and approach 89 3.3 Results 92 4 Urban development and the cultural and creative Industries 102 4.1 Introduction to the spatial dimension 102 4.2 Basis of data and methods 104 4.3 Locating creative enterprises 107 4.4 Interpretation of business distribution throughout urban space 113 4.5 Creative industries accelerate urban transformation processes 127 5 The most spheres of activity -

Claus-Christian Carbon
Curriculum vitae Claus-Christian Carbon 16-Sep-21 1. Personal Data Name: Claus-Christian CARBON Date of Birth: 23 March 1971 Place of Birth: Schweinfurt, Federal Republic of Germany Profession: Full Professor (“Ordinarius”) Phone (office): +49 (951) 863 1860 E-mail: [email protected] Nationality: German Children: Three Academic education: Dipl.-Psych. (Psychology, eq. BSc & MSc), 1998 M.A. (Philosophy, eq. BA & MA), 1999 PhD (Psychology), 2003 Habilitation (Psychology), 2006 Professional education: International Beer Sommelier, 2020 Natural health professional, 2004 Paramedic, 1991 Main research topics: Perception, Aesthetics, Usability, Ergonomics, Human Factors, Dynamics of Affective and Cognitive Processing, Traffic psychology, Face Processing, Acceptance, Innovation, Cognitive maps, Scientometrics, Experience 2. Education 03/2006 Habilitation (PD/Dr. habil) in Psychology, University of Vienna; title of habilitation thesis: “On the processing and representation of complex visual objects”; exhaustive venia docendi for all scientific areas of Psychology 02/2003 Doctorate (PhD, Dr.phil.) in Psychology, Freie Universität Berlin, “magna cum laude”; title of thesis: “Face Processing: Early processing in the recognition of faces” Claus-Christian Carbon curriculum vitae - 2/39 - 10/1999-09/2000 Undergraduate student of economics (BWL), Fernuniversität Hagen 12/1999 Magister (MA) in Philosophy, University of Trier (1.2 – “very good”); title of thesis: “Connectionism: may connectionist systems develop form of consciousness?” 11/1998 -

10 Jahre Rbb: Chronik
Chronik 2002 18.12.2002 Der erste Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg konstituiert sich. Zuvor war am 1. Dezember 2002 der Rundfunkstaatsvertrag über die Zusammenführung vom Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und dem Sender Freies Berlin zum Rundfunk Berlin-Brandenburg in Kraft getreten. 2003 24.03.2003 Der Rundfunkrat wählt Dagmar Reim zur Intendantin des rbb. Zum ersten Mal steht in Deutschland eine Frau an der Spitze eines öffentlich-rechtlichen Senders. 01.05.2003 Dagmar Reim tritt ihr Amt an – die Geburtsstunde des rbb. Der Sender führt die öffentlich-rechtlichen Hörfunk- und Fernsehprogramme aus Berlin und Brandenburg fort. B1 und ORB-Fernsehen senden bis zum Start des rbb Fernsehen unter den neuen Namen RBB Berlin bzw. RBB Brandenburg. Der Rundfunkrat wählt am 5. Mai die ersten Direktoren des rbb: Hannelore Steer (Hörfunk), Gabriel Heim (Fernsehen), Nawid Goudarzi (Produktion und Betrieb) sowie Hagen Brandstäter (Verwaltung). 10.11.2003 Um 18.00 startet das neue Vorabendprogramm für Berliner und Brandenburger. Das Ländermagazin „rbb um 6“, „zibb – zuhause in berlin & brandenburg“ und (ab 13. November) das Kulturmagazin „Stilbruch“ geben dem Publikum einen Vorgeschmack auf das geplante gemeinsame Fernsehprogramm für die Region. 01.12.2003 Mit Kulturradio vom rbb geht die erste Programminnovation des Hörfunks auf Sendung. 2004 29.02.2004 Das rbb Fernsehen feiert mit zehn neuen Sendungen Premiere. Zugleich starten der rbbtext und der Internet-Auftritt rbb-online.de. 02.05.2004 An der Glienicker Brücke fällt der Startschuss für den ersten rbb-Lauf. Mehr als 3.000 Läufer und Walker gehen auf die Strecke. Auftakt für den jährlichen rbb- Lauf. 2005 01.09.2005 Zur IFA startet die digitale, europaweite Satellitenverbreitung aller Hörfunkprogramme des rbb. -

Download Heft 3-4/2017
Autorinnen und Autoren dieses Heftes Markus Behmer, Prof. Dr., geb. 1961, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft der Otto- Rundfunk und Geschichte Friedrich-Universität Bamberg, Promotion 1996 über den Journalisten Leopold Schwarzschild (Publizis- Nr. 3-4/2017 ● 43. Jahrgang tik der Weimarer Republik und des Exils). Forschungsschwerpunkte: Medien- und Kommunikationsge- schichte, aktuelle Medienentwicklungen, Journalismusforschung und Kulturkommunikation. E-Mail: [email protected] Jan Bönkost, geb. 1981, studierte Digitale Medien und Medienkultur an der Uni Bremen und promoviert an der Uni Münster zur Freien Radio Bewegung in der BRD zwischen 1975 und 1985. Er ist Stipendiat der Rosa Luxemburg Stiftung und arbeitet ehrenamtlich im Archiv der sozialen Bewegungen Bremen. E-Mail: [email protected] Geschichte des privaten Rundfunks in Bayern Michael Crone, Prof. Dr. phil., geb. 1948, studierte Publizistik, Geschichte und Soziologie in Münster und promovierte 1980 über die nationalsozialistische Rundfunkpolitik. 2001 bis 2011 war er Leiter der Interview mit Prof. Dr. Markus Behmer Abteilung Dokumentation und Archive beim Hessischen Rundfunk, 2011 – 2012 Vorstand des Deutschen Rundfunkarchivs in Frankfurt am Main und Potsdam. Seit 2010 ist er Honorarprofessor an der Hochschu- le Darmstadt, Informationswissenschaften. HEMA UNDFUNKHISTORISCHE ERINNERUNGEN E-Mail: [email protected] T : R Luisa Drews, M.A., geb. 1988, studierte deutsche Literatur und Romanistik mit Schwerpunkt Französisch Editorial an der Humboldt-Universität -
Zielvorgaben Des Rbb Zur Erfüllung Seiner Programmlichen Aufgaben
C M Y CM MY CY CMY K RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG ZIELVORGABEN DES RBB ZUR ERFÜLLUNG SEINER PROGRAMMLICHEN AUFGABEN CHRONIK 2003/2004 Broschur-Finale 28.04.2005 13:38 Uhr Seite 1 _ ZIELVORGABEN DES RBB ZUR ERFÜLLUNG SEINER PROGRAMMLICHEN AUFGABEN Nach § 4 Abs. 6 rbb-Staatsvertrag ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg verpflichtet, in Zielvorgaben zu konkreti- sieren, wie er seine programmlichen Aufgaben erfüllen wird. Die Zielvorgaben werden veröffentlicht und alle zwei Jahre fortgeschrieben. Nach jeweils zwei Jahren veröffentlicht die Intendantin bzw. der Intendant einen Bericht dar- über, wie die Zielvorgaben umgesetzt worden sind. Nachdem der Rundfunk Berlin-Brandenburg am 1. Mai 2003 die Gesamtrechtsnachfolge der beiden Vorgängeranstal- ten Sender Freies Berlin und Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg angetreten hat, legt er der Öffentlichkeit nunmehr erstmals seine programmlichen Zielvorgaben für die Zeit bis September 2006 vor. Sie stehen in engem Zusammenhang mit den zum 1. Oktober 2004 erstmals vorgelegten Leitlinien für die Programmgestaltung der ARD 2005/2006. Beide Publikationen gemeinsam bieten einen Überblick über die vielfältigen programmlichen Aktivitäten des Rund- funk Berlin-Brandenburg sowohl in seinen eigenen Angeboten wie auch im Rahmen der ARD-Gemeinschaftsprogramme. Zugleich möchte der rbb den Rundfunkteilnehmerinnen und –teilnehmern in Berlin und Brandenburg mit Hilfe dieses Berichts erläutern, welche programmlichen Perspektiven er in den nächsten beiden Jahren entwickeln, welche Akzente er setzen und in welchen Punkten er sein bisheriges Angebot noch weiter optimieren möchte. Der rbb-Rundfunkrat, der im Rundfunk Berlin-Brandenburg die Interessen der Allgemeinheit vertritt, die Einhaltung der Programmgrundsätze überwacht und die Intendantin bzw. den Intendanten in allgemeinen Programmangelegen- heiten berät, hat sich mit den Zielvorgaben (wie auch mit den Leitlinien für die Programmgestaltung der ARD) inten- siv befasst und ihnen in seiner Sitzung am 14.