Bemerkenswerte .Unde Im Südlichen Sachsen-Anhalt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Flora Der Stadt Halle (Saale) Jens Stolle Und Stefan Klotz
Flora der Stadt Jens Stolle Halle (Saale) Stefan Klotz hallesche umweltblätter ISSN 0949-8573 5. Sonderheft Meist in der zweiten Märzhälfte präsentiert sich der Stadtgottesacker mit einem blauen Teppich aus blühenden Blausternen (Scilla siberica). Diese schon seit langem als Zierpflanze gebräuchliche Art konnte auf dem seit dem 16. Jahrhundert existierenden Friedhof dank geeigneter Standortbe- dingungen (halbschattig, nährstoffreich) massenhaft verwildern. Die Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris) ist ein attraktiver Frühblüher, der auf den Porphyrhü- geln im Nordwesten des Stadtgebietes im Gegensatz zu anderen Gebieten Sachsen-Anhalts noch relativ stabile Vorkommen besitzt. Fotos: Jens Stolle Flora der Stadt Halle (Saale) Jens Stolle und Stefan Klotz hallesche umweltblätter 5. Sonderheft Abkürzungsverzeichnis Häufigkeit Ortsangaben s ���������� selten, 1-3 Vorkommen N ��������� Nord-.../ nördlich von... z ���������� zerstreut, 4-10 Vorkommen S ���������� Süd-.../ südlich von... v ���������� verbreitet, 11-30 Vorkommen W �������� West-.../ westlich von... g ���������� gewöhnlich, > 30 Vorkommen O ��������� Ost-.../ östlich von... Status im Gebiet k ���������� Verbreitungskarte vorhanden I ���������� indigen, einheimische Art I? ��������� fraglich ob indigen Rasterdaten in den Verbreitungskarten N U ����� Neophyt (Einwanderung nach 1500), • ��������� aktuelle Vorkommen einheimischer / unbeständige Vorkommen archäophytischer Arten (Ephemerophyt) ��������� aktuelle Vorkommen von Neophyten N U?.... Neophyt, fraglich ob unbeständig oder -
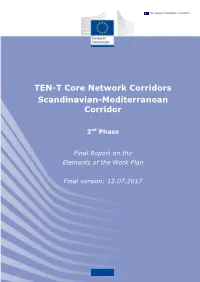
Final Report on Elements of Work Plan
Ref. Ares(2017)3520569 - 12/07/2017 TEN-T Core Network Corridors Scandinavian-Mediterranean Corridor 2nd Phase Final Report on the Elements of the Work Plan Final version: 12.07.2017 12 July 2017 1 Study on Scandinavian-Mediterranean TEN-T Core Network Corridor 2nd Phase (2015-2017) Final Report on the Elements of the Work Plan Information on the current version: The draft final version of the final report on the elements of the Work Plan was submitted to the EC by 22.05.2017 for comment and approval so that a final version could be prepared and submitted by 06.06.2017. That version has been improved with respect to spelling and homogeneity resulting in a version delivered on 30.06.2017. The present version of the report is the final final version submitted on 12.07.2017. Disclaimer The information and views set out in the present Report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the Commission. The Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this study. Neither the Commission nor any person acting on the Commission’s behalf may be held responsible for any potential use which may be made of the information contained herein. 12 July 2017 2 Study on Scandinavian-Mediterranean TEN-T Core Network Corridor 2nd Phase (2015-2017) Final Report on the Elements of the Work Plan Table of contents 1 Executive summary ............................................................................... 13 1.1 Characteristics and alignment of the ScanMed Corridor .............................. 13 1.2 Traffic demand and forecast .................................................................. -

¥ Kabelske-Tal 09-06/Ges
AMTSBLATT Gemeinde Kabelsketal Lange Straße 18, 06184 Kabelsketal 13. Jahrgang Freitag, den 3. März 2006 5/2006 Veranstaltungskalender Gemeinde Kabeisketal: - Traditionelles Osterfeuer der SG Dölbau 90 und der Frei- Ortschaft Dieskau willigen Feuerwehr am 15. April 2006 auf dem Sportplatz -Dieskauer Wochenmarkt samstags von 8.00 - 12.00 Uhr Kleinkugel (siehe Ortschaft Dölbau) auf dem Schlossplatz Dieskau - Führungen durch Schloss und Kirche mit dem Förderver- Halle, Saalkreis und Umgebung: ein Schloss Dieskau jeden Samstag und Sonntag, - 79. Komplexer Beratungstag für Existenzgründer und beste- 14.00 Uhr (Tel. 03 45/5 82 94 90 od. 03 45/6 83 06 83) hende Unternehmen am Dienstag, dem 14. März 2006, Ortschaft Dölbau 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Landratsamt Saalkreis (siehe - „Rudi-Schmidt-Pokal“ SG Dölbau 90 I gegen SSV 90 Landsberg I Mitteilungen Kabelsketal) am 13. April 2006, 18.00 Uhr auf dem Sportplatz Kleinkugel Das Veterinäramt Saalkreis informiert Verordnung zur Aufstallung des Geflügels zum Schutz vor der Klassischen Geflügelpest in Kraft getreten Mit Wirkung vom 17.02.2006 ist die Verordnung zur Aufstallung Diese Form der Unterbringung ist dem zuständigen Veterinäramt vom des Geflügels zum Schutz vor der Klassischen Geflügelpest in Geflügelhalter unverzüglich unter Angabe des Standortes und der Kraft getreten. getroffenen Vorkehrungen anzuzeigen. Zusätzlich hierzu muss der Hiernach müssen alle Halter von Geflügel (Hühner, Truthühner, Tierbestand mindestens einmal monatlich durch einen Tierarzt kli- Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder nisch untersucht werden, wobei der Tierarzt dieses zu dokumentie- Gänse) ihre Tiere, unabhängig von der gehaltenen Zahl, in ren hat. geschlossenen Ställen unterbringen. Weitere Ausnahmen in der Haltungsform sind beim zuständigen Diese Regelung gilt vorerst bis einschließlich des 30. -

Rungsprobleme Im Reide-Einzugsgebiet (Im Osten Von Halle/Saale)
ISSN 0018-0637 HercyniaN. F. 33 (2000): 19 1 - 218 191 Die natürlichen Verhältnisse, Kulturlandschaftswandel und Renaturie rungsprobleme im Reide-Einzugsgebiet (im Osten von Halle/Saale) Günter ZINKE 15 Abbildungen und 9 Tabell en ABSTRACT ZINKE, G.: The natural conditions, cultural-landscape-change and problems of renaturation in the catchment-area of the Reide -brook (in the east of Halle/S.).- Hercynia N.F. 33 (2000): 191-218. The present contribution devotes, on the basis of extensive maps, tables and photos to the natural - especially to the hydrographical and hydrological conditions and of the water-management of the Reide-brook. Most of all, the influence of agriculture and brown-coal-mining will be reflected. The historical and future Iandscape-change which is planned to reach renaturation and a biotop-system state, are shown in this following text. Keywords: natural and hydrological-hydrographical conditions, catchment-area of the Reide-brook, water management, influence of agriculture and brown-coal-mining, biotop-system state, renaturation 1 ZUR METHODIK UND ZUM STAND DER UNTERSUCHUNG DES REIDE EINZUGSGEBIETES Di e komplexe Erfassung von Gewässerökosystemen auf der Basis von Kleineinzugsgebieten, Fließge• wässern und stehenden Gewässern für den halleschen Raum ist seit Anfang der achtziger Jahre Anlie gen und Forschungsgegenstand der Arbeiten des Autors (ZINK E 1988). Insbesondere die methodisch anregenden Arbeiten von BAU ER et al. (1967), BAUER (1971 , 1985), MOLL EN HAUER (1980) und NIEMANN ( 1983) waren Vorbilder für die vom Autor entwickelten Aufnahmeformulare für Kleineinzugsgebiete und Fließgewässer (zwischen 1980 und 1986) und für stehende Gewässer (zwischen 1986 und 1988). Gemeinsam mit SPENGLER (SPENGLER et ZINKE 1987) und SzEKELY (SzEKELY 1987, SzEKELY et ZINKE 1989) sind diese Aufnahmemethoden inhaltlich vertieft und verfeinert worden. -

Lange Straße 18, 06184 Kabelsketal
AMTSBLATT Gemeinde Kabelsketal Lange Straße 18, 06184 Kabelsketal 12. Jahrgang Freitag, den 16. September 2005 18/2005 Veranstaltungskalender Gemeinde Kabelsketal Ortschaft Dieskau: –> Dieskauer Wochenmarkt samstags von 8.00 - 12.00 Uhr auf dem Schlossplatz in Dieskau –> Führungen durch Schloss und Kirche mit Förderverein Schloss Dieskau jeden Samstag und Sonntag 14.00 Uhr (Tel.: 0345/5829490) –> “Irischer Abend” mit Volkhard Brock u. a. im Schlosshof am Lagerfeuer, Freitag, 16. September 2005, um 20.00 Uhr –> “Dieskauer Sommer”, Abschlusskonzert, Sonntag, 18. September 2005, 16.00 Uhr mit Hallenser Madrigalisten (siehe OT Dieskau) –> Freitag, 23. September 2005, 19.30 Uhr Ural-Kosaken-Chor (siehe OT Dieskau) –> - 18. September 2005: Führung im Park Dieskau - 25. September 2005: Thematische Führung des Monats September “Der Lyrische Baumkreis - Gehölzrunde & Poesie” Veranstalter: Förderverein Park Dieskau Treffpunkt zu den Führungen: jeweils 14.00 Uhr Schlossplatz –> Parkseminar im Park Dieskau vom 7. bis 9. Oktober 2005 (siehe Mitteilungen Kabelsketal) Ortschaft Gröbers: –> 1. Kabelskecup der Feuerwehren am 24. September 2005 auf dem Schulsportplatz in Gröbers (siehe Mitteilungen Kabelsketal) –> Der Kleingärtnerverein “Zur Erholung” e. V. Gröbers lädt zum Erntedankfest am 24. September 2005 ein. Ortschaft Großkugel: –> 1. Oktoberfest am 16. und 17. September 2005 auf der Festwiese Großkugel (siehe OT Großkugel) –> HFC Traditionstreff gegen Großkugel Alte Herren am 2. Oktober 2005, 14.00 Uhr –> Landkreis Sangerhausen: Seminar für Existenzgründer vom 26. bis 28. September 2005 von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr –> Informationsveranstaltung für ein Nachtflugverbot am Flughafen Leipzig-Halle am 28. September 2005, um 17.00 Uhr in Halle (siehe Leserzuschriften) Inhaltsverzeichnis Gemeinde Kabelsketal Seite 2 Ortschaft Gröbers Seite 10 Ortschaft Dieskau Seite 8 Ortschaft Großkugel Seite 11 Ortschaft Dölbau Seite 9 Kabelsketal - 2 - Nr. -

Gemeinde Kabelsketal Herausgeber
s Querstr. F e t W s De r Großer r. Ost e . Wiedemarer Str. Kapellenberg D rg r est- ring o u t W r nb Dautzsch 108 r. S t ring hweg s Am r c t eideburg Dautz Orionstr. r i Apolda R s e Zöberitz r Flachsweg Raps- e o Grundsch. 110 Sagis- Umspannwerk K Mais- Reseden- Sietzsc P L Hafer- h Johannes a rg sstr. er Delitzscher Str. nds weg dorfer . R traß 27 r i Str. der Täufer e e ng Äuß Park Polarisstr. t Mitte Oelsnitzer S Verlän e l Walther- re weg - D Lupinen- Mittelstr. Grüner Weg iem . itzer Sonnen- blumen- eeb l Cossebauder Rathenau- Weg Büschdorfer Weg S P s Poststr. Alte Salzstr. tr. Str. n Orionstr. Str. Otto- Sagisdorfer - r t Str . h r e r Wiedemarer Str. r f . t t c Emsdor e gerte Apoldaer Str. Park S dorfer We S L167SAGISDORF S f r EMSDORF r Alte Salzstr. e u S d e a c s h k Stomps- Str. A B C Schw h D E F G H J K c a c i rz s e n Industriegebietgebiet m w Str.r. n Polarisstr. lle b e E Z er K2139 a g e 27 e Str. H . r - Starparkk A14 r P endorfer W.-G.-W.-G. t a b Kreuz- ule Strengbach u h S e Freund-Str.Freund-S c Uralitastr.Ura c l- b S r w Sp.-Pl. S St.Marien K K . S . e Z e Uralitastr. r r n i n i 1 n i g r e t St. -

Schutzmaßnahmen
Die Stadt- und Heimatzeitung mit Amtsblatt der Großen Kreisstadt Schkeuditz 04/2020 | 29. Jahrgang Foto: M. Strohmeyer M. Foto: Schutzmaßnahmen Das Corona-Virus führt auch in Schkeuditz zu erheblichen Ein- troffen: Geschäfte, die nicht der Grundversorgung der Bevölkerung schnitten im öffentlichen Leben. Schulen, Kitas und Sporthallen dienen, sind geschlossen – zunächst bis einschließlich 20. April, haben geschlossen, Museum, Bibliotheken und Kulturhaus müssen vermutlich aber auch darüber hinaus. Die Läden, die öffnen dürfen, auf Besucherverkehr verzichten und auch Veranstaltungen jedweder schützen soweit es geht ihre Mitarbeiter und Kunden. So hat die Art sind für größere Personengruppen untersagt. Seit dem 18. März Albanus-Apotheke jetzt Spuck- und Niesschutzscheiben an den Be- sind auch Händler von den Schutzmaßnahmen vor dem Virus be- ratungstischen installiert. Lesen Sie mehr auf Seite 2 Gewechselt Geboten Geplant Der Tanztempel von Marco Dehm Bei der Berufsbörse JOBregional Der Leiter des Kulturhauses ist von Leipzig-Wahren nach im Globana Messe Center gab es Olaf Hanemann kommt Schkeuditz gezogen eine große Auswahl mit neuen Ideen S. 4 S. 5 S. 7 Der Oberbürgermeister hat das Wort Pandemie schränkt öffentliches Leben auch in Schkeuditz ein Liebe Schkeuditzerinnen, ihrer Möglichkeiten unternimmt, diese Fol- nicht alle haben Zugriff auf das Internet. Bit- Liebe Schkeuditzer, gen abzufedern. te teilen Sie dieses Wissen mit Ihren Nach- So lange wir in der Fessel des Corona- barn. Beachten Sie die Hygienehinweise, heute wende ich mich mit einem sehr erns- Virus sind, bitte ich Sie mit gesundem Men- damit auch Sie weiter gesund bleiben. ten Anliegen an Sie. Das Corona-Virus hat schenverstand, trotz allem aber mit Ruhe Lassen Sie uns zusammen stehen. -

Juni 2008 Nummer 6/2008 2
Seite S1SSaalaalaalekekekrrreieiei14... Junisss 2008 --- KKKurururSiiiaalerererekreis-Kurier 14. Juni 2008 Nummer 6/2008 2. Jahrgang Nichtamtliches Mitteilungsblatt für den Landkreis Saalekreis Sommerferien im Erzgebirge Inhalt Wer für die Sommerferien noch nichts geplant hat, kann eine erlebnisreiche Zeit im Schullandheim „Tabakstanne“ in Merseburger machen Geschichte Thalheim im Erzgebirge verbringen. Für Kinder und Jugendliche von sieben bis Seite 2 17 Jahre gibt es verschiedene Anngebo- te: Internationales Teeny-Camp: 19. bis 26. Juli (Altersgruppe 13 bis 17 Jahre) Die Stadt Mücheln (Geiseltal) Ferienclub 1: 26. Juli bis 2.August (Al- stellt sich vor tersgruppe sieben bis 15 Jahre) Seite 5 Ferienclub 2: 2. bis 9. August (Alters- gruppe sieben bis 15 Jahre) Doppelclub 1: 19. Juli bis 2. August Verkauf von Papiersäcken für (Altersgruppe 13 bis 17 Jahre) den ehemaligen Saalkreis Doppelclub 2: 26. Juli bis 9. August (Altersgruppe sieben bis 15 Jahre) Seite 7 Spezialclub: 2. bis 13. August (Alters- gruppe sieben bis 15 Jahre) Schnupperwoche 1: 9. bis 13. August Vorbereitungen zur Impfung (Altersgruppe sieben bis 15 Jahre) gegen Blauzungenkrankheit Schnupperwoche 2: 18. bis 22. August (Altersgruppe sieben bis 15 Jahre) Seite 7 Im Preis enthalten sind die An- und Ab- reise mit Reisebus, Vollverpflegung aus eigener Küche und vielfältige Freizeit- Wohin im Saalekreis? angebote. Anmeldeschluss ist der 12. Juli 2008. Noch bis 15. Juni: Sachsen-Anhalt-Tag Weitere Informationen zu Preisen und in Merseburg Programm erhalten Interessenten im Ju- Der Teutschenthaler „Talkessel“ empfängt am 28. und 29. Juni die besten Motocrosser. Foto: Bruno Noch bis 15. Juni: Kinder- und Garten- gendamt der Kreisverwaltung Saalekreis fest in Döllnitz bei Frau Holzapfel, Telefon 03461/ Noch bis 29. -
Bebauungsplan „Airport Gewerbegebiet Nördlicher Bierweg“
SEHLHOFF GMBH INGENIEURE + ARCHITEKTEN Spitzweidenweg 32, 07743 Jena im Auftrag der Flughafen Leipzig/Halle GmbH Terminalring 11 04435 Flughafen Leipzig/Halle Bebauungsplan „Airport Gewerbegebiet nördlicher Bierweg“ Begründung und Umweltbericht gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) Bebauungsplan „Airport Gewerbegebiet nördlicher Bierweg“ - Teil C - Begründung – Stand 04. Februar 2016 Städtebauliche Konzeption: SEHLHOFF GMBH Dipl.-Ing. Beate Fix INGENIEURE + ARCHITEKTEN Spitzweidenweg 32, 07743 Jena Planzeichnung, Textliche Festsetzungen und Begründung: SEHLHOFF GMBH Dipl.-Ing. Stefan Hasselmann INGENIEURE + ARCHITEKTEN Dorett Kormann Spitzweidenweg 32, 07743 Jena Umweltbericht, naturschutzfachliches Gutachten, landschaftspflegerische Begleit- planung: Grünplan GmbH Dipl.-Ing. Alfons Neumair Prinz-Ludwig-Straße 48 85354 Freising Schalltechnische Untersuchungen: cdf Dipl.-Ing. Bianca Ulfik Schallschutz consulting Dr. Fürst Alte Dresdner Straße 54 01108 Dresden Infrastrukturplanung und Abwägung: duisport consult GmbH Dr. Ghanem Degheili Hafennummer 3650 Alte Ruhrorter Straße 42 - 52 47119 Duisburg Bramey.Bünermann Ingenieure GmbH Dipl.-Ing. Volker Bünermann Bodo Holland Seite 2 SEHLHOFF GMBH Ingenieure + Architekten Bebauungsplan „Airport Gewerbegebiet nördlicher Bierweg“ - Teil C - Begründung – Stand 04. Februar 2016 Bebauungsplan „Airport Gewerbegebiet nördlicher Bierweg“ Teil C – Begründung und Umweltbericht gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) 1 Einleitung 7 2 Anlass der Planung 7 3 Plangebiet 9 3.1 Abgrenzung des Geltungsbereiches -

AMTSBLATT Für Den Landkreis Saalekreis
AMTSBLATT für den Landkreis Saalekreis 06. Jahrgang Merseburg, den 26. Juli 2012 Nummer 21 I N H A L T Kreistag Saalekreis / Ausschusssitzungen: Sitzung des Vergabeausschusses am 02.08.2012………………………………………………….. ..………………………………….1 Bekanntmachungen des Landkreises Saalekreis: Dezernat III / Umweltamt – Untere Wasserbehörde: Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls auf das Erfordernis einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die Entnahme von Grundwasser in der Gemeinde Teutschenthal OT Dornstedt…………………………………………………………………………………………...1 Dezernat III / Umweltamt – Untere Immissionsschutzbehörde: - Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, Landkreis Saalekreis……...………………………2 - Errichtung und Betrieb von 4 Windkraftanlagen in 06268 Obhausen…………………………………………………………………2 Bekanntmachung des Landesverwaltungsamtes: Überschwemmungsgebiet Kabelske – Festsetzungsverfahren…………………………………………………………………………..3 Bekanntmachungen des Abwasserzweckverbandes „Salza“: - 1. Änderung zur Abwasserbeseitigungssatzung……………………………………………………………………………………….3 - Satzung über die Fortgeltung des Satzungsrechtes der Gemeinde Salzatal/OT Lieskau im Rahmen der Aufgabenübernahme der Abwasserbeseitigung in den AZV „Salza“…………………………………………………………………………………………….3 - Erstreckungssatzung des AZV Salza über die Erstreckung des Satzungsrechts des AZV für den Ortsteil Lieskau der Gemeinde Salzatal……….…………………………………………………………………………………………………………….4 Impressum......……………………………………………………………………………………………………………………........... 4 für die Entnahme von Grundwasser in der Gemeinde Kreistag -

Weiße Elster“ Vertrags-Nr
Auftraggeber: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt Otto-von-Guericke-Str. 5 39104 Magdeburg Projekttitel: Gewässerentwicklungskonzept „Weiße Elster“ Vertrags-Nr. 14/N/1747/MD Auftragnehmer: Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH Brühler Herrenberg 2a 99092 Erfurt Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH Brühler Herrenberg 2a D-99092 Erfurt Telefon (03 61) 22 49-0 Telefax (03 61) 22 49-11 November 2015 BR/Kre/CK/2014396.20 - I - Inhaltsverzeichnis Seite 0 Veranlassung und Aufgabenstellung 1 1 Gebietsübersicht und Gewässercharakteristik 3 1.1 Abgrenzung und Charakterisierung des Gebietes 3 1.1.1 Gebietsabgrenzung 4 1.1.2 Naturraum 6 1.1.3 Historische Entwicklung 10 1.2 Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 11 1.2.1 Oberflächenwasser 11 1.2.2 Grundwasser 12 1.3 Vorhandene Schutzkategorien 13 1.3.1 Naturschutzgebiete 13 1.3.2 Natura 2000 14 1.3.3 Hochwasserschutzgebiete 17 1.3.4 Denkmalschutz und geschützte Parks 19 1.3.5 Landschaftsschutzgebiete 21 1.4 Aktueller Gewässerzustand nach WRRL und Natura 2000 21 1.4.1 Ergebnisse der Bestandsaufnahme 21 1.4.2 Ökologischer Zustand nach WRRL 24 1.4.3 Lebensräume, Flora und Fauna 25 2 Relevante Nutzungen 26 2.1 Siedlungen 26 2.2 Landwirtschaft 27 2.3 Forstwirtschaft 28 2.4 Verkehr 28 2.5 Tourismus 29 2.6 Fischereiwirtschaft 29 2.7 Wasserrechte / Nutzungen 29 3 Vorliegende Planungen 31 3.1 Maßnahmenprogramm der Flussgebietsgemeinschaft Elbe 2015 [2] 31 3.2 Konzeption zur Umsetzung der ökologische Durchgängigkeit in den Fließgewässern in Sachsen-Anhalt 2008 [14] 32 3.3 Gewässermorphologische Entwicklungsfähigkeit und eigendynamische Gewässerentwicklung 2011 [15] 32 3.4 Entwicklung und Bereitstellung einer Bewertungsmethodik zur Beurteilung des hydrologischen Regimes der Oberflächenwasserkörper in Sachsen-Anhalt 2010 [16] 34 3.5 Wasserbauliche Planungen der Gewässerunterhaltungsverbände 35 3.6 Weitere projektbezogene Planungen, Gutachten etc. -

Lange Straße 18, 06184 Kabelsketal
AMTSBLATT Gemeinde Kabelsketal Lange Straße 18, 06184 Kabelsketal 13. Jahrgang Freitag, den 2. Juni 2006 11/2006 Veranstaltungskalender Gemeinde Kabelsketal: Ortschaft Dieskau -Dieskauer Wochenmarkt samstags von 8.00 - 12.00 Uhr auf dem Schlossplatz Dieskau -Programmänderung KONZERTREIHE DIESKAUER SOMMER (siehe Ortschaft Dieskau “Kirchliche Nachrichten”) -Schloss- und Kirchenführungen in Dieskau jeden Sonnabend und Sonntag 14.00 Uhr im Schlosshof (Anmeldung zu sonstigen Führungen über 03 45/5 82 94 90 oder 03 45/5 80 03 01) - “Erlaube mir, schönes Mädchen” - Gemeinsames Konzert Männerchor Zwintschöna und Gemischter Chor Stein-Bocken- heim-Palz am Freitag, 16. Juni 2006, 17.00 Uhr in der Kirche St. Anna Dieskau (siehe Ortschaft Dieskau) -3. Dieskauer Parkfest am 17. Juni 2006, 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Meiers Höhe am Mühlweg (siehe Ortschaft Dieskau) -3. Simsontreffen am 17. Juni 2006 auf der Festwiese Dieskau (siehe Ortschaft Dieskau) - 8. Trabant- und IFA-Treffen vom 23. Juni bis 25. Juni 2006 in Dieskau auf der Festwiese Ortschaft Gröbers - Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Gröbers am 2. Juni 2006, 17.30 Uhr auf dem Schulsportplatz Gröbers (siehe Ort- schaft Gröbers) - Jubiläum der Ortsfeuerwehr Gröbers - Tanzveranstaltung für Jung und Alt am 8. September 2006 (siehe Ortschaft Gröbers) -2. Kabelsketalcup am 9. September 2006, Frühschoppen am 10. September 2006 (siehe Ortschaft Gröbers) -Dorfmeisterschaften im Fußball des SV “Eintracht” Gröbers e. V. vom 13. Juni bis 23. Juni 2006 - Appelsfest vom 23. Juni bis 25. Juni 2006 Ortschaft Großkugel - 6. Motorradtreffen der Biker-Freunde Großkugel vom 28. - 30. Juli 2006 auf der Festwiese Großkugel Halle Saalkreis und Umgebung: - 82.