Hochwasserschutz in Leipzig 2011 Seite 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hochwasserforschung an Der Elbe Und Ihren Nebenflüssen
Hochwasserforschung an der Elbe und ihren Nebenflüssen Datenbankauszug aus der Umweltforschungsdatenbank UFORDAT Hochwasserforschung an der Elbe und ihren Nebenflüssen Datenbankauszug aus der Umweltforschungsdatenbank UFORDAT von Dirk Groh, Larissa Pipke, Franziska Galander UMWELTBUNDESAMT Diese Publikation ist ausschließlich als Download unter http://www.uba.de/uba-info-medien/4563.html verfügbar. Stand: Juli 2013 Herausgeber: Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau Tel.: 0340/2103-0 Telefax: 0340/2103 2285 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.umweltbundesamt.de http://fuer-mensch-und-umwelt.de/ Bearbeitung: Fachgebiet I 1.5 Nationale und Internationale Umweltberichterstattung - Sachgebiet Umweltinformationssysteme und –dienste Dirk Groh, Larissa Pipke, Franziska Galander Foto Deckblatt: © Motive, www.fotolia.com Dessau-Roßlau, August 2013 UFORDAT – Die Datenbank zur Umweltforschung http://www.umweltbundesamt.de/ufordat Inhaltsverzeichnis Die Umweltforschungsdatenbank UFORDAT ................................................................................... 6 Umweltforschung im Überblick ................................................................................................... 6 Zielgruppen und Zielsetzung ....................................................................................................... 6 Datenquellen .................................................................................................................................... 7 UFORDAT im Internet.................................................................................................................... -
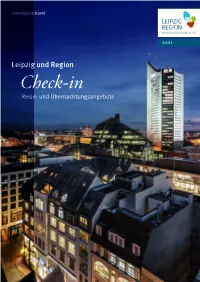
Check-In 2021 | Reise
www.leipzig.travel 2021 Leipzig und Region Check-in Reise- und Übernachtungsangebote Tageskarte 12,40 € Leipzig © & Hannot/Günther LTM/Heimrich gültig für eine Person Leipzig Card 12,40 € Tageskarte für 1 Person Day ticket for 1 person Die Leipzig Card 3-Tageskarte Freie Fahrt durch Leipzig und viele Preisvorteile © Kunstkraftwerk Leipzig, Foto: Luca Migliore Multimediale immersive Show „VAN GOGH experience“ 24,90 € Leipzig Card 24,90 € gültig für eine Person 3-Tageskarte für 1 Person an 3 aufeinander folgenden Tagen Mit der Leipzig Card haben Sie freie Fahrt mit den Ver- 3-day ticket for 1 person on 3 successive days kehrsmitteln des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes © Zoo Leipzig © Zoo Zoo Leipzig, Capybara Capybara Leipzig, Zoo 3-Tagesgruppenkarte (Zone 110) und Preisvorteile bei Stadtspaziergängen 46,40 € und Rundfahrten, freien Eintritt oder Ermäßigung Leipzig Card 46,40€ gültig für 2 Erwachsene bis zu 50 % in Museen, Preisvorteile in Restaurants, 3-Tagesgruppenkarte für 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder (unter 15 Jahren) und bis zu 3 Kinder an 3 aufeinander folgenden Tagen Geschäften, beim Souvenirkauf, Ermäßigung bei 3-day group ticket for 2 adults and up to 3 children (under 15) on 3 successive days (unter 15 Jahre) Freizeiteinrichtungen, Festivals sowie in Konzert- und Theaterhäusern. 1 Information und Verkauf: 2 Leipzig Tourismus und Marketing GmbH Tourist-Information, Katharinenstraße 8, 04109 Leipzig Tel. +49 (0)341 7104-260 sowie im LVB-Mobilitätszentrum, im LVB-Servicecenter am Wilhelm-Leuschner-Platz (Petersstraße/ Ecke Markgrafenstraße), -

Leipzig New Lake Land
LEIPZIG NEW LAKELAND LAND IN MOTION 1 Maritime atmosphere at Zöbigker Marina Welcome to Leipzig New Lakeland ! By 2015, the flooding of opencast mines around the city of Leipzig in central Germany will have created nearly 70 square kilometres of new lakes – and a wealth of leisure opportunities. Visitors can already enjoy various adrenaline sports on water and on land, as well as fun and relaxation for the whole family, not to mention a wide variety of culture. Join the local Schladitz family as they discover Leipzig New Lakeland – Land in Motion. 2 Black gold Leipzig New Lakeland has a proud mining heritage. And with its industrial past still very much in evidence, there are some fascinat- ing discoveries to be made. page 4 In the pink Sports enthusiasts are always on the look-out for attractive facilities in the right surroundings for their favourite activities. They’re spoilt for choice in Leipzig New Lakeland! page 6 Green surroundings Get away from your daily routine – and get back to nature! Leipzig New Lakeland’s the place to recharge your batteries in the company of family and friends. page 8 Colourful history HierHistorical wurden spectacles Geschichten and placesgeschrie - ben.where Historische famous writers, Spektakel philosophers, und Ausflügeartists and zu composers Wirkungsstätten once lived nam - hafterand worked Dichter, make Denker Leipzig und New Künstler Lake - machenland a cultural das Leipziger treasure Neuseenland trove. zur Schatzkammer. page 10 Play the blues Art and music are part and parcel of Leipzig New Lakeland. After your days out, take in first-rate perfor- mances in the evenings. -

Lebendige Burgaue?
1 Lebendige Burgaue? Lebendige Burgaue? Das Projekt „Lebendige Luppe“ im Kontext der notwendigen Auendynamik zum Erhalt der Leipziger Burgaue Holger Seidemann Heiko Rudolf Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V. 2 Inhalt Lebendige Burgaue? 1. Leitbild der Burgaue 2. aktueller Planungsstand „Lebendige Luppe“ 3. Weiterentwicklung „Lebendige Luppe“ 4. Vorgetragene Einwände gegen auendynamische Flutungen 5. Ausblick 3 1. Leitbild der Burgaue Lebendige Burgaue? Die Burgaue ist eine der wenigen, noch erhaltenen Hartholzauen von überregionaler Bedeutung mit europäischem Schutzstatus. Lebensgemeinschaft von außerordentlicher Vielfalt . Auenstandorte entwickelten sich unter dem spezifischen Einfluss von Grundwasser und Hochwasser: geringer Grundwasser-Flur-Abstand, mit starken Schwankungen häufige und unregelmäßige Überflutungen, mit wechselnder Intensität und Ausbreitung dynamischer Wechsel zwischen Überschwemmungen und längeren Trockenzeiten Leitbild einer Hartholzaue Auendynamik ist Basis und Entwicklungsziel für Erhalt der Burgaue 4 1. Leitbild der Burgaue Lebendige Burgaue? Entwicklungsziel: dynamischer Fluss ökolog. Flutung HQ1-5 MQ Ziel (dynamisch) Ist Grundwasserstand Sohlanhebung . dynamische Zufuhr von Oberflächenwasser . Sohlanhebung der Neuen Luppe dynamische Wasserverhältnisse in Oberflächen- und Grundwasser 5 1. Leitbild der Burgaue Lebendige Burgaue? Projektziel eines Auenrevitalisierungsprojekts, abgeleitet aus dem Leitbild der Burgaue: Förderung auentypischer dynamischer Wasserverhältnisse in Oberflächen- und Grundwasser 6 2. aktueller -

Zur Schneckenfauna (Mollusca: Gastropoda) Isolierter Auenwald- Fragmente Der Elster-Luppe-Aue in Sachsen-Anhalt
ISSN 0018-0637 Hercynia N. F. 35 (2002): 137–143 137 Zur Schneckenfauna (Mollusca: Gastropoda) isolierter Auenwald- fragmente der Elster-Luppe-Aue in Sachsen-Anhalt Jörg HAFERKORN 3 Abbildungen und 3 Tabellen ABSTRACT HAFERKORN, J.: Snailfauna (Mollusca: Gastropoda) of isolated floodplain forests fragments at the Elster- Luppe-floodplain in Saxony-Anhalt. – Hercynia N. F. 35: 137-143. Gastropod communities were investigated in 40 neighbouring fragmented floodplain forests with different sizes (0.04 to 20.4 ha) in Central Germany. Species numbers of land snail communities varied between 4 and 23. An increase in species richness and diversity of the land snail communities was noticed in connection with the sizes of forest fragments. Species numbers decreased with the distance to the next forest fragment with a size over 1.5 ha. KÖRNIG (2000) designate Succinea putris, Aegopinella nitidula, Balea biplicata, Fruticicola fruticum and Arianta arbustorum as the characteristic species of the floodplain forest in Central Germany. These five land snails would be shown also in subject to the size of the floodplain forests. Keywords: gastropods, land snails, floodplain forest fragments, species numbers 1 EINLEITUNG Im europäischen Maßstab gehören die Auen zu den am stärksten umgestalteten und zerstörten Land- schaftselementen. Ihre natürliche Vegetation, die ehemals großflächigen Auenwälder, die die Fließge- wässer von ihrer Quelle bis zur Mündung bandförmig begleiteten, wurde im Vergleich zu allen anderen Waldökosystemen am intensivsten reduziert. Die Auenwälder existieren gegenwärtig oft nur noch insel- förmig in der Agrarlandschaft oder in Siedlungsgebieten als kleinflächige Refugien, die von weiterer Fragmentierung bedroht sind. Dabei stellt sich die Frage, welche Mindestflächengrößen zur Ausprägung auenwaldtypischer Lebensgemeinschaften erforderlich sind. -

Erläuterung Zur Codierung in Der Tabelle "Messstellenverzeichnis"
BMBF Projekt "Bedeutung der Nebenflüsse für den Feststoffhaushalt der Elbe" Anhang C - Schwebstoff-Messstellenverzeichnis Erläuterung zur Codierung in der Tabelle "Messstellenverzeichnis" M_A = erster Monat, für den ein Messwert vorliegt M_B = letzter Monat, für den ein Messwert vorliegt M_f = Messfrequenz Fl.-Km = Flusskilometer BP-Nr. = Bezugspegel (Nummer siehe Tabelle D, "Verzeichnis der Bezugspegel") Z = Zuständigkeit (Codierung siehe Tabelle unten) CodeBehörde Bundesland Seite AStAUN Schwerin Meck.-Vorpommern E - 3 BNLWK Lüneburg Niedersachsen E - 4 CLUA Brandenburg Brandenburg E - 2 DStadtUm Berlin, ITOX Berlin E - 1 E StAU Magdeburg F StAU Halle Sachsen-Anhalt E - 6 G StAU Dessau/Wittenberg H LfUG Dresden J StUfa Leipzig K StUfa Chemnitz Sachsen E - 5 L StUfa Plauen M StUfa Bautzen N UBG Radebeul O TLU Jena Thüringen E - 8 P SUA Suhl/Erfurt keine Messwerte vorliegend Schwebstoff-Messwerte vorliegend, Konzentrations-Auswertung durchgeführt Schwebstoff-Messwerte sowie zugehöriger Pegel vorliegend, Konzentrations- und Fracht-Auswertung durchgeführt Bestimmungsmethode an allen Messstellen: DIN 38409 H2 - 2 Anhang C - Schwebstoff-Messstellenverzeichnis BMBF Projekt "Bedeutung der Nebenflüsse für den Feststoffhaushalt der Elbe" Nebengewässer der Elbe Messstelle afS - Messreihe Lage der Messstelle BP-Nr. Z 1.Ordnung 2.Ordnung 3.Ordnung 4.Ordnung M_A M_B M_f RW HW Fl.-Km Aland Schnackenburg 05.1980 07.2000 1 - 13 587824 587824 B Aland Wanzer 01.1992 12.1999 5 - 26 4,9 E Boize Boizenburg 01.1992 12.2000 4 - 26 591672 591672 1 A Dahle Seidewitz 04.1990 12.1993 2 - 6 5700750 4583050 0,3 J Dahle Außig Mdg. 01.1994 09.2001 8 - 17 5697700 4583015 3,8 J Dahle Schirmenitz 5695660 4582580 6,3 J Dahle Cavertitz 5695140 4578900 10,5 J Dahle uh. -

Mechanism-Specific Toxicity Bioassays for Water Quality Assessment and Effect-Directed Analysis” Supervisor: Prof
Mechanism-specific toxicity bioassays for water quality assessment and effect-directed analysis Von der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der RWTH Aachen University zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Naturwissenschaften genehmigte Dissertation vorgelegt von MSc Carolina Di Paolo aus São Paulo, Brasilien Berichter: Universitätsprofessor Dr. Henner Hollert Privatdozent Dr. Werner Brack Professor Dr. Frederic Silvestre Tag der mündlichen Prüfung: 20.Oktober.2016 Diese Dissertation ist auf den Internetseiten der Universitätsbibliothek online verfügbar. Nothing is softer or more flexible than water, yet nothing can resist it (Lao Tzu) Even small fish are fish (Czech Proverb) i ii Summary Biological assays have been applied to investigate freshwater quality for more than a century, and the public awareness of the threats of aquatic pollution has motivated advances in water quality regulations. In Europe, such a scenario led to the establishment of the Water Framework Directive (WFD) as a unified and harmonised framework for water protection, with the main objective to achieve a good water ecological and chemical status. Despite the recognized relevance of bioassays by scientists and national authorities, until now they are not recommended for direct application in the WFD monitoring activities. A reason for that is that there are remaining research questions that need further clarification before bioassays are integrated in water quality monitoring. The EDA-EMERGE Marie Curie Initial Training Network, in which context the present thesis was developed, was set up to investigate and answer some of these questions. The project aimed at the assessment, monitoring and management of water quality in European river basins through different approaches, including the investigation and development of new effect-directed analysis (EDA) methods for the identification of toxicants in surface waters. -

European Union Risk Assessment Report
EU RISK ASSESSMENT – TCPP CAS 13674-84-5 European Union Risk Assessment Report TRIS(2-CHLORO-1-METHYLETHYL) PHOSPHATE (TCPP) CAS No: 13674-84-5 EINECS No: 237-158-7 RISK ASSESSMENT RAPPORTEUR IRELAND/UK EU RISK ASSESSMENT – TCPP CAS 13674-84-5 LEGAL NOTICE Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of the following information A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa Server (http://europa.eu.int). Cataloguing data can be found at the end of this publication Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, [ECB: year] ISBN [ECB: insert number here] © European Communities, [ECB: insert year here] Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. Printed in Italy RAPPORTEUR IRELAND/UK EU RISK ASSESSMENT – TCPP CAS 13674-84-5 TRIS(2-CHLORO-1-METHYLETHYL) PHOSPHATE (TCPP) CAS No: 13674-84-5 EINECS No: 237-158-7 RISK ASSESSMENT May 2008 Ireland (lead) and United Kingdom Rapporteur for the risk assessment of TCPP is Ireland (lead) and United Kingdom Contact point: Dr. Majella Cosgrave Chemicals Policy and Services Health and Safety Authority The Metropolitan Building James Joyce Street Dublin 1 Ireland RAPPORTEUR IRELAND/UK EU RISK ASSESSMENT – TCPP CAS 13674-84-5 Date of Last Literature Search : 28/06/2006(Environment) 28/05/2007(Human Health) Review of report by MS Technical Experts finalised: April 2007 (Environment) April 2008 (Human Health) Final report: 2008 RAPPORTEUR IRELAND/UK EU RISK ASSESSMENT – TCPP CAS 13674-84-5 FOREWORD Foreword This Draft Risk assessment Report is carried out in accordance with Council Regulation (EEC) 793/931 on the evaluation and control of the risks of “existing” substances. -

Verzeichnis Der Schiffbaren Gewässer
Anlage 2 (zu § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2) Verzeichnis der schiffbaren Gewässer Nummer 1: allgemeine schiffbare Gewässer Name Gewässerart Gemeinde Beschränkung der Schifffahrt auf: Speicherbecken Knappenrode Speicherbecken Lohsa, Wittichenau Fahrgastschifffahrt, nichtmotorange- (Hoyerswerdaer Schwarzwasser) triebener und elektromotorangetrie- bener Sportbootverkehr Talsperre Kriebstein (Zschopau) Talsperre Kriebstein, Rossau, Fahrgastschifffahrt, Fährbetrieb, Mittweida nichtmotorangetriebener und elekt- romotorangetriebener Sportbootver- kehr Vereinigte Mulde Fließgewässer Wurzen/Bennewitz Fahrgastschifffahrt, Fährbetrieb, mo- (Fluss-km 114,4 bis 118,3) torangetriebener Sportbootverkehr Vereinigte Mulde Fließgewässer Grimma Fahrgastschifffahrt, Fährbetrieb, mo- (Fluss-km 135,8 bis 138,0) torangetriebener Sportbootverkehr Talsperre Pöhl; Hauptsperre bis Talsperre Pöhl, Neuensalz Fahrgastschifffahrt, nichtmotorange- Vorsperren Neuensalz und Thoßfell triebener und elektromotorangetrie- (Trieb) bener Sportbootverkehr Talsperre Bautzen (Spree) Talsperre Bautzen, Malschwitz Fahrgastschifffahrt, nichtmotorange- triebener und elektromotorangetrie- bener Sportbootverkehr Speicherbecken Lohsa I (Kleine Speicherbecken Lohsa Fahrgastschifffahrt, nichtmotorange- Spree) triebener und elektromotorangetrie- bener Sportbootverkehr Talsperre Quitzdorf (Schwarzer Talsperre Niesky, Waldhufen, Fahrgastschifffahrt, nichtmotorange- Schöps) Quizdorf am See triebener und elektromotorangetrie- bener Sportbootverkehr Lausitzer Neiße Fließgewässer Ostritz, Görlitz, -

Bericht-Alte-Luppe-09-2006.Pdf
Wiederherstellung ehemaliger Wasserläufe der Luppe Bericht Inhaltsverzeichnis Teil 1 0 Aufgabenstellung.....................................................................................................1 1. Charakterisierung des Untersuchungsraumes.....................................................7 1.1 Lage und Abgrenzung / Gewässersystem der Alten Luppe.......................................7 1.2 Naturräumliche Einordnung und Landnutzung ..........................................................9 1.3 Historische Entwicklung des Gewässersystems des Luppeflusses.........................10 1.4 Relevante bisherige und zukünftige naturschutzfachliche und wasserwirtschaftliche Planungen im nordwestlichen Auwald ..................................11 1.4.1 Naturschutzfachliche Entwicklungsplanungen ................................................11 1.4.2 Wasserbauliche und wasserwirtschaftliche Planungen ..................................12 2. Gegenwärtiger Zustand des Auwaldes und der Wasserläufe der Luppe .........17 2.1. Aktuelle Gewässersituation......................................................................................17 2.1.1 Stehende Gewässer........................................................................................17 2.1.2 Fließgewässer.................................................................................................18 2.1.2.1 Luppewildbett (Restgewässer ehemaliger Luppe – Fluss) .............................18 2.1.2.2 Zschampert .....................................................................................................19 -

Mollusca: Gastropoda) Isolierter Auenwald- Fragmente Der Elster-Luppe-Aue in Sachsen-Anhalt
©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ISSN 0018-0637 Hercynia N. F. 35 (2002): 137–143 137 Zur Schneckenfauna (Mollusca: Gastropoda) isolierter Auenwald- fragmente der Elster-Luppe-Aue in Sachsen-Anhalt Jörg HAFERKORN 3 Abbildungen und 3 Tabellen ABSTRACT HAFERKORN, J.: Snailfauna (Mollusca: Gastropoda) of isolated floodplain forests fragments at the Elster- Luppe-floodplain in Saxony-Anhalt. – Hercynia N. F. 35: 137-143. Gastropod communities were investigated in 40 neighbouring fragmented floodplain forests with different sizes (0.04 to 20.4 ha) in Central Germany. Species numbers of land snail communities varied between 4 and 23. An increase in species richness and diversity of the land snail communities was noticed in connection with the sizes of forest fragments. Species numbers decreased with the distance to the next forest fragment with a size over 1.5 ha. KÖRNIG (2000) designate Succinea putris, Aegopinella nitidula, Balea biplicata, Fruticicola fruticum and Arianta arbustorum as the characteristic species of the floodplain forest in Central Germany. These five land snails would be shown also in subject to the size of the floodplain forests. Keywords: gastropods, land snails, floodplain forest fragments, species numbers 1 EINLEITUNG Im europäischen Maßstab gehören die Auen zu den am stärksten umgestalteten und zerstörten Land- schaftselementen. Ihre natürliche Vegetation, die ehemals großflächigen Auenwälder, die die Fließge- wässer von ihrer Quelle bis zur Mündung bandförmig begleiteten, wurde im Vergleich zu allen anderen Waldökosystemen am intensivsten reduziert. Die Auenwälder existieren gegenwärtig oft nur noch insel- förmig in der Agrarlandschaft oder in Siedlungsgebieten als kleinflächige Refugien, die von weiterer Fragmentierung bedroht sind. -

Entlang Des Elster-Radweges
2 Entlang Die Strecke zwischen Profen und Schkeuditz führt durch eine des Elster-Radweges abwechslungsreiche Landschaft mit interessanten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. 51 km 100 m leicht Anfahrt 12,8 km ⊲ 31,0 km ⊲ Den Bahnhof Profen erreichen Sie mit der Erfurter Bahn Es geht vorbei am Sender Wiederau und hier führt der Verlassen Sie die Brückenstraße links und fahren Sie am EBx12 und EB 22 aus Richtung Leipzig und Zeitz. Weg erst einmal weg vom Flüsschen entlang des Ortes Teilungswehr weiter. Sie radeln nun entlang des Elster- Start ⊲⊲⊲ Wiederau. flutbettes. Sie erreichen dann den Schleußiger Weg. Vom Bahnhof Profen fahren Sie die Bahnhofstraße bis 14,4 km ⊲ Auf diesen fahren Sie rechts auf und wechseln über vor zur Leipziger Straße. Hier links ein kurzes Stück bis Sie kreuzen kurz die Hauptstraße links und rechts und diesen Weg das Ufer des Elsterflutbettes. Sie radeln im- zur Hohle. Diese Straße entlang über die Pegauer Straße fahren auf dem Feldweg weiter. Inzwischen ist die Weiße mer weiter entlang des Elsterflutbettes, Sie sind mitten fahren bis zum Markt und dort biegen Sie in die Straße Elster wieder an Ihrer rechten Seite. In einem Bogen geht in der Stadt Leipzig. Ihr Weg führt weiter entlang der Am Profener Anger ein und folgen dieser Straße. es vorbei an den Ortschaften Klein- und Großdalzig. Weißen Elster durch den Richard-Wagner-Hain. Rechts 1,6 km ⊲ 19,0 km ⊲ befindet sich dann die Festwiese und die Red Bull Arena. Biegen Sie rechts in den Feldweg ein und folgen Sie Der Weg endet an der Ortschaft Zitzschen. In der Dorf- 38,4 km ⊲ diesem.