Schulchronik Kalenborn
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Eifel-Mosel-Zeitung 05.03
Für Wahrheit und Recht Zeitung in den Landkreisen DAU, WIL, VG Ulmen (COC) Seit 1865 EAZ-Wochenendwetter EAZ – Eifeler Allgemeine Zeitung 24. Jahrgang Tel. 0 65 92/929-80 80 · www.eifelzeitung.de Ausgabe 09. KW / 2021 Freitag 3°C EIFEL-MOSEL-ZEITUNG 05.03. leicht bewölkt JETZT NEU! Samstag 5°C Eifel-Zeitung 06.03. sonnig kostenlos als App Sonntag 7°C Servicepartner 07.03. leicht bewölkt Telefon: 02657 / 247 [email protected] 56767 Uersfeld (Eifel) Montag 7°C 08.03. leicht bewölkt Werkstatt-Service für alle Fabrikate Weil 191 Einwohner fehlen, Morning Briefi ng Die Deutsche lässt SPD-Landesregierung Impfschnecke die Krankenhausversorgung scheitern! Hoff entlich hat sich am Mitt woch beim Treff en der Spitze der Bundesregie- Gerolstein / Hillesheim. Zum 31. stehlen. Das Versagen des Ministe- rung mit den Landesfürsten, niemand reklamiert und dessen Impfaktion sich Dezember 2020 ist die Hauptab- riums wird durch den ergangenen die „Financial Times“ aufgeschlagen. „zu einer nationalen Peinlichkeit“ ent- teilung Chirurgie des Marienhaus Schriftverkehr und weitere Doku- Die britische Wirtschaft szeitung spot- wickelt. Klinikums Eifel St. Elisabeth in mente klar ersichtlich. Gemachte tet in der Ausgabe über ein Land, das Gerolstein geschlossen worden. Zusagen der Ministerin sind ganz „Vorsprung durch Technik“ für sich Fortsetzung auf Seite 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offensichtlich nicht eingehalten wurden erst am 21.12.2020 schrift- worden. lich hierüber informiert. Auch das Gigabit-Versager Ministerium für Soziales, Arbeit, In einer Antwort vom 26.08.2020 Gesundheit und Demografi e ist hat die Gesundheitsministerin der Rheinland-Pfalz? laut öffentlicher Stellungnah- Ersten Beigeordneten der Stadt „Gigabit-Anschlüsse sucht man in rer der Landesvereinigung der me am gleichen Tag über diesen Gerolstein geantwortet, dass „dem rheinland-pfälzischen Gewerbege- Unternehmerverbände Rheinland- Schritt informiert worden. -

LAG-Sitzung: 28.08.2019 Termine: Projektauswahlsitzung: 13.08.2019
Geschäftsstelle der LAG Vulkaneifel Mainzer Straße 24 54550 Daun Tel.: 06592 933-578 15.07.2019 Die Standortmarke Eifel kommt ins Laufen Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) bewilligt 412.500 Euro für die Standort- marke Eifel. ADD-Präsident Thomas Linnertz überreichte den Bewilligungsbescheid an Herrn Landrat Heinz-Peter Thiel. Träger des Koopera- tionsprojektes ist die Eifel Tourismus GmbH. Das Kooperationsvorhaben mit den Leaderregi- onen Bitburg-Prüm, Eifel (NRW) sowie Rheinei- fel zur Einführung der Marke Eifel greift die Ergebnisse des ersten gebietsübergreifenden LEADER-Projektes Markenprozess „Dachmarke Eifel“ auf und führt die dort entwickelte Standort- marke Eifel sowohl innerhalb als auch außer- halb der Region Eifel ein. Die LAG Vulkaneifel ist die federführende LAG. Finanziert werden mit dem Geld unter anderem Marketingmaßnahmen als Bild und Text in Print- und Onlinemedien zu Verbesserung der Markenbotschaft und -kommunikation. Ehrenamtsprojekte Insgesamt 23 Projekte mit einem Fördervolumen von über 35000 Euro bewarben sich um Unterstützung, hiervon wurden schließlich 14 Projekte von der Projektauswahlgruppe ausgewählt. Neun Projekte erhielten keine Förderung oder waren nicht förderfähig. Bei sechs der ausgewählten Projekte kommen die ehrenamtlichen Tätigkeiten Kindern und Jugendli- chen direkt zugute: der Bau einer Spielbahn (Hil- lesheim) und einer Mountainbikestrecke (Bleck- hausen), weiterhin die Gestaltung eines Kinder- Baum-Platzes (Bolsdorf) oder Förderungen zur Instandsetzung eines Feuerrades durch die -

Wasserversorgung
Verbandsgemeindewerke Kelberg - Wasserversorgung - Auf Grund des § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz – WRMG) vom 29.04.2007, BGBl. Teil 1, S. 600, wird bekannt gegeben, dass das von den Verbandsgemeindewerken Kelberg gelieferte Wasser nachstehenden Härtebereichen zugeordnet wird: UGesamthärte entspricht nach Millimol nach Grad deutsche Härtebereich Calciumcarbonat Härte (°dH) pro Liter weniger als 1,5 weniger als 8,4 weich = 1 1,5 bis 2,5 8,4 bis 14,0 mittel = 2 mehr als 2,5 mehr als 14,0 hart = 3 Fluorid Ortsgemeinde Härtebereich in mg/l Bereborn 2 0,36 Berenbach 2 0,36 Bodenbach 1 0,35 Bongard 1 0,35 Borler 1 0,35 Brücktal 3 0,09 Gelenberg 1 0,35 Gunderath 2 0,18 Horperath 2 0,36 Kelberg 1 0,36 Kelberg-Hünerbach 3 0,09 Kelberg-Köttelbach 2 0,16 Kelberg-Rothenbach 1 0,35 Kelberg-Zermüllen 1 0,36 Kirsbach 3 0,09 Kolverath 3 0,09 Lirstal 2 0,18 Mannebach 2 0,36 Mosbruch 2 0,36 Reimerath 3 0,09 Sassen 3 0,09 Uersfeld 2 0,18 Ueß 2 0,36 Welcherath 3 0,09 Es wird gebeten, den Härtebereich des Wassers an gut sichtbarer Stelle neben der Wasch- bzw. Spülmaschine zu notieren und bei der Zugabe von Wasch- und Reinigungsmitteln zu beachten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemeindewerke Kelberg, Tel.: 02692-87232, e-mail: [email protected]. BekanntmachungU Gemäß § 16 (4) der Verordnung vom 21. Mai 2001 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, TrinkwV 2001, wird bekannt gegeben, dass das im Versorgungsgebiet abgegebene Trinkwasser teilweise mit Zusatzstoffen aufbereitet wird. -
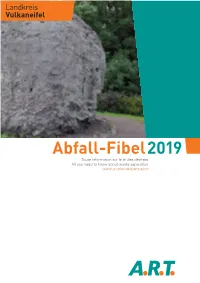
ART Fibel2019 VULKAN.Indd
Landkreis Vulkaneifel Abfall-Fibel2019 Toute information sur le tri des déchets All you need to know about waste separation www.art-trier.de/translation Liebe Kundinnen und Kunden, seit nunmehr drei Jahren sind wir Ihr Partner in allen Belangen der Abfall- und VERANTWORTUNG Kreislaufwirtschaft. Sei es bei der Abholung Ihrer Abfälle durch die von uns beauftragten Partnerunternehmen oder bei der Beratung und Betreuung durch unsere Mitarbeiter im Kundenzentrum – wir sind gerne für Sie da. Mit Ihnen machen wir die Abfallwirtschaft der Region fi t für die Zukunft. Denn auch beim „Müll“ bleibt die Zeit nicht stehen. Diskussionen um Mikroplastik, Verschmutzung der Weltmeere, Coffee-to-Go Becher sind DASEINS nur einige der Anzeichen für die Forderung nach mehr Bewusstsein im Umgang mit unseren Abfällen. Die Abfallwirtschaft und Ihre Wertstoffe sind ein zentraler Bestandteil der Ressourcenschonung. Nachhaltigkeit bedeutet in erster Linie Abfallvermeidung. Gemeinsam weniger Abfall zu produzieren, ist unser aller Pfl icht. Hierfür Anreize zu schaffen liegt in unserer Verantwortung. VORSORGE Abfälle sind Wertstoffe Die fachgerechte Verwertung der Abfälle aus der Region - jährlich über 200.000 Tonnen - und die verantwortungsvolle Nachsorge von mehr als 20 Deponien, stellen uns für die Zukunft vor große fi nanzielle Herausforderungen. Als unternehmerisch handelnder öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger ist es unsere Pfl icht und 2 Verantwortung, Preise zu vergleichen und kosteneffi zient zu handeln. 3 Nicht nur im privaten Bereich sind die Kosten für Dienstleistungen erheblich gestiegen. Diesen Kostensteigerungen wirken wir – soweit wie möglich - durch optimierte Prozesse und die Nutzung von Synergiepotenzialen entgegen. Wir möchten für Sie ein moderner, zukunftssicherer Zweckverband sein, der seinen Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Service zu fairen Gebühren bietet. -

Flüchtlingshilfe Im Landkreis Vulkaneifel
Flüchtlingshilfe im Landkreis Vulkaneifel Welche Hilfe? Wer hilft? Kontakt Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis Kreisverwaltung Vulkaneifel Mark Hallfell, Tel: 06592/933-239 - Ausländerbehörde - [email protected] Christoph Preis, Tel: 06592/933-238 [email protected] www.vulkaneifel.de Asylbewerberleistungen, Kreisverwaltung Vulkaneifel Yvonne Geimer, Tel: 06592/933-363 Krankenhilfe Asylbewerber, Beratung - Abteilung Soziales - [email protected] freiwillige Ausreise Anja Stark, Tel: 06592/933-364 [email protected] Thomas Schweisel, Tel: 06592/933-232 [email protected] www.vulkaneifel.de Wohnraummanagement Kreisverwaltung Vulkaneifel Waltraud Zender, Tel: 06592/933-350 - Abteilung Soziales - [email protected] Christian Kläs, Tel: 06592/933-232 [email protected] www.vulkaneifel.de Sozialhilfe (Asylbewerberleistungs- Verbandsgemeinde Gerolstein Tel: 06591/13-0 gesetz) [email protected] www.gerolstein.de Sozialhilfe (Asylbewerberleistungs- Verbandsgemeinde Daun Tel: 06592/939-0 gesetz) [email protected] http://www.vgv-daun.de Sozialhilfe (Asylbewerberleistungs- Verbandsgemeinde Kelberg Tel: 02692/872-0 gesetz) [email protected] www.vgv-kelberg.de Sozialhilfe (Asylbewerberleistungs- Verbandsgemeinde Hillesheim Tel: 06593/801-0 gesetz) [email protected] www.hillesheim.de Sozialhilfe (Asylbewerberleistungs- Verbandsgemeinde Obere Kyll Tel: 06597/16-0 gesetz) [email protected] www.oberekyll.de Beratung in Notlagen, Vermittlung von Beauftragte für Migration -

Mitteilungsblatt Für Den Bereich Der Verbandsgemeinde Daun Gesundland Vulkaneifel Wochenblatt Mit Amtlichen Bekanntmachungen Modern
PA sämtl. HH MITTEILUNGSBLATT FÜR DEN BEREICH DER Verbandsgemeinde Daun GESUNDLAND VULKANEIFEL WOCHENBLATT MIT AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN MODERN . GESUND . INNOVATIV Jahrgang 49 Freitag, den 17. April 2020 Ausgabe 16/2020 BEREITSCHAFTSDIENSTE Bereitschaftsdienste in der Corona-Krise: Corona-Ambulanz Vulkaneifel - Standort Daun 0151 701 881 39 E-Mail: [email protected] Erreichbarkeit der Verbandsgemeindever- Zugang nur nach vorheriger Terminvereinbarung Ärztlicher Bereitschaftsdienst waltung Daun - wenn Hausbesuch erforderlich ist - .............................................116 117 24-Stunden-Hotline Anschrift: Beratung und Weiterleitung zu Fieberambulanz/Corona-Test bei typischen Symptomen wie Fieber, Husten, Leopoldstr. 29, 54550 Daun Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen .......... 0800 9900 400 Postfach 11 40, 54542 Daun Sorgentelefon für Senioren Telefon: 06592 939-0 von DRK, Caritasverband Westeifel e. V., Telefax: 06592 939-200 Pfegestützpunkte Landkreis Vulkaneifel ..................... 06592 9848778 Internet: http://www.daun.de mo-do 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr, fr 10.00-13-00 Uhr E-Mail: [email protected] Lebensberatung Gerolstein des Bistums Trier ................ 06591 4153 www.lebensberatung.info Aufgrund der weiter anhaltenden Verbreitung des Corona-Virus in Bereitschaftsdienste Deutschland haben wir uns aus Vorsorgegründen dazu entschie- Notrufe den, die Räumlichkeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Polizei .......................................................................................................................110 -

Classifiche Comune Di Brockscheid
27/09/2021 Mappe, analisi e statistiche sulla popolazione residente Bilancio demografico, trend della popolazione e delle famiglie, classi di età ed età media, stato civile e stranieri Skip Navigation Links GERMANIA / Rheinland-Pfalz / Provincia di Vulkaneifel, Landkreis / Brockscheid Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA GERMANIA Comuni Powered by Page 2 Arbach Affianca >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Hillesheim AdminstatBasberg logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA Hinterweiler Beinhausen GERMANIA Höchstberg Bereborn Hohenfels- Berenbach Essingen Berlingen Horperath Berndorf Hörscheid Betteldorf Hörschhausen Birgel Immerath Birresborn Jünkerath Bleckhausen Kalenborn- Bodenbach Scheuern Bongard Kaperich Borler Katzwinkel Boxberg, Kr Kelberg Daun Kerpen (Eifel) Brockscheid Kerschenbach Brücktal Kirchweiler Darscheid Kirsbach Daun Kolverath Demerath Kopp Densborn Kötterichen Deudesfeld Kradenbach Dockweiler Lirstal Dohm-Lammersdorf Lissendorf Drees Mannebach, Dreis-Brück Eifel Duppach Mehren, Kr Ellscheid Daun Esch b Meisburg Gerolstein Mosbruch Feusdorf Mückeln Gefell, Kr Daun Mürlenbach Gelenberg Neichen Gerolstein Nerdlen Gillenfeld Neroth Gönnersdorf b Powered by Page 3 Gerolstein Niederstadtfeld L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Gunderath Nitz Adminstat logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA Hallschlag GERMANIANohn Oberbettingen Oberehe- Stroheich Oberelz Province Oberstadtfeld Ormont Pelm Reimerath Retterath Reuth, -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

Motorradtour-Vulkaneifel.Pdf
Tourenkarte: Rund um den Nürburgring Burg Blankenheim (i.Pl.) Hümmel Ober- Rohr l Schuld Liers Tourenvorschlag schömbach Ahrquelle Ohlenhard Wershofen Blankenheimer- Dümpelfeld a Wolfert dorf Blankenheim Ahr t Alternative Route Vellerhof Fuchshofen Reetz Eichenbach Insul n Herschbach Schmidtheim 51 (i.Pl.) Ahr Winnerath Neuhaus Aremberg Niederadenau n SchlSchlossoss 258 Lommersdorf Lückenbach Neuhof Nonnenbach 257 e SSchmidtheimchmidtheim 623 Simmelerhof Reifferscheid Abtei Gertrudenhof Freilingen Aremberg Antweiler D Kaltenborn Maria Gilgenbach N 632 Frieden Hüngersdorf (i.Pl.) Rodder Leimbach Berk Ripsdorf Müsch Losheimergraben Ruine Waldorf Ruine Ahrhütte Jammelshofen Frauenkron Baasem Dorsel ADENAU Kronenburg Dahlem Dollendorf Neuhof Honerath Wirft Hohe Acht Kronenburg Dollendorf Hoffeld 258 747 Lanzerath Losheim Esch BREIDSCHEID Scheid Am Leger Alendorf Uedelhoven Kronenburger 421 Wimbach Herschbroich (i.Pl.) Hüllscheid Hallschlag See Mirbach Barweiler Ruine Nürburgring- Jünkerath Feusdorf Trierscheid Kotten- NürburgNürburg Nordschleife NORDRHEIN- born Stadtkyll Pomster Kehr Kerschenbach WESTFALEN Üxheim Quiddelbach Döttingen Wiesbaum RHEINLAND- Dankerath Meuspath Krewinkel Auf dem Nürburg Baar Ormont Schüller Nohn Drees Manderfeld Steinberg Kruchler PFALZ Senscheid Wiesemscheid Nitz E29 Birgel Nürburgring Ourtal Gönnersdorf Nollenbach Bauler Müllen- Roth bei Prüm 654 51 (i.Pl.) Lind Schönfeld Lissendorf Kerpen bach Kirsbach Neuenstein (Eifel) Borler Meisenthal Welcherath Auw bei Prüm Vulkaneifel Brücktal Lehnerath Boden- Kobscheid -

P F a R R B R I
Pfarrbrief für die Brockscheid - Darscheid - Demerath - Gillenfeld - Mehren - Schalkenmehren - Strohn - Strotzbüsch 52. Jahrgang, Nr. 4 www.pg-gillenfeld.de 27.03.2021 – 25.04.2021 „Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.“ (Lk. 24,34) - 1 - Liebe Gemeindemitglieder, die letzten Monate waren für uns alle keine einfache Zeit. Die Corona-Pandemie hat nicht nur unser Land, sondern die ganze Welt aus ihrem normalen Trott ge- nommen. Wir alle mussten Einschränkungen hinnehmen und viele mussten durch die Lockdowns um ihre Existenz fürchten und einigen hat es diese sogar gekostet. Viele Menschen haben unter dem Virus körperlich gelitten und viele sind auch daran gestorben. Unser Leben hat in dieser Zeit viele unserer Pläne zerstört. Diese Zeit macht uns Angst. Im kirchlichen Leben dürfen wir nicht mehr singen, unsere festlichen Gottes- dienste an Ostern und Weihnachten nicht so feiern wie gewohnt, wenige Taufen und die meisten Hochzeiten wurden in der Hoffnung auf das Ende der Corona- zeit, verschoben. Doch unsere Toten haben wir beerdigt. Beim Tod gibt es kein Verschieben und auch kein Vertrösten. Er ist endgültig. Das wussten auch die Jünger Jesu, als ihnen klar wurde, dass er der Hinrichtung am Kreuz auf Golgotha nicht mehr entgehen konnte. Endgültig waren die Jünger auch in ihrer Enttäuschung und in ihren Träumen von dem Jesus, der sie erretten wird. Desillusioniert gingen sie nach Hause, mit dem Ziel, wieder in ihren Alltag als Fischer oder Handwerker in ihre Dörfer zurückzukehren. Ihnen war bestimmt auch bewusst, dass sie sich viele Fragen und Vorwürfe der anderen anhören müssen. Umso überraschter und erschrockener haben sie auf die Aussage der Frauen, dass das Grab leer sei, reagiert. -

Ausgabe 47/2020 Wir Lieben Karneval …
PA sämtl. HH MITTEILUNGSBLATT FÜR DEN BEREICH DER Verbandsgemeinde Daun GESUNDLAND VULKANEIFEL WOCHENBLATT MIT AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN MODERN . GESUND . INNOVATIV Jahrgang 49 Freitag, den 20. November 2020 Ausgabe 47/2020 Wir lieben Karneval … Aber auch wir müssen uns der aktuellen Situation ... und haben stellen und in der daher die kommenden Session 2020/21 letzten Jahre auf öffentliche Vereins- bzw. Jahrzehnte veranstaltungen verzichten. kräftig mit euch gefeiert, geschunkelt und gelacht. Mit der Aktion „Eifel Karneval Digital“ werden wir in der Ganz 5. Jahreszeit ohne unser bei euch sein. Brauchtum Schaut auf Karneval? www.eifel-karneval-digital.de Nein, das geht oder den sozialen Netzwerken dann doch nicht. wie es weiter geht und lasst euch überraschen! Die teilnehmenden Vereine: KV Dockweiler Dauner Narrenzunft e.V. KV Kirchweiler Beuelspatzen e.V. Karnevalsverein Mehren e.V. KV Moareulen Üdersdorfer Aarleyspatzen e.V. Gillenfeld Daun - 2 - Ausgabe 47/2020 Bereitschaftsdienste in der Corona-Krise: Corona-Ambulanz Vulkaneifel - Standort Daun 0151 701 881 39 Hinweis zu Textveröfentlichungen E-Mail: corona-ambulanz-daun@gmxde während der Corona-Pandemie Zugang nur nach vorheriger Terminvereinbarung Corona- und Infekt-Praxis Daun (CIPD) An alle Einsender von Artikeln! der BAG Drs med Pitzen, Trierer Straße 12, Daun Aufgrund der immer noch akuten Lage, bitten wir Sie ein- Tel 0151 269 407 34 dringlich den Umfang Ihrer Textbeiträge auf das Nötigste zu Ärztlicher Bereitschaftsdienst beschränken und auf umfangreiche Berichterstattungen zu - wenn Hausbesuch erforderlich ist - verzichten. Wir geben unser Bestes Tel 116 117 das Erscheinen aller Amts- und Mitteilungsblätter auch weiter- 24-Stunden-Hotline hin sicherzustellen und zählen hierbei auf Ihre Mithilfe! Beratung und Weiterleitung zu Fieberambulanz/Corona-Test Wir bitten um Verständnis, sollten Texte nicht in dem einge- bei typischen Symptomen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Muskel- sandten Umfang veröfentlicht werden. -

Flyer Ortsgemeinde Bodenbach.Pdf
Geschichtsstraße rund um den i 46 Stationen, Gesamtstrecke 38 km, teilbar in 4 Abschnitte Start/Ziel: Kelberg/Kelberg Streckenlänge: 38 km Dauer: 12 - 16 Stunden Orte: Kelberg, Zermüllen, Rothenbach, Meisenthal, Bodenbach, Bongard, Die 7 Schmerzen - am Gelenberg Ortsrand aus Richtung Bongard kommend. Bodenbach Ortsgemeinde Unser Kinderspielplatz ist einer der beliebtesten Bodenbach verfügt über eine besonders auff ällige, drei-türmige in der Umgebung. Viele Kinder aus Nah und Fern Kirche, die auch als Symbol im Wappen vorhanden ist. Sie steht kommen hierher, um mit Jung und Alt zu spielen. nicht nur mitten im Ort, sondern bildet auch den Mittelpunkt Durch Eigenleistungen und mit fi nanzieller Hilfe der unserer Gesellschaft, woraus viele Veranstaltungen sowie unser Ortsgemeinde und der RWE Aktiv vor Ort ist unser Brauchtum hervorgehen. Kinderspielplatz stets erweitert worden und ist auch technisch auf dem neusten Stand. www.bodenbach-eifel.de Hier fi nden Sie viele weitere und spannende Informationen rund um unsere schöne Ortsgemeinde. Beschilderung und Infotafel vor Ort. Ortsbürgermeister Thorsten Krämer Ein idyllischer Ort im Herzen Kirchstr. 6 i❤ 53539 Bodenbach der wunderschönen Vulkaneifel. Bodenbach E-Mail: [email protected] » Breitbandversorgung: V DSL (50.000 KB/sec) Es ist überall der Empfang von schnellstem LTE vorhanden » Alle Einrichtungen sind barrierefrei » Förderprogramme "Drees" von Bodenbach wie Dorferneuerung und Vitalisierung Der Bodenbacher Drees gehört zu den vielen Kohlensäurequellen der Region. Die Umfassung ist aus einem einzigen Steinblock aus vulkani- Grillplatz genannt „Steinkaul“ » Baugrundstücke schem Tuff gestein gehauen. Wann und durch wen er eingefasst wurde ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dass schon die Römer solche Heilquellen Unsere Grillhütte befi ndet sich östlich von Bodenbach in einem kleinen, nutzten.