Entwurf Thüringer Kreisneugliederungsgesetz.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Thüringer CDU in Der SBZ/DDR – Blockpartei Mit Eigeninteresse
Bertram Triebel Die Thüringer CDU in der SBZ/DDR – Blockpartei mit Eigeninteresse Bertram Triebel Die Thüringer CDU in der SBZ/DDR Blockpartei mit Eigeninteresse Herausgegeben im Auftrag der Unabhängigen Historischen Kommission zur Geschichte der CDU in Thüringen und in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl von 1945 bis 1990 von Jörg Ganzenmüller und Hermann Wentker Herausgegeben im Auftrag der Unabhängigen Historischen Kommission zur Geschichte der CDU in Thüringen und in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl von 1945 bis 1990 von Jörg Ganzenmüller und Hermann Wentker Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Weiterverwertungen sind ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer- Stiftung e.V. unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme. © 2019, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin Umschlaggestaltung: Hans Dung Satz: CMS der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Druck: Kern GmbH, Bexbach Printed in Germany. Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland. ISBN: 978-3-95721-569-7 Inhaltsverzeichnis Geleitworte . 7 Vorwort . 13 Einleitung . 15 I. Gründungs- und Transformationsjahre: Die Thüringer CDU in der SBZ und frühen DDR (1945–1961) 1. Die Gründung der CDU in Thüringen . 23 2. Wandlung und Auflösung des Landesverbandes . 32 3. Im Bann der Transformation: Die CDU in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl bis 1961 . 46 II. Die CDU in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl – Eine Blockpartei im Staatssozialismus (1961–1985) 1. Die Organisation der CDU . 59 1.1. Funktion und Parteikultur der CDU . 60 1.2. Der Apparat der CDU in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl . 62 1.3. -

Deutsche Demokratische Republik Kennzeichen Mit Zwei Buchstaben
Deutsche Demokratische Republik Kennzeichen mit zwei Buchstaben Der komplette Kode der zweistelligen Buchstabenkombinationen mit Stand 31.05.1990 (Kennzeichen 1990) lautet Fahrzeugart (Fz-Art) Nummer Kräder, Motorroller, Kleinkrafträder 1 Personenkraftwagen 2 Kleinbusse, Busse, KOM 3 Lastkraftwagen 4 Traktoren, Zugmaschinen 5 Spezial-Kfz, Arbeitsmaschinen 6 Einachsanhänger 7 Mehrachsanhänger 8 Bezirk Chemnitz s. Bezirk Karl-Marx-Stadt Bezirk Cottbus Von Bis Fz-Art Auch für Fz-Art Kreis ZA 00-01 ZA 15-00 1 3-8 Forst ZA 00-01 ZA 10-15 2 - Luckau ZA 10-16 ZA 18-00 2 - Spremberg ZA 15-01 ZA 25-00 1 - Guben ZA 18-01 ZA 25-50 2 3-8 Hoyerswerda ZA 25-01 ZA 50-00 1 3-8 Hoyerswerda ZA 25-51 ZA 30-00 2 7 Weißwasser ZA 30-01 ZA 38-15 2 - Finsterwalde ZA 38-16 ZA 46-50 2 7 Liebenwerda ZA 46-51 ZA 52-20 2 - Herzberg ZA 50-01 ZA 71-00 1 - Lübben ZA 52-21 ZA 56-00 2 3-8 Jessen ZA 56-01 ZA 61-00 2 7 Weißwasser ZA 61-01 ZA 99-99 2 3-8 Hoyerswerda ZA 71-01 ZA 73-00 1 3-8 Hoyerswerda ZA 73-01 ZA 83-00 1 3-8 Calau Von Bis Fz-Art Auch für Fz-Art Kreis ZA 83-01 ZA 99-99 1 - Lübben ZB 00-01 ZB 20-00 2 7 Liebenwerda ZB 00-01 ZB 30-00 1 - Cottbus ZB 20-01 ZB 40-00 2 7 Calau ZB 30-01 ZB 60-00 1 - Senftenberg ZB 40-01 ZB 60-00 2 - Cottbus ZB 60-01 ZB 80-00 2 - Finsterwalde ZB 60-01 ZB 70-00 1 3-8 Calau ZB 70-01 ZB 85-00 1 - Luckau ZB 80-01 ZB 99-99 2 7 Forst ZB 85-01 ZB 99-99 1 5-8 Spremberg ZC 00-01 ZC 10-00 3-8 - Spremberg ZC 00-01 ZC 30-00 1 3-8 Hoyerswerda ZC 10-01 ZC 20-00 3-8 - Weißwasser ZC 20-01 ZC 30-00 3-8 - Herzberg ZC 30-01 ZC 40-00 3-8 - Jessen ZC -

Message from the New Chairman
Subcommission on Devonian Stratigraphy Newsletter No. 21 April, 2005 MESSAGE FROM THE NEW CHAIRMAN Dear SDS Members: This new Newsletter gives me the pleasant opportunity to thank you for your confidence which should allow me to lead our Devonian Subcommission successfully through the next four years until the next International Geological Congress in Norway. Ahmed El Hassani, as Vice-Chairman, and John Marshall, as our new Secretary, will assist and help me. As it has been our habit in the past, our outgoing chairman, Pierre Bultynck, has continued his duties until the end of the calendar year, and in the name of all the Subcommission, I like to express our warmest thanks to him for all his efforts, his enthusi- asm for our tasks, his patience with the often too slow progress of research, and for the humorous, well organized and skil- ful handling of our affairs, including our annual meetings. At the same time I like to thank all our outgoing Titular Members for their partly long-time service and I express my hope that they will continue their SDS work with the same interest and energy as Corresponding Members. The new ICS rules require a rather constant change of voting members and the change from TM to CM status should not necessarily be taken as an excuse to adopt the lifestyle of a “Devonian pensioner”. I see no reason why constantly active SDS members shouldn´t become TM again, at a later stage. On the other side, the rather strong exchange of voting members should bring in some fresh ideas and some shift towards modern stratigraphical tech- niques. -

Gesetz- Und Verordnungsblatt Für Den Freistaat Thüringen
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen 2018 Ausgegeben zu Erfurt, den 28. Dezember 2018 Nr. 14 Inhalt Seite 18.12.2018 Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Entwicklungsektorenübergreifen- der Versorgungsstrukturen .......................................................................................................... 729 18.12.2018 Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Förderung der Teilnahme an Früh- erkennungsuntersuchungen für Kinder .................................................................................... 730 18.12.2018 Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 (ThürVwRG 2018) ................................................... 731 18.12.2018 Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019) .......................................................................................................................... 795 18.12.2018 Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen ...................................................................................................................................... 813 18.12.2018 Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Thüringer Klimagesetz - ThürKlimaG -) ...................................................................................... 816 18.12.2018 Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes ....... 821 11.12.2018 Dritte Änderung des Beschlusses -

EICHSFELDER KESSEL NACHRICHTEN Wochenblatt AMTSBLATT Der Gemeinde Niederorschel
EICHSFELDER KESSEL NACHRICHTEN Wochenblatt AMTSBLATT der Gemeinde Niederorschel Entsprechend der Thüringer Bekanntmachungsverordnung - ThürBekVO - in der zur Zeit gültigen Fassung. Jahrgang 1 Freitag, der 20. November 2020 Nr. 46/2020 Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank- heiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) – (Sportbetrieb im Landkreis Eichsfeld) Der Landkreis Eichsfeld erlässt gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in Verbin- dung mit § 35 Satz 2 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) und § 13 der 2. Thür- SARS-CoV-2-IfS-GrundVO in der jeweils derzeit gültigen Fassung folgende Allgemeinverfügung: 1. Die Allgemeinverfügung zum Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions- krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 16.10.2020 (Amtsblatt 56/20) sowie die erste Änderung der Allgemeinverfügung des Landkreises Eichsfeld über infektionsschüt- zende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 vom 16.10.2020 (Jugendarbeit/Sportbetrieb) vom 29.10.2020 (Amtsblatt 59/20) werden aufgehoben. 2. Abweichend von § 6 Abs. 3 Nr. 4 Thüringer SARS-CoV-2-Sondereindämmungsmaßnahmenverord- nung ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO- in der Fassung der Fortschreibung vom 07. November 2020 wird der Trainingsbetrieb des organisierten Sportbetriebs von Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres untersagt. 3. Im Übrigen gelten die Vorschriften der 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO vom 7. Juli 2020 (GVBl. S. 349), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Oktober 2020 (GVBl. S. 544) und der ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO vom 31.10.2020 (GVBl. S. 547) in der jeweils gültigen Fassung. -

Palaeovolcanic and Present Magmatic Structures Along the N-S Trending Regensburg-Leipzig-Rostock Zone
Palaeovolcanic and present magmatic structures along the N-S trending Regensburg-Leipzig-Rostock zone kumulative Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften doctor rerum naturalium - Dr. rer. nat. vorgelegt dem Rat der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena von Diplom-Geophysiker Tobias Nickschick geboren am 18.11.1985 in Wernigerode Gutachter: 1. Prof. Dr. Lothar Viereck 2. Prof. Dr. Florian Bleibinhaus Tag der Veteidigung: 18.01.2017 Vorwort Diese Abschlussarbeit entstand während meiner Anstellung und Tätigkeit als wissenschaftlicher Mit- arbeiter in der Sektion 3.2 Organische Geochemie am Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoFor- schungsZentrum GFZ durch die Drittmittelfinanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG in einem gemeinsamen Projekt mit der Universität Leipzig. Diese kumulative Dissertation ist in zwei in sich geschlossene Teile aufgeteilt. Der erste Teil befasst sich mit dem übergreifenden Thema der Dissertation, der Regensburg-Leipzig-Rostock-Störungszone, der zweite Teil befasst sich mit den von meinen Coautoren und mir verfassten Fachpublikationen zu ausgewählten Einzefallbeispielen innerhalb des Gesamtrahmens. Um das Gesamtlayout dieser Dissertation nicht zu stören, werden die insgesamt vier Publikationen, von denen drei bereits publiziert sind und eine eingereicht ist, in einem separaten Teil zuammengefasst präsentiert, womit der Auflage der Promotionsordnung die Originalversionen der Publikationen zu prä- sentieren, erfüllt wird. Der erste Teil wurde von mir als alleinigem Autor verfasst, die Artikel, die im zweiten Teil zusammengefasst sind, entstanden in einem Autorenkollektiv. Die Anteile des jeweiligen Kollegen an der Erstellung der Publikationen sind im Anschluss an diese Arbeit zu finden. Da die Artikel sprachlich aufgrund des Autorenkollektivs auf die 1. Person Plural zurückgreifen, wird diese auch im ersten Teil verwendet. -
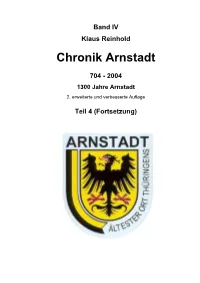
Chronik Band 4
Band IV Klaus Reinhold Chronik Arnstadt 704 - 2004 1300 Jahre Arnstadt 2. erweiterte und verbesserte Auflage Teil 4 (Fortsetzung) Hebamme Anna Kessel (Weiße 50) verhalf am 26.10.1942 dem viertausendstem Kind in ihrer langjährigen beruflichen Laufbahn zum Leben. 650 „ausgebombte“ Frauen und Kinder aus Düsseldorf trafen am 27.10.1942 mit einem Son- derzug in Arnstadt ein. Diamantene Hochzeit feierte am 28.10.1942 das Ehepaar Richard Zeitsch (86) und seine Ehefrau Hermine geb. Hendrich (81), Untergasse 2. In der Nacht vom Sonntag, dem 1. zum 2.11.1942, wurden die Uhren (um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr) um eine Stunde zurückgestellt. Damit war die Sommerzeit zu Ende und es galt wieder Normalzeit. Zum ersten Mal fand am 14.11.1942 in Arnstadt eine Hochzeit nach dem Tode statt. Die Näherin Silva Waltraud Gertrud Herzer heiratete ihren am 9.8.1941 gefallenen Verlobten, den Obergefreiten Artur Erich Hans Schubert mit dem sie ein Töchterchen namens Jutta (7 30.8.1939 in Arnstadt) hatte. Die Heirat erfolgte mit Wirkung des Tages vor dem Tode, also 8.8.1941. Die Tochter wurde „durch diese Eheschließung legitimiert“. 1943 Der Sturm 8143 des NS-Fliegerkorps baute Anfang 1943 auf dem Fluggelände Weinberg bei Arnstadt eine Segelflugzeughalle im Werte von 3500 RM. Die Stadt gewährte einen Zuschuß von 1000 RM und trat dem NS-Fliegerkorps als Fördermitglied mit einem Jahres- beitrag von 100,00 RM bei. Der fast 18-jährige Schüler Joachim Taubert (7 24.2.1925 in Arnstadt) wurde am 6.1.1943, 9.00 Uhr, in der Wohnung seiner Mutter, der Witwe Gertrud Elisabeth Taubert geb. -
![[Ausgabe 11] 23.06.2017](https://docslib.b-cdn.net/cover/5674/ausgabe-11-23-06-2017-435674.webp)
[Ausgabe 11] 23.06.2017
Amtsblatt 1 Ausgabe 11 (23.06.2017) - 27. Jahrgang Näheres dazu auf Seite 6! Stadt Artern Baumaßnahme in der Johannisstraße, Gemeinde Voigtstedt Nordhäuser Straße und Untere Magda- Allgemeinverfügung zur Widmung lenenstraße S. 5 der öffentlichen Gemeindestraße Am Bahnhof S. 5 Veranstaltungen und Informationen ab S. 6 Amtsblatt 2 AusgabeAusgabe 1101 (23.06.2017)(15.01.2016) - 27.26. Jahrgang Telefonnummern der Gemeinden der „VG Mittelzentrum Artern” Borxleben 0 34 66 / 31 99 01 u. 0174 / 6 27 45 49 Wichtige Telefonnummern Gehofen 0 34 66 / 33 94 98 u. 0172 / 3 56 78 27 ☎ Heygendorf 0 34 66 / 31 99 09 u. 0152 / 28 66 44 08 Ichstedt 0172 / 9 49 37 81 Kalbsrieth 0 34 66 / 30 22 22 Notrufe Mönchpfiffel/Nikolausrieth 03 46 52 / 2 13 Polizei ................................................................................ 3610/110 Nausitz 0 34 66 / 3 11 83 Feuerwehr .................................................................................... 112 Reinsdorf 0 34 66 / 3 35 30 Ringleben 0 34 66 / 30 22 37 Medizinischer Notdienst .........................................................116117 Notdienstsprechstunde: Voigtstedt 0 34 66 / 32 27 03 DRK-Manniske-Krankenhaus Bad Frankenhausen Mi, Fr: 16.00-19.00 Uhr Schiedsstelle der VG Mittelzentrum Artern, Sa, So, Feier- u. Brückentage, 24.12, 31.12.: 10.00-16.00 Uhr Brauereistraße 3 in 06556 Artern Notfalldienste Vorsitzender: Herr Wolfgang Körber, Rettungsleitstelle Nordhausen ......................... 03632/59330 od. 31 Walthergasse 10 in 06556 Kalbsrieth Tel.: 0 34 66 / 3 11 47 Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband ..... 0172/7985490 Stellvertreter: Herr Rainer Beie, Abwasserzweckverband, AZV ................................. 0172/8 66 35 18 Siedlung 233 b in 06556 Ichstedt Tel.: 0 34 66 / 32 29 68 envia Mitteldeutsche Energie AG .............................. 0800/2305070 Mitgas ..................................................................... -

Drucksache 18/13322 18
Deutscher Bundestag Drucksache 18/13322 18. Wahlperiode 15.08.2017 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tabea Rößner, Matthias Gastel, Stephan Kühn (Dresden), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 18/13203 – Breitbandausbau und Breitbandförderung in Deutschland Vorbemerkung der Fragesteller Ein schneller Internetanschluss ist heute Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und zudem ein wichtiger Standortfaktor. Junge Familien machen die Entscheidung für ihre Wohnortwahl inzwischen genauso von einer schnellen Internetanbindung abhängig wie Unternehmen die Standortwahl. Nicht nur vor diesem Hintergrund bleibt eine flächendeckende Versorgung mit leistungsfähi- gem Breitband eine zentrale Zukunftsaufgabe. Bei der Versorgung mit breitban- digem Internetanschluss gibt es bis heute große Lücken. Laut Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD soll es bis 2018 eine flächendeckende Versor- gung mit 50 Mbit geben. Von diesem selbstgestecktem Ziel ist die Bundesre- gierung aber noch weit entfernt: Ende 2016 waren laut Breitbandatlas erst 75,5 Prozent aller Haushalte mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s versorgt. Das Ziel der Bundesregierung ist aber insgesamt zu kurz gegriffen, denn es deu- tet sich schon jetzt an, dass die Bedarfe nach größeren Bandbreiten in naher Zukunft stark steigen werden und Eigenschaften wie die Uploadgeschwindig- keit oder eine geringe Latenz immer wichtiger werden. Die Bundesregierung scheint ihre Aktivitäten im Bereich des Ausbaus der digitalen Infrastruktur le- diglich dem Erreichen des bis zum Jahr 2018 ausgegebenen Ausbauziels unter- zuordnen. Dies gilt insbesondere für das Bundesförderprogramm für den Breit- bandausbau. In der Folge wird aus Sicht der Fragesteller in wenig zukunftsfeste Technologien wie Vectoring investiert, wobei auf der letzten Meile in absehba- rer Zeit weiter alte Kupferkabel verwendet werden. -

Der Gefährliche Weg in Die Freiheit Fluchtversuche Aus Dem Ehemaligen Bezirk Potsdam
Eine Publikation der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung Hannelore Strehlow Der gefährliche Weg in die Freiheit Fluchtversuche aus dem ehemaligen Bezirk Potsdam Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Außenstelle Potsdam Inhalt Vorwort 6 Kapitel 3 Fluchtversuche mit Todesfolge Quelleneditorische Hinweise 7 Fluchtversuch vom 22.11.1980 42 Kapitel 1 Ortslage Hohen-Neuendorf/Kreis Die Bezirksverwaltung Oranienburg der Staatssicherheit in Potsdam 8 Fluchtversuch vom 12.2.1987 52 Kapitel 2 im Bereich der Grenzübergangsstelle (GÜST) Der 13. August 1961 Rudower Chaussee – Mauerbau – 20 Fluchtversuch vom 7.2.1966 56 bei Staaken Quellenverzeichnis Kapitel 1 und 2 40 Fluchtversuch vom 14.4.1981 60 Bereich Teltow-Sigridshorst Quellenverzeichnis Kapitel 3 66 4 Kapitel 4 Kapitel 5 Gelungene Fluchtversuche Verhinderte Fluchtversuche durch Festnahmen Flucht vom 11.3.1988 68 über die Glienicker Brücke Festnahme vom 4.3.1975 102 an der GÜST/Drewitz Flucht vom 19.9.1985 76 im Grenzbereich der Havel Festnahme vom 27.10.1984 110 in der Nähe der GÜST/Nedlitz Flucht vom 4.1.1989 84 im Raum Klein-Ziethen/Kreis Festnahme vom 8.7.1988 114 Zossen in einer Wohnung im Kreis Kyritz 90 Flucht vom 26.7.73 Festnahme vom 8.6.1975 120 von 9 Personen durch einen Tunnel unter Schusswaffenanwendung im Raum Klein Glienicke an der GÜST/Drewitz Quellenverzeichnis Kapitel 4 101 Quellenverzeichnis Kapitel 5 128 Dokumententeil 129 Die Autorin 190 Impressum 191 5 Vorwort Froh und glücklich können wir heute sein, dass die Mauer, die die Menschen aus dem Osten Deutschlands jahrzehntelang von der westlichen Welt trennte, nicht mehr steht. -

Leinefelde-Worbis Leinefelde (A38) Breitenbacher Str
Landkreis Eichsfeld Grußwort Als Landrat des Landkreises Eichsfeld As the District Councillor for begrüße ich Sie herzlich. the Eichsfeld district, I would Die vorliegende Broschüre soll Ihnen like to welcome you. den Landkreis Eichsfeld in Deutsch- This brochure aims to provide lands Mitte als durchaus interessan- you with some interesting ten Wirtschafts- und Gewerbestand- information about the Eichsfeld ort vorstellen und Ihnen einen ersten district, which is located in Eindruck von seiner Attraktivität central Germany, and its vermitteln. attractiveness as an economic and commercial location. Sie sind im Landkreis Eichsfeld herzlich willkommen Welcome to the Eichsfeld district! Dr. Werner Henning Landrat Dr. Werner Henning District Councillor Eichsfelder Werkstätten e.V. Rinne 32 37308 Heiligenstadt Anerkannte Werkstatt für Tel. 03606 5906-0 Menschen mit Behinderung Fax 03606 590660 Förderbereich für E-Mail: schwerbehinderte Menschen [email protected] Internet: Raphaelsheim gGmbH www.eichsfelder-werkstaetten.de Wohnheime für Menschen mit Behinderung Tagesstätte für Menschen Angebote für Menschen mit psychischer Erkrankung mit geistiger Behinderung Betreutes Wohnen für Angebote für Menschen Menschen mit Behinderung mit psychischer Erkrankung Seniorenwohnen gGmbH Angebote für Menschen Regia mit sozialen Beeinträchtigungen Der Partner für Menschen mit Handicap Landkreis Eichsfeld Hauptsitz Heilbad Heiligenstadt Außenstelle Leinefeld-Worbis Inhalt ... Allgemeines ... General Der Landkreis Eichsfeld stellt sich vor ..........................................................4 -
![[Ausgabe 10] 24.08.2018](https://docslib.b-cdn.net/cover/6801/ausgabe-10-24-08-2018-836801.webp)
[Ausgabe 10] 24.08.2018
Ausgabe 10 (24.08.2018) –28. Jahrgang Jahre alt 200 r 1 be Ü tern Ar der Stadt Artern und der Gemeinden Borxleben, Gehofen, Heygendorf, Ichstedt, Kalbsrieth, Mönchpfiffel-Nikolausrieth, Nausitz, Reinsdorf, Ringleben und Voigtstedt Amtsblatt-2- Ausgabe 10 (24.08.2018)–28. Jahrgang Telefonnummern der Gemeinden der „VGMittelzentrum Artern“ Borxleben .............................................................................03466/319901 WichtigeTelefonnummern Gehofen ..................................................03466/339498u.0172 /3567827 ( Heygendorf.........................................03466/319909u.0152 /28664408 Ichstedt ..................................................................................0172 /9493781 Kalbsrieth .............................................................................03466/302222 Mönchpfiffel /Nikolausrieth .......................................................034652/213 Notrufe Nausitz ....................................................................................03466/31183 Polizei ......................................................................................36 10 /110 Reinsdorf ................................................................................03466/33530 Feuerwehr............................................................................................112 Ringleben .............................................................................03466/302237 Medizinischer Notdienst ...............................................................11 61 17 Voigtstedt