Schmetterlingen Aus Vorarlberg, Austria Occ. (Lepidoptera)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
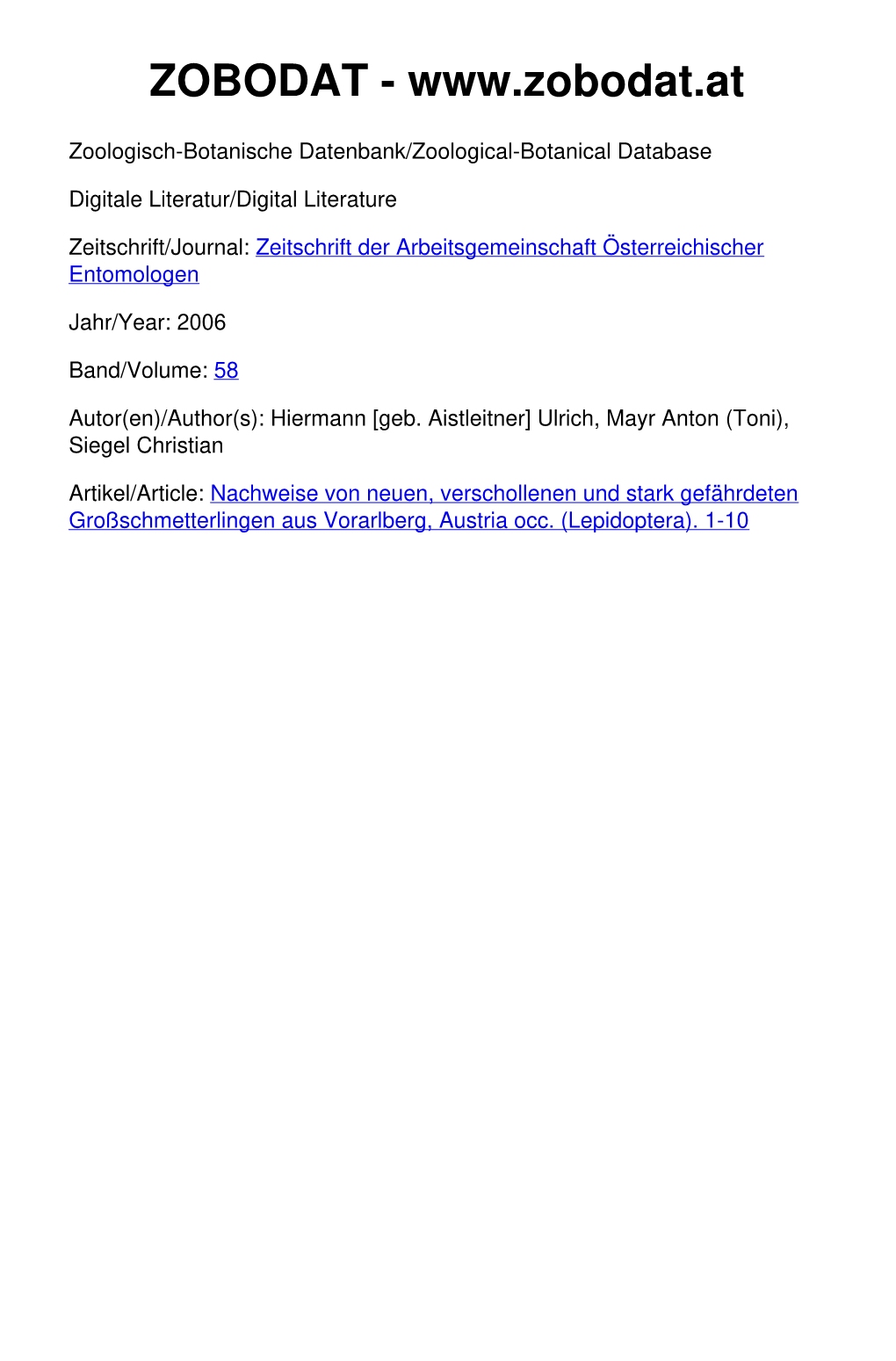
Load more
Recommended publications
-

E-Acta Natzralia Pannonica
e ● Acta Naturalia Pannonica e–Acta Nat. Pannon. 5: 39–46. (2013) 39 Hungarian Eupitheciini studies (No. 2) Records from Nattán’s collection (Lepidoptera: Geometridae) Imre Fazekas Abstract: Data on 37 species collected in Hungary are given. Additional data on faunistics, taxonomy and zoogeography of cer- tain species are provided by the author, with comments. Figures of the genitalia of some species are included. With 18 figures. Key words: Lepidoptera, Geometridae, Euptheciini, distribution, biology, Hungary. Author’s address: Imre Fazekas, Regiograf Institute, Majális tér 17/A, H-7300 Komló, Hungary. Introduction A detailed account of the Eupitheciini species in 20% KOH solution. Genitalia were cleaned and Hungary has been given in five previous works dehydrated in ethanol and mounted in Euparal (Fazekas 1977ab, 1979ab, 1980, 2012). To date 64 between microscope slides and cover slips. Illus- Hungarian Geometridae, tribus Eupitheciini are trations of adults were produced by a multi-layer known. technique using a Sony DSC HX100V with a 4x Present paper contains faunistical data of the Macro Conversion Lens. The photographs were Eupitheciini specimens in the Nattán collection (in processed by the software Photoshop CS3 version. coll. Janus Pannonius Museum, H-Pécs) that col- The genitalia illustrations were produced in a sim- lected outside of the South Transdanubia. ilar manner with multi-layer technique, using an- Miklós Nattán (1910–1970) was an amateur lep- other digital camera (BMS tCam 3,0 MP) and a idopterist who, over nearly six decades, made one XSP-151-T-LED Microscope with a plan lens 4/0.1 of the most significant private collections of Lepi- and 10/0.25. -

Recerca I Territori V12 B (002)(1).Pdf
Butterfly and moths in l’Empordà and their response to global change Recerca i territori Volume 12 NUMBER 12 / SEPTEMBER 2020 Edition Graphic design Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis Mostra Comunicació Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Museu de la Mediterrània Printing Gràfiques Agustí Coordinadors of the volume Constantí Stefanescu, Tristan Lafranchis ISSN: 2013-5939 Dipòsit legal: GI 896-2020 “Recerca i Territori” Collection Coordinator Printed on recycled paper Cyclus print Xavier Quintana With the support of: Summary Foreword ......................................................................................................................................................................................................... 7 Xavier Quintana Butterflies of the Montgrí-Baix Ter region ................................................................................................................. 11 Tristan Lafranchis Moths of the Montgrí-Baix Ter region ............................................................................................................................31 Tristan Lafranchis The dispersion of Lepidoptera in the Montgrí-Baix Ter region ...........................................................51 Tristan Lafranchis Three decades of butterfly monitoring at El Cortalet ...................................................................................69 (Aiguamolls de l’Empordà Natural Park) Constantí Stefanescu Effects of abandonment and restoration in Mediterranean meadows .......................................87 -

Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini) Teil 6: Vorkommen Und Verbreitung 163-222 Dortmunder Beitr
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Dortmunder Beiträge zur Landeskunde Jahr/Year: 2003 Band/Volume: 36-37 Autor(en)/Author(s): Weigt Hans-Joachim Artikel/Article: Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini) Teil 6: Vorkommen und Verbreitung 163-222 Dortmunder Beitr. Landeskde. naturwiss. Mitt. 36/37 163-222 Dortmund, 2003 Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini) Teil 6: Vorkommen und Verbreitung Hans Joachim WEIGT, Schwerte Einlegung Obwohl die Blütenspanner zweifellos zu den interessanteren Schmetterlingsarten zählen, gibt es leider nicht allzu viele Spezialisten, die ihnen eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Attraktive und bunte Schmetterlingsarten sind selbst in den Tropen besser erforscht als die mitteleuropäischen Blütenspanner. Unscheinbare Nachtschmetterlinge hingegen, wurden sicherlich auch früher wegen der Determinationsprobleme nicht von allen Entomologen rich tig und vollständig erfasst. Bei den Blütenspannern kommt noch erschwerend hinzu, dass selbst soeben geschlüpfte Ima gines oft schwer zu determinieren sind, von stark abgeflogenen ganz zu schweigen. Sie be reiten auch erfahrenen Spezialisten so manches Problem. Vielfach hilft dann nur noch die Ge nitalanalyse. So werden auch heute noch beim Beobachten von Nachtschmetterlingen die Blüter spanner meist vernachlässigt. In vielen Fundortkarteien und Faunenverzeichnissen feh len dann die Arten, die nicht sicher angesprochen wurden. Oder, was viel schlimmer ist, Da ten von Fehlbestimmungen wandern in die Kartei und verbleiben dort. Oftmals fehlt der dazu gehörige Falter in der Sammlung, weil er für diese nicht schön genug war. Wer will dann später beurteilen können, ob dieser Fund echt war? Bei manchem Beobachter ist es nicht Stand der Arbeitstechnik, Genitaldiagnosen durchzuführen. Auch fehlen häufig Daten von Imagines, weil bestimmte Arten nur selten oder gar nicht am Licht erscheinen, obwohl sie Vorkommen. -

Az Eupitheciini Tribusz a Kárpát-Medencében a Magyar Természettudományi Múzeum Lepkegyűjteménye Alapján (Lepidoptera: Geometridae: Larentiinae)
DOI: 10.20331/AllKoz.2019.104.1-2.17 ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2019) 104(1–2): 17–237. Az Eupitheciini tribusz a Kárpát-medencében a Magyar Természettudományi Múzeum lepkegyűjteménye alapján (Lepidoptera: Geometridae: Larentiinae) 1* 1 2 1 TÓTH BALÁZS , KATONA GERGELY , SULYÁN PÉTER GÁBOR és BÁLINT ZSOLT 1Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, 1088 Budapest, Baross utca 13. 2Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztály, 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9. *E-mail: [email protected] Összefoglalás. A Magyar Természettudományi Múzeum Kárpát-medencei Eupitheciini-gyűjteményét újra rendeztük. A régebbi törzsgyűjteményből és a beosztatlan anyagból összesen 81 faj 16571 példá- nya került elő, melyek mindegyikét meghatároztuk vagy határozását ellenőriztük, egyedi katalógus- számmal láttuk el, és adataikat adatbázisban rögzítettük. Külön felsoroljuk a példányok gyűjtőit. A tételes lelőhelyadatokat közöljük, továbbá minden faj lelőhelyeit ponttérképeken is ábrázoljuk. Rövid, határozást segítő diagnózist adunk mindegyik fajhoz, továbbá hivatkozunk a főbb magyar nyelvű ösz- szefoglaló faunisztikai művekben, illetve határozókönyvekben történő említésükre. Áttekintjük a mú- zeum gyűjteményében őrzött típuspéldányokat (13 taxon 54 példánya). Megállapítottuk, hogy a Tephroclystia graphata ab. brunnea ABAFI-AIGNER, 1906 az Eupithecia graphata (TREITSCHKE, 1828) új szinonimja, az Eupithecia inturbata clujensis DRAUDT, 1933 az Eupithecia inturbata (HÜBNER, 1807) új szinonimja, és a Tephroclystia isogrammaria transsylvanaria DANNEHL, 1933 az Eupithecia -

Mise En Page 1
6 ACTUALITÉ oreina n° 8 - janvier 2010 Eupith ecia we issi Prout, 1938, et ses premiers états / and the early stages (Lep. Geometridae Larentiinae) VLADIMIR MIRONOV & C LAUDE TAUTEL Résumé : La rencontre inopinée d’un spécimen d’ E. weissi , Summary: The unexpected discovery of a specimen of élevé par H. Powell et conservé au musée de Budapest, puis E. weissi , bred by H. Powell and held in the Budapest la collaboration des deux auteurs permettent de découvrir la museum, together with the collaboration of the authors has plante-hôte de cette espèce en France et de révéler ses pre - led to the discovery of the foodplant for this species in France miers états. and revealed the early stages. Mots clés : Eupithecia , weissi , barbaria , africae , pauxillaria , Keywords : Eupithecia, weissi, barbaria, africae, pauxillaria, euphrasiata , premiers états, Bupleurum , rigidum , Ormenis , euphrasiata, early stages, Bupleurum rigidum, Ormenis, Artemisia alba , Alpilles, France, Espagne, Maroc, Algérie, Artemisia alba , Alpilles, France, Spain, Morocco, Algeria, Buplèvre raide. Hare’s-Ears. ►EUPITHECIA WEISSI PROUT, 1938 ►EUPITHECIA WEISSI PROUT, 1938 Il existe encore de nombreux papillons de notre faune dont There remain a number of lepidoptera in our fauna about which nous ne savons à peu près rien. Dans le genre Eupithecia , il we know just about nothing. In the genus Eupithecia , the early reste encore à découvrir les premiers états de plusieurs es - stages of a number of species remain to be discovered. Eupi - pèces. Eupithecia weissi fait partie de ce cortège des « pres- thecia weissi belongs to the group of “almost unknowns”. It que inconnues ». Elle fut confondue avec pauxillaria à Fig. -

Estudi Sobre La Biodiversitat Invertebrada De Rubí (Lepidòpters, Ortòpters, Heteròpters I Coleòpters)
Estudi sobre la Biodiversitat invertebrada de Rubí (Lepidòpters, Ortòpters, Heteròpters i Coleòpters) (Informe any 2020) Diego Fernández Ruiz. DIEGO FERNANDEZ (2020) 1 -Index -Introducció .......................................................................Pàg 3. -Objectius ...........................................................................Pàg 5. -Zona d’estudi ....................................................................Pàg 6. -Material i mètodes .............................................................Pàg 9. -Catàleg de la Biodiversitat invertebrada de Rubí (lepidòpters, heteròpters, ortòpters i coleòpters) ........................................................Pàg 13. -Llista comentada de les espècies més interessants d’invertebrats de Rubí ...............................................................................................Pàg 80. -Recomanacions de gestió per afavorir als invertebrats del municipi de Rubí ...............................................................................................Pàg 86. -Recomanacions i mesures per afavorir a la Biodiversitat invertebrada al municipi de Rubí .................................................................Pàg 89. -Agraïments ..........................................................................Pàg 91. DIEGO FERNANDEZ (2020) 2 -Introducció Aquest treball dut a terme durant l’any 2020, ha sigut pioner sens dubte, dins del municipi de Rubí. Mai s’havia fet un estudi tant exhaustiu com aquest, on els protagonistes fossin els invertebrats (artròpodes). -

Contributo Alla Conoscenza E Distribuzione Della Sottofamiglia
Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna Quad. Studi Nat. Romagna, 49: 67-114 (giugno 2019) ISSN 1123-6787 Gabriele Fiumi & Guido Govi Contributo alla conoscenza e distribuzione della sottofamiglia Larentinae, tribù Eupitheciini, in Romagna (Insecta: Lepidoptera: Geometridae: Larentinae: Eupitheciini) Abstract [A contribution to the knowledge and distribution of the subfamily Larentinae, tribus Eupitheciini, in Romagna (Insecta: Lepidoptera: Geometridae: Larentinae: Eupitheciini)] In this paper the biogeographic knowledge for Romagna of the tribe Eupitheciini (Geometridae, Larentinae) is updated. 48 species are recorded from the area. For each of them distributional data, general remarks and faunistic observations are supplied. Eupithecia pyreneata Mabille 1871, E. unedonata Mabille, 1868 and E. satyrata (Hübner, 1813) are recorded for the first time from Romagna. Furthermore, the presence in Romagna of Pasiphila debiliata (Hübner, 1817) is confirmed: all previous records of the species from this area were due to misidentifications. Key words: Larentinae, Eupithecini, distribution, checklist, Romagna,. Riassunto Il presente lavoro aggiorna le conoscenze biogeografiche sulla tribù Eupitheciini (Geometridae, Larentinae) che conta in Romagna 48 specie di cui si riportano i dati distribuzione, oltre a notizie generali ed a considerazioni faunistiche. Sono citate per la prima volta per la Romagna Eupithecia pyreneata Mabille 1871, E. unedonata Mabille, 1868, E. satyrata (Hübner, 1813). Viene inoltre confermata la presenza in Romagna di Pasiphila debiliata (Hübner, 1817), specie per la quale le precedenti citazioni per la Romagna erano dovute ad errore di determinazione. Introduzione Gli autori svolgono ricerche sulla Lepidotterofauna della Romagna geografica da oltre 40 anni. I risultati di questa lunga attività sono stati esposti in diversi contributi fra cui si segnalano fra i primi “I Macrolepidotteri. -

Data to the Knowledge of the Macrolepidoptera Fauna of the Sălaj-Region, Transylvania, Romania (Arthropoda: Insecta)
Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii Vol. 26 supplement 1, 2016, pp.59- 74 © 2016 Vasile Goldis University Press (www.studiauniversitatis.ro) DATA TO THE KNOWLEDGE OF THE MACROLEPIDOPTERA FAUNA OF THE SĂLAJ-REGION, TRANSYLVANIA, ROMANIA (ARTHROPODA: INSECTA) Zsolt BÁLINT*, Gergely KATONA, László RONKAY Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum ABSTRACT. We provide 984 data of 88 collecting events originating from the Sălaj-region of western Transylvania, Romania. These have been assembled in the period between 22. April, 2014 and 10. September, 2015. Geographical, spatial and temporal records to the knowledge of 98 butterflies (Papilionoidea) and 225 moths (Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Noctuoidea and Sphingoidea) are given representing the families (species numbers in brackets) Hesperiidae (8), Lycaenidae (28), Nymphalidae (28), Papilionidae (3), Pieridae (13) Riodinidae (1), Satyridae (17) (Papilionoidea); Arctiidae (11), Ctenuchidae (1), Lymantriidae (1), Noctuidae (119), Nolidae (2), Notodontidae (6) Thyatiridae (4), (Noctuoidea); Drepanidae (3) (Drepanoidea); Geometridae (73) (Geometroidea); Lasiocampidae (2), Saturniidae (1) (Bombycoidea); Sphingidae (2) (Sphingoidea). According to the most recent catalogue of the Romanian Lepidoptera fauna 31 species proved to be new for the region Sălaj. The following 43 species have faunistical interest, therefore they are briefly annotated: Agrochola humilis, Agrochola laevis, Aplocera efformata, Aporophila lutulenta, Atethmia centrago, Bryoleuca -

Download (9MB)
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyóirata Alapítva 1902 Szerkeszti DÁNYI LÁSZLÓ 104(1–2). kötet MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG Budapest 2019 ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyóirata 104(1–2). kötet MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG Budapest 2019 Szerkesztő Editor DÁNYI LÁSZLÓ Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, 1088 Budapest, Baross u. 13. E-mail: [email protected] Szerkesztőbizottság Editorial Board Dévai György Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Dózsa-Farkas Klára Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. Farkas János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. Györffy György Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Hornung Erzsébet Állatorvostudományi Egyetem, Ökológiai Tanszék, 1077 Budapest, Rottenbiller u. 50. Kontschán Jenő Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet, Állattani Osztály, 1525 Budapest, Pf. 102. Korsós Zoltán Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, 1088 Budapest, Baross u. 13. Majer József Pécsi Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7601 Pécs, Ifjúság útja 6. Vásárhelyi Tamás Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, 1088 Budapest, Baross u. 13. Zboray Géza Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatszervezettani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. A kötet kéziratait lektorálták: Ábrahám Levente, Murányi Dávid, Pfliegler Valter Péter, Ronkay László Az Állattani Közlemények bejegyzett a Magyar Tudmományos Művek Tárában (MTMT) valamint a REAL J-ben és az EBSCO-ban archivált. Állattani Közlemények is indexed in Magyar Tudmományos Művek Tára (MTMT) and archived in REAL J and EBSCO. © Magyar Biológiai Társaság Hungarian Biological Society, 1088 Budapest, Baross u. 13. A kiadásért felel a Magyar Biológiai Társaság. -

Hors Série Numéro 1
Octobre 2010 Les Cahiers du Musée des Confluences Si conserver les collections est une activité fondamentale d'un musée, assurer leur valorisation en est un devoir. L’étude documentaire des collections, conduite en interne ou en partenariat, ou encore les études scientifiques menées par des chercheurs extérieurs, aboutissent généralement à des publications qui participent de cette valorisation. La série « Études scientifiques » des Cahiers du Musée des Confluences permet, notamment, de rendre compte de ces travaux. Études Scientifiques n°1 Volume 5 : Études Scientifiques n°1 Prix : 9,50 € N°ISSN : 1966-6845 Revue thématique Sciences et Sociétés du Musée des Confluences Cahiers du Musée des Confluences Sommaire Éditorial 3 Bruno JACOMY In memoriam 5 Roland BÉRARD Les Macrohétérocères de la Région Rhône-Alpes 9 Roland BÉRARD, Jacques BORDON, Claude COLOMB, Michel SAVOUREY, Cédric AUDIBERT, Yves ROZIER, Joël CLARY Egregia marpessa : nouveau genre et nouvelle espèce de Fulgoridae de Bornéo (Hemiptera : Fulgoromorpha) 43 Steven CHEW KEA FOO, Thierry PORION & Cédric AUDIBERT Cinq nouveaux Fulgoridae asiatiques (Hemiptera : Fulgoromorpha) 51 Steven CHEW KEA FOO, Thierry PORION & Cédric AUDIBERT Étude des espèces d'Élatérides décrites par Mulsant et al., désignation des lectotypes, changements de statut et de combinaison (Coleoptera : Elateridae) 65 Par Lucien LESEIGNEUR LES CAHIERS DU MUSÉE DES CONFLUENCES ÉTUDES SCIENTIFIQUES N°1 1 LES CAHIERS DU MUSÉE DES CONFLUENCES 2 ÉTUDES SCIENTIFIQUES N°1 Éditorial Avec ce premier numéro des Études scientifiques, le Musée des Confluences renoue avec une tradition, aussi ancienne qu’essentielle, de l’institution. S’inscrivant dans la lignée des Archives du Muséum, des Cahiers Scientifiques et des plus récents Cahiers du Musée des Confluences, cette nouvelle série vient rendre compte de la vie et du travail, souvent souterrains et parfois méconnus du grand public, que mènent les chercheurs sur les collections importantes et diverses du Musée des Confluences. -

Významné Nálezy Motýlů (Lepidoptera) V Národním Parku Podyjí a Jeho Nejbližším Okolí
THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: 249–286. ISSN 1212-3560 VÝZNAMNÉ NÁLEZY MOTÝLŮ (LEPIDOPTERA) V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ A JEHO NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ SIGNIFICANT RECORDS OF BUTTERFLIES AND MOTHS (LEPIDOPTERA) IN THE PODYJÍ NATIONAL PARK AND ITS VICINITY Jan Šumpich Biologické centrum AV ČR – Entomologický ústav, Branišovská 31/1160, 370 05 České Budějovice; [email protected] Abstract: 126 altogether rare and sporadically occurring species of moths in the territory of the Podyjí National Park have been noted. The occurrence of 29 of them has been published from this area for the fi rst time. The faunistic details on Nemapogon ruricolellus and Iwaruna klimeschi are given from the Czech Republic for the fi rst time. Key words: Lepidoptera, faunistics, zoogeography, Podyjí National Park, Czech Republic ÚVOD Oblast středního Podyjí, z níž přírodovědecky nejcennější část je od roku 1991 chráněna statutem Národního parku Podyjí, patří bezesporu k přírodovědecky nej- hodnotnějším oblastem České republiky. Přesto není dostupných faunistických údajů k výskytu druhů z řádu motýlů v oblasti příliš mnoho, navíc se prakticky výhradně týkají pouze menší části motýlí fauny (denní motýli, můry a píďalky), viz soupis stěžejních zdrojů v práci KRAMPLA, MARKA (2001) a MARSOVÉ (2004). Ostatní sku- piny motýlů, především ze skupiny tzv. Mikrolepidoptera (cca dvě třetiny druhové bohatosti řádu), zůstávají dosud mimo pozornost většiny autorů. Na tuto skutečnost upozorňuje i VÍTEK (2001), který na základě nepublikovaných hlášení externích spo- lupracovníků uvádí (nikoliv však jmenovitě) 490 těchto druhů (cca 23 % české fau- ny), zatímco ze skupiny tzv. velkých druhů motýlů uvádí 931 druhů (cca 75 % české fauny). Z tohoto počtu je 885 druhů uvedeno jmenovitě již v předchozí práci VÍTKA (1998). -

169 Die Macrolepidoptera Der Majella (Abruzzen, Italien
Fragmenta entomologica, Roma, 44 (2): 169-265 (2012) DIE MACROLEPIDOPTERA DER MAJELLA (ABRUZZEN, ITALIEN). TEIL 2: DREPANIDAE UND GEOMETRIDAE (Lepidoptera) NORBERT ZAHM (*) VORWORT Während Urlaubsaufenthalten an der abruzzesischen Küste in den Jahren 1973 und 1979 wurden auch einige Exkursionen zum Ma- jella-Massiv durchgeführt, bei denen die Schönheit des Gebirges und sein Reichtum an Lepidopteren begeisterten. Diese Begeisterung und die Tatsache, dass Entomologen bis dahin die Majella nur sporadisch aufgesucht hatten und eine umfassende Bearbeitung fehlte, führten zu dem Entschluss, das Gebiet intensiv zu untersuchen. Damit sollte auch ein Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidoptera Mittelitaliens ge- leistet werden. Der erste Teil der ’Macrolepidoptera der Majella‘ erschien 1999 unter dem Titel ’Zusammenhänge zwischen Arealsystemen, vertikaler Verbreitung und Habitatbindung von Faunenelementen am Beispiel der Rhopalocera (Lepidoptera) der Majella (Apennin)‘, in italienischer Aus- gabe dann 2007 unter den Titel ’Biogeografia dei Lepidotteri (Rhopalo- cera) della Majella‘. In diesem zweiten Teil werden nun die beiden Fami- lien Drepanidae (Thyatirinae und Drepaninae) und Geometridae behan- delt. Dabei geht es im Wesentlichen um das Vorkommen dieser Arten, ihre Verbreitung im Untersuchungsgebiet und die beobachtete Flugzeit und Aktivitätszeit. Es wird damit das Ergebnis einer rund dreißigjährigen Feldarbeit vorgestellt. Sie begann für diese Gruppe 1979 als Nebenpro- dukt der Tageserfassungen der Rhopalocera. Ab 1982 wurde dann auch intensiv nachts untersucht mit Hilfe von Lichtquellen bis einschließlich (*) Ludwig-Uhland. Str., 34 - D-66839 Schmelz, Deutschland. E-mail: [email protected] 169 2011, wobei fast immer eine Leuchtapparatur eingesetzt wurde, bei der man aktiv beobachten musste. Auf eine Lichtfalle wurde weitestgehend verzichtet, obwohl diese unter Umständen auch die eine oder andere Art zusätzlich erbracht hätte, vor allem Tiere mit sehr später nächtlicher Flugaktivität.