Masterarbeit / Master's Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
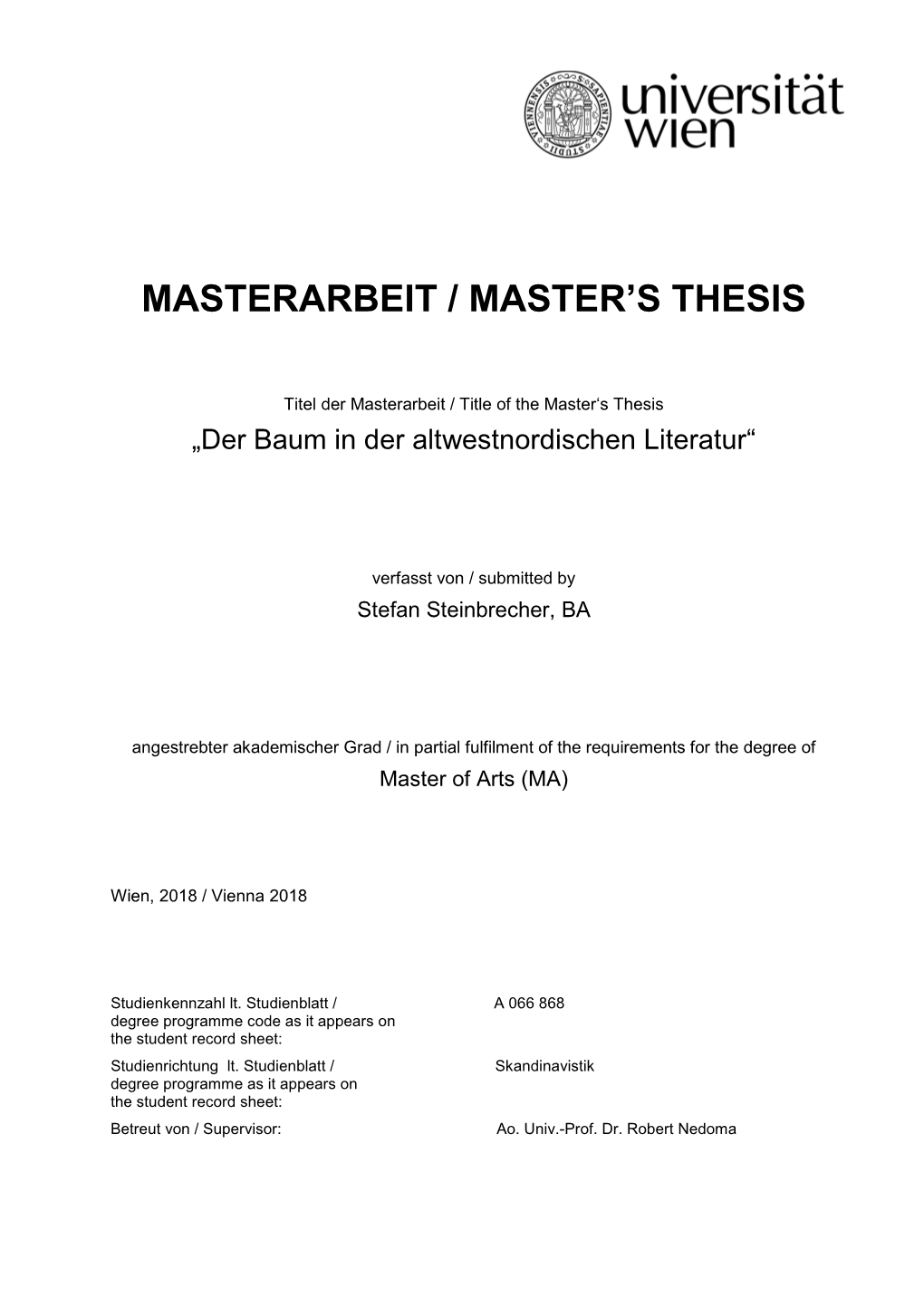
Load more
Recommended publications
-

Ordbog Over Det Norrøne Prosasprog
Ordbog over det norrøne prosasprog © 2004 Den arnamagnæanske kommission Sats: ONP & UNI·C Skrift: Monotype Plantin Tryk: Grafisk Data Center A/S, Odense ISBN: 87-7001-285-7 Ordbog over det norrøne prosasprog ONP 1-3 : Nøgle // Key Redigeret af Helle Degnbol, Bent Chr. Jacobsen, James E. Knirk, Eva Rode, Christopher Sanders, Þorbjörg Helgadóttir Udgivet af Den arnamagnæanske kommission København 2004 Foreword The principal aid to Ordbog over det norrøne prosasprog // A Dictionary of Old Norse Prose (ONP 1 : a-bam, ONP 2 : ban-da, ONP 3 : de-em) is the volume of indices (ONP : Registre // Indices,1989). In the present booklet (ONP 1-3:Nøgle//Key) there is a short user’s guide in Danish and English, corrections and additions to the volume of indices (Sigla, Medieval Manuscripts), the most important corrections to ONP 1-3,acompletebibliographytoalltheONPvolumes,and a revised list of abbreviations and symbols. This booklet is therefore a complete replacement of the previous booklets, which can be discarded. ONP’s website (www.onp.hum.ku.dk) gives access to an electronic version of parts of the present booklet (Vejledning // User’s Guide, Bibliografi // Bibliography and Forkortelser & symboler // Abbreviations & Symbols). ONP’s indices (Sigla and Medieval Manuscripts) are also available on the website, and these are regularly updated. ONP’s postal address is: Ordbog over det norrøne prosasprog Københavns universitet Amager Njalsgade 136 DK-2300 København S Denmark e-mail: [email protected] website: http://www.onp.hum.ku.dk ONP’s publications can be -

Was Ist Eigentlich Ein Zwerg? Eine Prototypensemantische Figu Renanalyse Der "Dvergar" in Der Sagaliteratur"______197
B an d 2 3 2 0 1 0 MEDIAEVISTIK internationale Zeitschrift für interdisziplinare Mittelalterforschung Herausgegeben von Peter Dinzelbacher und Albrecht Classen P6T6R LANG Frankfurt am Main • Berlin • Bern • Bruxelles • New York • Oxford • Wien MEDIAEVISTIK Internationale Zeitschrift für interdisziplinäre Mittelalterforschung herausgegeben von Prof. Dr. Peter Dinzelbacher und Prof. Dr. Albrecht Classen Beratergremium: Prof. Dr. Régis Boyer, Sorbonne, Paris - Prof. Dr. Jean-Marie Cauchies, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles - Prof. Dr. Dr. Bernhard Haage, Universität Mannheim - Dr. Werner Heinz, Sindelfingen - Prof. Dr. Joachim Herrmann, Akademie der Wissenschaften, Berlin - Prof. Dr. Dr. Gundolf Keil, Universität Würzburg - Prof. Dr. Jacques Le Goff, École des Hautes Études en Sci ences Sociales, Paris - Univ.-Ass. Dr. Romedio Schmitz-Esser, Universität München - Prof. Dr. Pierre Toubert, Membre de l'Institut, Paris Redaktion: Dipl. Rpfl. Olaf Wagener B.A., Universität Heidelberg Beiträge werden druckfertig in deutscher, englischer, französischer oder italienischer Sprache elektronisch an die Herausgeber erbeten, ausgenommen Autoren aus Amerika, die sich direkt an Prof. Classen (s.u.) wenden sollten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haf tung übernommen. Die Verfasser tragen für ihre Beiträge die Verantwortung. Eine Verpflichtung zur Aufnahme von Entgegnungen besteht nicht. MEDIAEVISTIK publiziert keine anderweitig erscheinenden Aufsätze. Rezensionsexemplare werden mit der deutlichen Beschriftung "kostenloses Rezensionsexemplar" an Verlag und Herausgeber erbeten. Für eine Besprechung bzw. Rücksendung unverlangt einge sandter Bücher kann keine Gewähr geleistet werden. MEDIAEVISTIK erscheint einmal jährlich in einem Band. Bezugspreise: Abonnement sFr. 96.-- / EUR 66.--, Einzelband sFr. 110.--/EUR 75.70, jeweils zuzüglich Porto und Verpackung. Abbe stellung des Abonnements ist nur zum 31. Dezember möglich. Werbeanzeigen und Beilagen durch den Verlag. -

History Or Fiction? Truth-Claims and Defensive Narrators in Icelandic Romance-Sagas
History or fiction? Truth-claims and defensive narrators in Icelandic romance-sagas RALPH O’CONNOR University of Aberdeen Straining the bounds of credibility was an activity in which many mediaeval Icelandic saga-authors indulged. In §25 of Göngu-Hrólfs saga, the hero Hrólfr Sturlaugsson wakes up from an enchanted sleep in the back of beyond to find both his feet missing. Somehow he manages to scramble up onto his horse and find his way back to civilisation – in fact, to the very castle where his feet have been secretly preserved by his bride-to-be. Also staying in that castle is a dwarf who happens to be the best healer in the North.1 Hann mælti: ‘… skaltu nú leggjast niðr við eldinn ok baka stúfana.’ Hrólfr gerði svâ; smurði hann þá smyrslunum í sárin, ok setti við fætrna, ok batt við spelkur, ok lèt Hrólf svâ liggja þrjár nætr. Leysti þá af umbönd, ok bað Hrólf upp standa ok reyna sik. Hrólfr gerði svâ; voru honum fætrnir þá svâ hægir ok mjúkir, sem hann hefði á þeim aldri sár verit. ‘He said, … “Now you must lie down by the fire and warm the stumps”. ‘Hrólfr did so. Then he [the dwarf] applied the ointment to the wounds, placed the feet against them, bound them with splints and made Hrólfr lie like that for three nights. Then he removed the bandages and told Hrólfr to stand up and test his strength. Hrólfr did so; his feet were then as efficient and nimble as if they had never been damaged.’2 This is rather hard to believe – but our scepticism has been anticipated by the saga-author. -

Manuscript Overview This Overview Lists All Manuscripts from The
Manuscript overview This overview lists all manuscripts from the Arnamagnæan Collection from the seventeenth and early eighteenth centuries that are known to have been changed physically according to text boundaries. The overview does not claim to be exhaustive. Instead, it is supposed to be understood as a working tool based on the indications found in the major secondary literature. During the research of the project, I was able to check many manuscripts and update the entries. However, due to the overwhelming number of manuscripts that turned out to be relevant, numerous indications still remain to be verified or need further research. Nevertheless, this overview presents the first systematic register over physically altered paper manuscripts in the Arnamagnæan Collection and will hopefully facilitate future studies. Please note the following principles applied: • Manuscripts are referred to based on their current form and shelfmark. Generally, each manuscript occupies one row in the overview. In some cases, however, parts of the same manuscript are registered on several consecutive lines in order to improve the readability. A note following the shelfmark indicates this fact. • In the first column, shelfmarks are given in their complete form. Where considered relevant for the identification, Roman numerals in accordance to Kålund’s printed catalogue (1889‐1894) are added. In the other columns, shelfmarks are abbreviated as follows: When mentioning parts of a manuscript in the same row, only the codicological unit (CU) and – if different – the Roman numeral are given. When referring to another manuscript, on the other hand, the indicator of the collection is usually omitted for Arnamagnæan manuscripts, i.e. -

Árni Magnússon's Rearrangement of Paper Manuscripts
Árni Magnússon’s rearrangement of paper manuscripts Beeke Stegmann PhD Thesis Faculty of Humanities University of Copenhagen 2 Acknowledgements This work would not have been possible without the help of numerous people. First of all, I would like to thank my supervisors Anne Mette Hansen and Matthew Driscoll for their great support which began before I officially started my PhD project and continued throughout the process. Their encouragement as well as critical feedback has provided extremely valuable help and guidance. Thanks are due to all my colleagues at the Arnamangæan Institute in Copen- hagen, including former colleagues, guests and otherwise associated people. They al- ways had an open door and time for my questions, and the warm and welcoming atmos- phere at both work-related events and more social gatherings quickly made me feel at home. The conservators Natasha Fazlic and Mette Jakobsen deserve special mention for sharing their expertise on the history of manuscripts and their bindings with me, and Suzanne Reitz for processing my orders so promptly. Furthermore, I would like to thank my colleagues from the other sections of the Department of Nordic Research for fruitful collaboration as well as the administrative and technical employees for providing exceptional research conditions. I am grateful to the staff and affiliates at our sister institute, the Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies in Reykjavík. During my repeated stays in Iceland I en- joyed their great hospitality and support in both practical and academic matters. Par- ticular thanks go Haukur Þorgeirsson and Jóhanna Ólafsdóttir for supplying me with manuscript images. I am further indebted to Peter Springborg for sharing his unpublished notes and wide knowledge with me, to Florian Grammel for LaTeX-help and to Philip Lavender for being witty and wise. -

Gripla XV Kápa.Qxd 28.4.2005 15:41 Page 1 GRIPLA XV
Gripla XV kápa.qxd 28.4.2005 15:41 Page 1 GRIPLA XV GRIPLA EFNI GRIPLA ✝ Jakob Benediktsson: Some observations on Stjórn and the manuscript AM 227 fol Magnús Lyngdal Magnússon: „Kátt er þeim af XV kristinrétti, kærur vilja margar læra.“ Af kristinrétti Árna, setningu hans og valdsviði Merrill Kaplan: The past as guest. Mortal men, king’s men, and four gestir in Flateyjarbók Haraldur Bernharðsson: Þykkja og þykja. Hljóðbeygingarvíxl einfölduð Bergljót Soffía Kristjánsdóttir: Íslenskur torfbær eða enskt sveitasetur? Um morðsöguna Gísla sögu Súrssonar Ólafur Halldórsson: Af Hákoni Hlaðajarli Sigurðarsyni Sverrir Tómasson: Dauði Hákonar jarls Árni Heimir Ingólfsson: Íslenskt tvísöngslag og Maríusöngur frá Montserrat Haraldur Bernharðsson: Afdrif kk-tákns Fyrstu málfræðrit- gerðarinnar. Um táknbeitingu nokkurra þrettándu aldar skrifara Margrét Eggertsdóttir: Ofurlítil íslensk bænabók í Wolfenbüttel Carl Phelpstead: A new edition of Biskupa sƒgur REYKJAVÍK STOFNUN ÁRNA MAGNÚSSONAR 9 789979 819912 2004 2004 011 -91-X Gripla XV kápa.qxd 28.4.2005 15:41 Page 2 Mynd á kápu er úr AM 227 fol, bl. 23v. Þar eru biblíu- þýðingar sem kallaðar hafa verið Stjórn. Myndin sýnir fórn Ísaks sem sagt er frá í Fyrstu Mósebók. Útlit: Ritstjórn - Kristinn Gunnarsson. GRIPLA Rá›gjafar BERGLJÓT S. KRISTJÁNSDÓTTIR • ROBERT COOK • DAVÍÐ ERLINGSSON EINAR G. PÉTURSSON • JÜRG GLAUSER • GUÐRÚN ÁSA GRÍMSDÓTTIR GUÐRÚN NORDAL • GUÐVA R ÐUR M. GUNNLAUGSSON • KARL G. JOHANSSON JÓNAS KRISTJÁNSSON • MARIANNE KALINKE • KJARTAN OTTOSSON ÓLAFUR HALLDÓRSSON • SIGURGEIR STEINGRÍMSSON • STEFÁN KARLSSON SVANHILDUR ÓSKARSDÓTTIR • TORFI H.TULINIUS VÉSTEINN ÓLASON • ANDREW WAWN Gripla er alfljó›legur vettvangur fyrir rannsóknir á svi›i íslenskra og norrænna fræ›a. Birtar eru útgáfur á stuttum textum, greinar og ritger›ir og stuttar fræ›ilegar athugasemdir. -

Auf Den Leib Geschriebene Rollen Und Eingefleischte Eigenschaften
Beihefte zur Mediaevistik: Band 29 2016 Andrea Grafetstätter / Sieglinde Hartmann / James Ogier (eds.) 2016 , Islands · and Cities in Medieval Myth, Literature, and History. Papers Delivered at the International Medieval Congress, Univer-sity of Leeds, in 2005, 2006, and 2007 (2011) Internationale Zeitschrift für interdisziplinäre Mittelalterforschung Olaf Wagener (Hrsg.), „vmbringt mit starcken turnen, murn“. Ortsbefesti- Band 29 gungen im Mittelalter (2010) Hiram Kümper (Hrsg.), eLearning & Mediävistik. Mittelalter lehren und lernen im neumedialen Zeitalter (2011) Olaf Wagener (Hrsg.), Symbole der Macht? Aspekte mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Architektur (2012) N. Peter Joosse, The Physician as a Rebellious Intellectual. The Book of the Two Pieces of Advice or Kitāb al-Naṣīḥatayn by cAbd al-Laṭīf ibn Yūsuf al-Baghdādī (1162–1231) (2013) Meike Pfefferkorn, Zur Semantik von rike in der Sächsischen Weltchronik. Reden über Herrschaft in der frühen deutschen Chronistik - Transforma- tionen eines politischen Schlüsselwortes (2014) Eva Spinazzè, La luce nell'architettura sacra: spazio e orientazione nelle chiese del X-XII secolo tra Romandie e Toscana. Including an English summary. Con una introduzione di Xavier Barral i Altet e di Manuela Incerti (2016) Christa Agnes Tuczay (Hrsg.), Jenseits. Eine mittelalterliche und mediävis- tische Imagination. Interdisziplinäre Ansätze zur Analyse des Unerklär- lichen (2016) Begründet von Peter Dinzelbacher Herausgegeben von Albrecht Classen LANG MEDIAEVISTIK MEDI 29-2016 271583-160x230 Br-AM PLE.indd 1 24.01.17 KW 04 09:06 Beihefte zur Mediaevistik: Band 29 2016 Andrea Grafetstätter / Sieglinde Hartmann / James Ogier (eds.) 2016 , Islands · and Cities in Medieval Myth, Literature, and History. Papers Delivered at the International Medieval Congress, Univer-sity of Leeds, in 2005, 2006, and 2007 (2011) Internationale Zeitschrift für interdisziplinäre Mittelalterforschung Olaf Wagener (Hrsg.), „vmbringt mit starcken turnen, murn“. -

Textüberlieferung Und Textbegriff Im Spätmittelalterlichen Norden: Das Beispiel Der Riddarasögur
JÜRG GLAUSER Textüberlieferung und Textbegriff im spätmittelalterlichen Norden: Das Beispiel der Riddarasögur i. ‘Nachklassik’ in der Sagaliteratur Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen zur Textüberlieferung und zum Textverständnis im spätmittelalterlichen Norden bilden zwei vor einigen Jahren erschienene Beiträge von Vertretern der jüngeren isländischen Literaturwissenschaft. Auf diese Weise soll gleich von Be ginn weg deutlich gemacht werden, daß es sich bei der vorhegenden Arbeit hauptsächlich um eine Auseinandersetzung mit einer beste henden Forschungstradition handelt.1 1 Der vorliegende Beitrag geht auf ein Paper zurück, das an der „10th International Saga Conference“, 3.-9.8.1997, in Trondheim, gehalten wurde. Die auf die mündliche Form ausgerichtete Thesenhaftigkeit der Argumentation wurde hier im wesentlichen beibehalten. Einzelne Teile waren zuvor an der Universität München („5. Münchener Arbeitsgespräch. ‘Übersetzung — Adaption — Rezeption: Zur Aufnahme fremder Stoffe, Formen und Ideen ins Altnordische und ihr Weiterwirken’“, 23.-25.2.1995), Stanford University („Stanford Colloquium on the Skald Sagas", 2.-4.5.1995), Harvard University (Gastvortrag, 8.5.1995) sowie an der Universität Zürich („1. Workshop des Forschungsprojekts ‘Transmission/Textüberlieferung’“, 9.11.1996) vorgestellt worden. Für die Möglichkeiten, in diesen unterschiedlichen Zusammenhängen die hier zusam mengefaßten Überlegungen kontrovers bzw. zustimmend zu diskutieren, danke ich insbesondere Theodore M. Andersson, Ole Bruhn, Margaret Clunies Ross, Helle -

On Gender, Status, and Violence in Old Norse Literature
AÐALHEIÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR “How Do You Know if it is Love or Lust?” On Gender, Status, and Violence in Old Norse Literature Abstract This article examines attitudes towards behaviour relating to women within Old Norse literature, focusing both on chivalric romances (translated and original, the riddarasögur) and the legendary sagas (fornaldarsögur), texts that were mostly written in the thirteenth and fourteenth centuries. The written chivalric romances arrived in Iceland from Norway and southern Europe, and thus they often exhib- it different values from those found in thefornaldarsögur , which tend to reflect in- digenous Nordic and heroic storytelling traditions. The article explores differenc- es between the two traditions regarding male emotions and attitudes towards women, with an emphasis on texts in which women are abused. In particular, the article seeks to investigate the relationship between social status and gender roles in these texts, and whether a woman’s rank affects her role and status according to gender. It focuses particularly on romances (especially those featuring courtly love) and fornaldarsögur in which women are either idealised as goddesses, or mistreated and even sexually abused because of their gender. The article con- cludes by asking how far the contrasts within the texts reflect a Norse ‘emotional community,’ as compared with continental European values, and whether these textual differences reflect actual difference in the social expressions of emotion- al behaviour. Ketils saga hængs is an Icelandic legendary saga which is usually dat- ed to the fourteenth century. In one episode the protagonist, Ketill, comes to a farm and asks for hospitality for the night from the mas- ter of the house, Brúni. -

Nítíða Saga in Late Medieval and Early Modern Iceland Sheryl Elizabe
i Transforming Popular Romance on the Edge of the World: Nítíða saga in Late Medieval and Early Modern Iceland Sheryl Elizabeth McDonald Werronen Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Leeds School of English January 2013 ii The candidate confirms that the work submitted is her own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. © 2013 The University of Leeds and Sheryl Elizabeth McDonald Werronen The right of Sheryl Elizabeth McDonald Werronen to be identified as Author of this work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. iii Acknowledgements There are many people whose help and support has made it possible for me to see this PhD through to its end, and as many of these people will know, it has not been an easy project. I should first thank my family for their support and encouragement, and my two supervisors Alaric Hall and Catherine Batt, who have enthusiastically supported me through everything, from the devising of the research proposal to the final draft. Many thanks are also due to the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC), for awarding me an invaluable Doctoral Fellowship from 2011 through 2013, and to the Viking Society for Northern Research for awarding me a grant to make a research trip to Iceland in August 2011. -
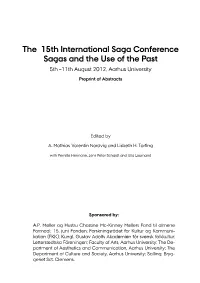
The 15Th International Saga Conference Sagas and the Use of the Past 5Th –11Th August 2012, Aarhus University Preprint of Abstracts
The 15th International Saga Conference Sagas and the Use of the Past 5th –11th August 2012, Aarhus University Preprint of Abstracts Edited by A. Mathias Valentin Nordvig and Lisbeth H. Torfing with Pernille Hermann, Jens Peter Schjødt and Ulla Loumand Sponsored by: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal; 15. juni Fonden; Forskningsrådet for Kultur og Kommuni- kation (FKK); Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur; Letterstedtska Föreningen; Faculty of Arts, Aarhus University; The De- partment of Aesthetics and Communication, Aarhus University; The Department of Culture and Society, Aarhus University; Salling; Bryg- geriet Sct. Clemens. MB Published by Department of Aesthetics and Communication Department of Culture and Society Faculty of Arts SUN-Tryk Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet All rights reserved. Copyright © 2012, the Contributors. ISBN: 978-87-995444-0-0 http://sagaconference.au.dk/fileadmin/sagaconference/Pre-print.pdf The cover image is the so-called “Aarhus Mask”, a depiction on a ru- nestone found in the district of Hasle in Aarhus. It has been dated to the period 970-1020. Design by Nichlas Tougaard, Det Nye Sort. Preface The theme of the 15th International Saga Conference, the 5th to the 11th of August, 2012, Aarhus University, is Sagas and the Use of the Past. Papers at the conference will be presented in one of the following categories: Memory and Fiction, Myth and Reality, Textuality and Manuscript Transmission, Genre and Concepts of History, Oral Tradi- tion, The Christianisation of Denmark and Eastern Scandinavia, The Use of Sagas and Eddas in the 21st Century and Open Session Apart from the keynote lectures, orally-presented papers are organized in up to 6 parallel sessions on each day of the conference, in addition to which there are poster presentations, which are presented on Thursday afternoon. -

Leeds Studies in English
Leeds Studies in English New Series XLVI 2015 Edited by Alaric Hall Reviews editor N. Kıvılcım Yavuz Leeds Studies in English <www.leeds.ac.uk/lse> School of English University of Leeds 2015 Leeds Studies in English <www.leeds.ac.uk/lse> Leeds Studies in English is an international, refereed journal based in the School of English, University of Leeds. Leeds Studies in English publishes articles on Old and Middle English literature, Old Icelandic language and literature, and the historical study of the English language. After a two-year embargo, past copies are made available, free access; they can be accessed via <http://www.leeds.ac.uk/lse>. Editorial Board: Catherine Batt, Chair Venetia Bridges Marta Cobb Alaric Hall, Editor Paul Hammond Oliver Pickering Helen Price Slavica Ranković N. Kıvılcım Yavuz Reviews Editor Notes for Contributors Contributors are requested to follow the MHRA Style Guide: A Handbook for Authors, Editors, and Writers of Theses, 2nd edn (London: Modern Humanities Research Association, 2008), available at <http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/download.shtml>. Where possible, contributors are encouraged to include the digital object identifiers or, where a complete free access text is available, stable URLs of materials cited (see Style Guide §11.2.10.1). The language of publication is English and translations should normally be supplied for quotations in languages other than English. Each contributor will receive a free copy of the journal, and a PDF of their article for distribution. Please email all contributions to <[email protected]>. Reviews Copies of books for review should be sent to the Editor, Leeds Studies in English, School of English, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, United Kingdom.