Die Geschichte Des Kaffees
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
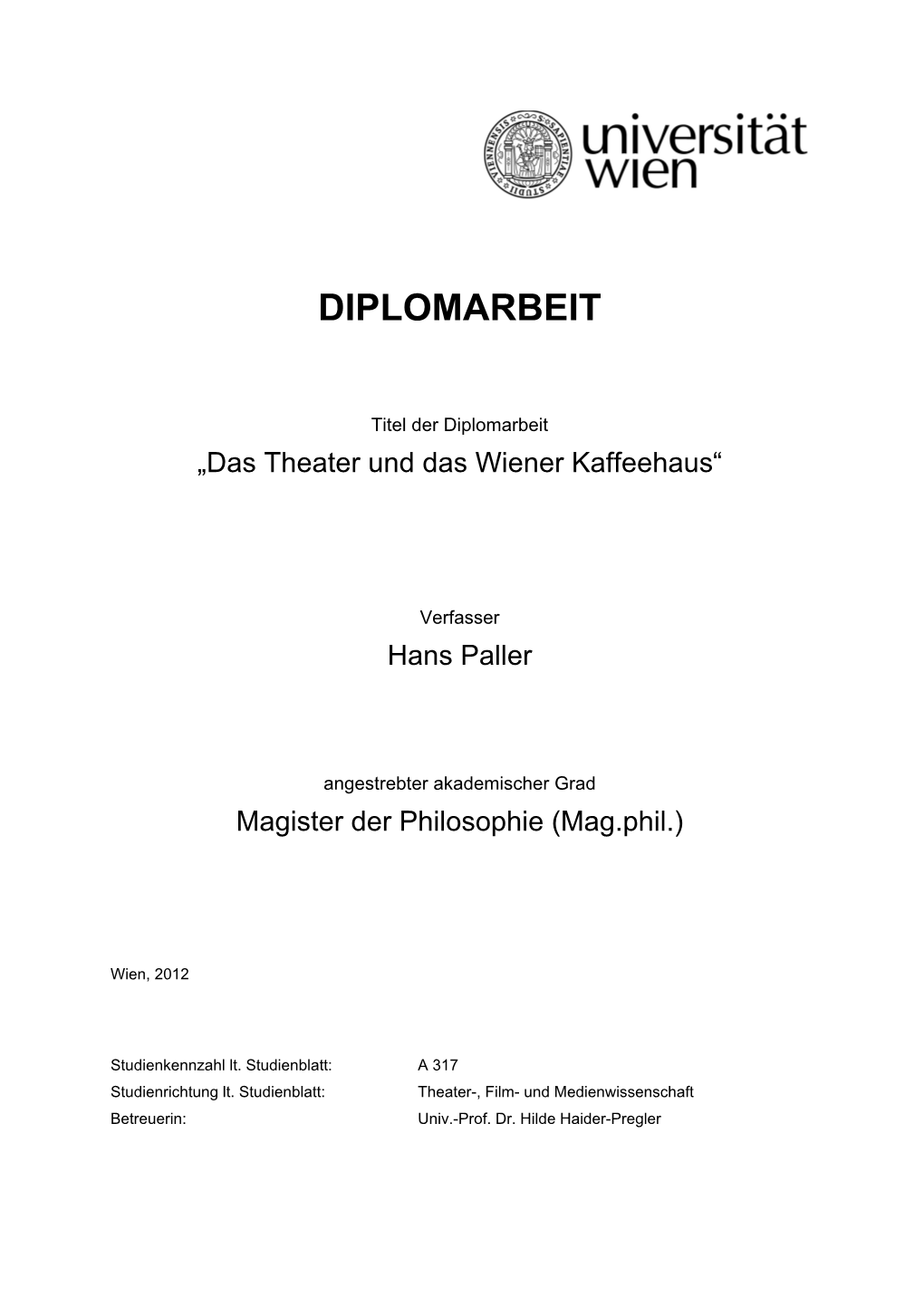
Load more
Recommended publications
-

Jahrespressekonferenz Salzburger Festspiele 2021 10. Dezember
SALZBURGER FESTSPIELE 17. Juli – 31. August 2021 Jahrespressekonferenz Salzburger Festspiele 2021 10. Dezember 2020, 10 Uhr Bühne, Felsenreitschule Das Direktorium der Salzburger Festspiele Helga Rabl-Stadler, Präsidentin Markus Hinterhäuser, Intendant Lukas Crepaz, Kaufmännischer Direktor und Bettina Hering, Leitung Schauspiel Florian Wiegand, Leitung Konzert & Medien 1 SALZBURGER FESTSPIELE 17. Juli – 31. August 2021 Die Salzburger Festspiele 2021 168 Aufführungen in 46 Tagen an 17 Spielstätten sowie 62 Vorstellungen im Jugendprogramm „jung & jede*r“ von 7 Produktionen an 30 Spielorten von Mai bis August 2021 und 5 Partizipative Projekte mit fast 1000 Kindern und Jugendlichen aus 54 Schulklassen, davon 42 außerhalb der Stadt Salzburg sowie Veranstaltungen „Zum Fest“ *** 31 Vorstellungen Oper DON GIOVANNI ELEKTRA Il TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO COSÌ FAN TUTTE INTOLLERANZA 1960 TOSCA NEITHER (konzertant) LA DAMNATION DE FAUST (konzertant) 44 Vorstellungen im Schauspiel JEDERMANN RICHARD THE KID & THE KING DAS BERGWERK ZU FALUN MARIA STUART LESUNGEN SCHAUSPIEL-RECHERCHEN 93 Konzerte OUVERTURE SPIRITUELLE Pax WIENER PHILHARMONIKER ORCHESTER ZU GAST Himmelwärts – Zeit mit BACH Still life – Zeit mit FELDMAN KAMMERKONZERTE CANTO LIRICO LIEDERABENDE SOLISTENKONZERTE MOZART-MATINEEN MOZARTEUMORCHESTER KIRCHENKONZERTE CAMERATA SALZBURG HERBERT VON KARAJAN YOUNG CONDUCTORS AWARD YOUNG SINGERS PROJECT SONDERKONZERTE 2 SALZBURGER FESTSPIELE 17. Juli – 31. August 2021 *** Zum Fest FEST ZUR FESTSPIELERÖFFNUNG REDEN ÜBER DAS JAHRHUNDERT THEATER -

Kulturstatistik 2017 – Zusammenfassung
2017 KULTURSTATISTIK Herausgegeben von STATISTIK AUSTRIA Wien 2019 Impressum Auskünfte Für schriftliche oder telefonische Anfragen steht Ihnen in der Statistik Austria der Allgemeine Auskunftsdienst unter der Adresse Guglgasse 13 1110 Wien Tel.: +43 (1) 711 28-7070 e-mail: [email protected] Fax: +43 (1) 71128-7728 zur Verfügung. Herausgeber und Hersteller STATISTIK AUSTRIA Bundesanstalt Statistik Österreich 1110 Wien Guglgasse 13 Für den Inhalt verantwortlich Mag. Wolfgang Pauli Tel.: +43 (1) 711 28-7268 e-mail: [email protected] Umschlagfoto Cäcilia Bachmann Kommissionsverlag Verlag Österreich GmbH 1010 Wien Bäckerstraße 1 Tel.: +43 (1) 610 77-0 e-mail: [email protected] ISBN 978-3-903264-22-9 Das Produkt und die darin enthaltenen Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der Bundesanstalt Statistik Österreich (STATISTIK AUSTRIA) vorbehalten. Bei richtiger Wiedergabe und mit korrekter Quellenangabe „STATISTIK AUSTRIA“ ist es gestattet, die Inhalte zu vervielfältigen, verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und sie zu bearbeiten. Bei auszugsweiser Verwendung, Darstellung von Teilen oder sonstiger Veränderung von Dateninhalten wie Tabellen, Grafiken oder Texten ist an geeigneter Stelle ein Hinweis anzubrin- gen, dass die verwendeten Inhalte bearbeitet wurden. Die Bundesanstalt Statistik Österreich sowie alle Mitwirkenden an der Publikation haben deren Inhalte sorgfältig recher- chiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Genannten übernehmen daher keine -

Österreich (PDF, 342KB)
Österreich Bitte beachten Sie, dass zu den ab Seite 48 genannten Filmtiteln im Bundesarchiv kein benutzbares Material vorliegt. Gern können Sie unter [email protected] erfragen, ob eine Nutzung mittlerweile möglich ist. - Bleriot‘s Flug in Wien (1909) - Aus alten Wochenberichten (1910/15) ...Stadtbilder von Wien. Blick auf die Hofburg. Großer Platz. Paradeaufstellung. Kaiser Franz Josef und Gefolge schreiten die Front ab. - Die Hochzeit in Schwarzau (1911) Hochzeit des Erzherzogs Karl Franz Joseph mit der Prinzessin Zita von Bourbon-Parma auf Schloß Parma in Schwarzau/Niederösterreich am 21.11.1911. - Eine Fahrt durch Wien (ca. 1912/13) Straßenbahnfahrt über die Ringstraße (Burgtheater, Oper) - Gaumont-Woche – Einzelsujets (1913) ...Wien: Reitertruppe kommt aus der Hofburg. - Gaumont-Woche – Einzelsujet: Militärfeier anläßlich des 100. Jahrestages der Schlacht bei Leipzig (1913) (aus Gaumont-Woche 44/1913) ...angetretene Militärformationen, Kavallerie-Formamation. Marsch durch die Straßen der Stadt Wien, am Straßenrand Uniformierte mit auf die Straße. Gesenkten Standarten. Kaiser Franz Joseph und ein ihn begleitender Offizier grüßen die angetretenen Forma- tionen. Beide besteigen eine Kutsche und fahren ab. ( 65 m) - 25 Jahre Zeppelin-Luftschiffahrt (ca. 1925) - Himmelstürmer (1941) ...Luftschiff „Sachsen“ auf der Fahrt nach Wien 1913. Landung auf dem Flugplatz Aspern - Der eiserne Hindenburg in Krieg und Frieden ...Extraausgabe des „Wiener Montag“ mit der Schlagzeile: Der Thronfolger ermordet - Eiko-Woche (1914) ...Erzherzog -

Jüdische Sommerfrische Als Ambivalentes (Über-)Lebensgefühl
Ausgabe Nr. 72 (2/2018) · Tamus 5778 · € 5,- www.nunu.at Jüdische Sommerfrische als ambivalentes (Über-)Lebensgefühl Editorial VON DANIELLE SPERA VON ANDREA SCHURIAN HERAUSGEBERIN CHEFREDAKTEURIN Koscher in den Bergen Sommerfrischezeit Mit großer Freude und erfüllt von den überwältigend Meer, Berge, Seen, Reisen, Kulturgenuss, Festspiele, Tapetenwechsel, vielen aufbauenden Reaktionen auf unser letztes NU, Leichtigkeit des Seins, schöne Erinnerungen, aber auch Antisemitismus, das erste unter einer neuen Chefredaktion und Heraus- Ausgrenzung, Ablehnung – unser Schwerpunktthema beschäftigt sich geberschaft, dürfen wir Ihnen hier die Sommer-Ausgabe diesmal mit jüdischer Sommerfrische einst und jetzt. Zunächst übersie- von NU präsentieren. Passend dazu unser Schwerpunkt: delte die Aristokratie für den „Erholungsaufenthalt der Städter auf dem die (jüdische) Sommerfrische. Menschen aus der Stadt Lande zur Sommerzeit“, wie die Gebrüder Grimm in ihrem Wörterbuch den suchten Erholung in der Natur. Die Bezeichnung aus Begriff „Sommerfrische“ definierten, von ihren Stadtpalais in die Land- dem Italienischen „prendere aria fresca“ wurde tatsäch- schlösser; bald machte es ihnen das – zumeist jüdische – Großbürgertum lich zu einem Inbegriff der Erholungskultur im Sommer. nach und tauschte während der Sommermonate Stadtwohnungen gegen Auch von den Jüdinnen und Juden wurde diese Idee kühle Saisonvillen in der Provinz. Ida Salamon hat mit dem Schauspieler, mit Begeisterung aufgenommen. Erobert wurden der Autor und Kabarettisten Miguel Herz-Kestranek eine -

Juncker Ist Neuer EU- Kommissionspräsident
Ausg. Nr. 133 • 4. August 2014 Unparteiisches, unabhängiges Monats- magazin speziell für Österreicherinnen und Österreicher in aller Welt in vier verschiedenen pdf-Formaten http://www.oesterreichjournal.at Juncker ist neuer EU- Kommissionspräsident Das Europäische Parlament hat Jean-Claude Juncker am 15. Juli mit einer starken Mehrheit von 422 Stimmen zum neuen Präsidenten der Europäischen Kommission gewählt. © 2014 European Parliament Jean-Claude Juncker ist der erste demokratisch gewählte Präsident der EU-Kommission. or der Abstimmung im Plenum des Eu- den ersten drei Monaten meiner Amtszeit, migkeiten als Kandidat für das Amt des Prä- Vropäischen Parlaments stellte Juncker ein Paket für Arbeitsplätze, Wachstum und sidenten der Europäischen Kommission vor- in einer Rede seine politischen Leitlinien Investition vorlegen, um 300 Milliarden geschlagen wurde, benötigte er eine Mehr- vor: „Meine erste Priorität und der Leitfaden Euro an Investitionen über die kommenden heit von 376 der insgesamt 751 Stimmen im jeden einzelnen Vorschlages ist Wachstum drei Jahre zu generieren.“ Europaparlament – die er mit 422 Stimmen und Arbeitsplätze in Europa zu schaffen“, Nachdem Juncker vom Europäischen Rat schließlich erreicht hatte. sagte er. „Um das zu erreichen werde ich, in am 27. Juni 2014 nach einigen Mißstim- Lesen Sie weiter auf der Seite 3 ¾ Sie sehen hier die Variante A4 mit 72 dpi und geringer Qualität von Bildern und Grafiken ÖSTERREICH JOURNAL NR. 133 / 04. 08. 2014 2 Die Seite 2 Liebe Leserinnen und Leser, diesmal erwarten Sie leider gleich vier Nachrufe: auf die erst am 2. August verstorbene Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, auf die Schauspieler Gert Voss und Dietmar Schönherr sowie auf den Physiker Heinz Zemanek, Erbauer des »Mailüfterls« – einer der welt- weit ersten Computer, die mit Hilfe von Transistoren funktionierten. -

Kunst- Und Kulturbericht 2016 Impressum Medieninhaber, Verleger Und Herausgeber: Bundeskanzleramt, Sektion Für Kunst Und Kultur, Concordiaplatz 2, 1010 Wien
Kunst- und Kultur- bericht 2016 Kunst- und Kulturbericht 2016 Impressum Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: Bundeskanzleramt, Sektion für Kunst und Kultur, Concordiaplatz 2, 1010 Wien Redaktion, Lektorat: Herbert Hofreither, Reinhold Hohengartner, Theresia Niedermüller, Catherine Polsterer, Robert Stocker, Charlotte Sucher Gestaltung: BKA Design & Grafik – Florin Buttinger Druck: RemaPrint Die Redaktion dankt allen Beiträgern für die gute Zusammenarbeit. Kunst- und Kulturbericht 2016 Wien, 2017 Vorwort Musik 253 Bundesminister Mag. Thomas Drozda 5 Wiener Hofmusikkapelle 261 Bundestheater 265 Kunst- und Kulturförderung 9 Bundestheater-Holding 267 Rechtliche Grundlagen 11 Burgtheater 273 Kunst- und Kulturausgaben, Gender 19 Wiener Staatsoper 283 Volksoper Wien 293 Institutionen Wiener Staatsballett 301 und Förderungs programme 35 ART for ART Theaterservice 307 Bundesmuseen 37 Darstellende Kunst 3 11 Albertina 45 Bildende Kunst, Architektur, Österreichische Galerie Belvedere 59 Design, Mode, Fotografie 319 Kunsthistorisches Museum Wien 73 Film, Kino, Video- und Medienkunst 329 Österreichisches Theatermuseum 83 Kulturinitiativen 335 Weltmuseum Wien 89 Europäische und internationale MAK – Österreichisches Museum für Kulturpolitik 343 angewandte Kunst/Gegenwartskunst 97 Festspiele, Großveranstaltungen 361 Museum Moderner Kunst Stiftung Soziales 375 Ludwig Wien – mumok 107 Naturhistorisches Museum Wien 117 Ausgaben im Detail 379 Technisches Museum Wien 129 Museen, Archive, Wissenschaft 381 Österreichische Mediathek 139 Baukulturelles Erbe, -

Die Geschichte Des Kaffees
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Das Theater und das Wiener Kaffeehaus“ Verfasser Hans Paller angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof. Dr. Hilde Haider-Pregler 2 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort ................................................................................................................................ 6 2. Mythos Kaffee: Von der Kaffeepflanze zum Wiener Literatencafé ............................... 9 2.1. Die Geschichte des Kaffees ....................................................................................... 9 2.2. Kaffee – Herkunft, Sorten ....................................................................................... 11 2.3. Altes Wissen für junge Köpfe ................................................................................. 13 2.4. Volkskunst - Der Einzug der Literatur ins Kaffeehaus ........................................... 16 2.5. Das Wiener Kaffeehaus und seine Literaten ........................................................... 18 2.6. Café Frauenhuber – das älteste, noch bestehende Kaffeehaus Wiens ..................... 19 2.7. Kopi Luwak – der seltenste und teuerste Kaffee der Welt ...................................... 20 2.8. Der typische Kaffeehaussessel der Firma Thonet ................................................... 21 2.9. -

Presse-Beilage Salzburger Festspiele 2011
salzburger Festspiele Mit Spannung erwartete Uraufführungen von Peter Handke und Roland Schimmelpfennig, ein hochkarätiges Konzertprogramm, Hersteller und Christian Thielemann kehrt zurück. Die aufregende Kulturreise durch den Fotos: FestsPIelsoMMer –Überraschungen garantiert. 1Kultur Spezial www.siemens.at/kultur präsentiertvon den Salzburger Festspielen, Siemens und dem ORF-Salzburg 24.7.bis 15.8.2011 Vorführungen von Festspielproduktionen auf Großbildleinwand am Kapitelplatz Salzburg, täglichab20Uhr, gastronomisches Angebotab17Uhr. Eintritt frei. inhalt „Das Ohr aufwecken, die Augen, das menschliche Denken.“ lUIGI NoNo 4 MArKUs HINterHÄUser 8 16 30 Der Intendant der Salzburger Fest- spiele im Gespräch. 20 DIe sACHe MAKroPUlos Angela Denoke als Emilia Marty in der selten gespielten Oper von Leoš Janácek. Uraufführung. „Immer „Die Frau ohne schatten“. Christian „Maß für Maß“. Gert Voss, der Jedermann noch Sturm“ von Peter Thielemann gibt sein Operndebüt in Salz- der Jahre1995–1998, als Herzog in 22 Der FÜNFte KoNtINeNt Handke auf der Perner-Insel. burg mit der Oper von Richard Strauss. Shakespeares Komödie. Ein Best-of als krönender Ab- schluss der „Kontinent“-Reihe. 26 „sZeNeN“-reIHe Markus Hinterhäuser stellt diesmal editorial Gustav Mahler ins Zentrum der „Szenen“-Reihe. estspiele? Geht mandavon aus, dass es bei 28 Peter steIN UND „MACBetH“ Veranstaltungen, die diesen Namen wirklich Der Großmeister der Regie insze- F niert „Macbeth“ von Giuseppe Verdi. verdienen, um die Auseinandersetzungmit den Spitzenleistungen des Kulturlebens geht, dannwerden tel: die SalzburgerFestspiele ihrem Namen heuer mehr als 33 BArBArA sUKoWA GÜr gerecht: Goethes „Faust“ und Shakespeares„Maßfür Die Schauspielerin als Sprecherin Maß“,Mozarts Da-Ponte-Trilogie und die „Frau ohne in Arnold Schönbergs „Pierrot tore, Schatten“, die anspruchsvollste Oper der lunaire“. GlIA A/teCHt Festspielgründer Hugo vonHofmannsthal und Richard tA AP Strauss, sie stellen Ausführende wiePublikum auf 34 „FAUst I & II“ AN eINeM ABeND die schwierigstenProben. -

Austriaalumni Newsletter
WINTER 2014 AYA ALUMNI NEWSLETTER ACADEMICAUSTRIA YEAR ABROAD Greetings from Salzburg! from Fall 2013 Director Christina Guenther “Die Krampusse sind los!” You may remember (partial) hike up the Gaisberg, and a weekend trip that at this time in Salzburg—the first week to Vienna via the Westbahn. This year, the tour of of December—the Krampusse are haunting— Großgmain’s open-air museum in early October actually terrorizing—downtown Salzburg. Our took place in the snow while we had splendid students in this year’s AYA Salzburg have been sunny weather for our walking tour around pretty cool about their first Krampus-encounters, Vienna at the end of the month, on the Austrian though. See photo at left! National Holiday no less. Here is a picture of the Mengdi and Sara from Sara’s Facebook group looking intently at the Austrian parliament entry (permission to include granted): “I got to building, the Nationalrat. On page 2, a more experience my first Krampuslauf today! I ended relaxed group photo in front of the palace at up getting whipped, and also a few of the Schönbrunn! Krampus’s rubbed my head/face. Not sure why. Vienna was as beautiful as ever in the It was insane, I loved it!!” autumn sunshine, and we all vowed to return This is just one of the many (and very soon. occasionally weird) intercultural Students experience Krampus-encounters. encounters that our students have had in Salzburg this semester. I am very pleased to announce a new opportunity for intercultural exchange Inside This Issue in Salzburg this year. -
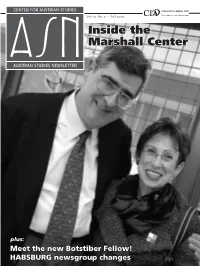
Inside the Marshall Center
CENTER FOR AUSTRIAN STUDIES Vol. 21, No. 2 • Fall 2009 Inside the Marshall Center ASNAUSTRIAN STUDIES NEWSLETTER plus: Meet the new Botstiber Fellow! HABSBURG newsgroup changes ASN/TOC spring snapshots I Letter from the Director 3 Minnesota Calendar 3 News from the Center 4 ASN Interview: Anselm Wagner 6 A Look at the George Marshall Center 8 ASN Interview: Andrej Rahten 10 Opportunities for Giving 13 Publications: News and Reviews 14 Hot off the Presses 17 News from the Field 18 Report from New Orleans 19 ASN Interview: Gloria Kaiser 20 News from the North 22 SAHH News 23 Review: Salzburg Festival 2009 24 Announcements 26 On February 24, Daniel Gilfillan (above), German Studies, Arizona State University, gave a lecture entitled “Sounding Out Austrian Radio Space: Tactical Media, Experi- ASN mental Artistic Practice, and the ÖRF Kunstradio Project.” The Department of German, Austrian Studies Newsletter Scandinavian, and Dutch cosponsored the talk. Photo: Daniel Pinkerton. Volume 21, No. 1 • Spring 2009 Designed & edited by Daniel Pinkerton Editorial Assistants: Linda Andrean, Matthew Konieczny, Mollie Madden, Allison Nunnikhoven ASN is published twice annually, in February and September, and is distributed free of charge to interested subscribers as a public service of the Center for Austrian Studies. Director: Gary B. Cohen Administrative Manager: Linda Andrean Editor: Daniel Pinkerton Send subscription requests or contributions to: Center for Austrian Studies University of Minnesota Attn: Austrian Studies Newsletter 314 Social Sciences Building 267 19th Avenue S. Minneapolis MN 55455 Phone: 612-624-9811; fax: 612-626-9004 Website: http://www.cas.umn.edu Editor: [email protected] ABOUT THE COVER: Left to right, Gary Cohen, CAS director, and Ruth Wodak, professor of applied liguistics, University of Lan- Left to right, Austrian musicians Florian Kitt and Rita Medjimorec performed works by caster. -

Best Entertainment in Salzburg"
"Best Entertainment in Salzburg" Gecreëerd door : Cityseeker 5 Locaties in uw favorieten Kleines Festspielhaus "At the foot of the Mönchsberg" The main parts of this large festival hall were built in 1924, but it has been changed and adapted several times since then. With 1324 seats and standing room for 60, it holds a relatively large number of visitors. The entrance hall with a famous frescoe by Anton Faistauer is most impressive. One of the three main stages under one roof in the so called by Andreas Praefcke 'Festival District'. +43 662 84 9097 Hofstallgasse 1, Salzburg Felsenreitschule "Step into the Past" Built in the 17th century, Felsenreitschule was once used for horse riding shows and animal baiting. Since then, the venue has undergone radical transformations in order to include an enlarged stage, collapsible seating, and retractable roof. Despite the modern additions, much of the arena's original appearance has been fully preserved. With the ability to hold over by Hvplux 1,400 guests, play productions and stage shows such as "The Servant of Two Masters" are shown at Felsenreitschule. Hofstallgasse, Salzburg Landestheater Salzburg "Famed Dramatics" The Landestheater stages elaborate productions of classic works as well as more contemporary pieces. Annual productions range from opera to ballet, musical theater and musical productions for young people. With high stucco ceilings, plush red carpets, winding staircases, stunning boxes and enormous chandeliers, the interior is exactly what one would expect by Andrew Bossi from such a renowned establishment. The theater also serves as one of the venues for the Salzburg Festspiele. Check website for a complete list of events. -

18. Juli — 31. August 2014
PROGRAMM OpER 2014 PROGRAMM OpER 2014 INHALT / CONTENTS 2 Vorwort 4 Don Giovanni 6 Charlotte Salomon 8 Der Rosenkavalier 10 Il trovatore 12 Fierrabras 14 La Cenerentola 16 La Favorite 18 Projekt Tristan und Isolde 20 Spielplan 18. JULI — 31. AUGUST 2014 DANIEL BARENBOIM · SVEN-ERIC BECHTOLF · LUC BONDY · CHARLOTTE SALOMON · MARC-ANDRÉ DALBAVIE · DER ROSENKAVALIER · DON GIOVANNI · GAETANO DONIZETTI · CHRISTOPH ESCHENBACH · FIERRABRAS · DANIELE GATTI · ALVIS HERMANIS · IL TROVATORE · HARRY KUPFER · LA CENERENTOLA · LA FAVORITE · ZUBIN MEHTA · INGO METZMACHER · DAMIANO MICHIELEttO · WOLFGANG AMADEUS MOZART · GIOACHINO ROSSINI · NELLO SANTI · FRANZ SCHUBERT · JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI · PROJEKT TRISTAN UND ISOLDE · PETER STEIN · RICHARD STRAUSS · GIUSEPPE VERDI · RICHARD WAGNER www.salzburgfestival.at VORWORT / PREFACE Neben der vorbildlichen Pflege von klassischen Werken sehe ich es als eine wesentliche Aufgabe der Salzburger Festspiele, im Bereich der zeitgenössischen Musik wichtige Signale zu setzen, und so freue ich mich darüber, die im Auftrag der Salzburger Festspiele komponierte Oper Charlotte Salomon von Marc-André Dalbavie in diesem Sommer zur Urauf- führung bringen zu können. Der französische Komponist beschäftigt sich in diesem Werk mit dem Leben der jüdischen Malerin Charlotte Salomon, die 1943 in Auschwitz ermor- det wurde. Der Komponist selbst übernimmt am Pult des Mozarteumorchesters Salzburg die musikalische Leitung. Weitere Werke des für seinen Klangsinn gerühmten Kom- ponisten sind in den Salzburg contemporary-Konzerten zu entdecken, die heuer zudem einen Schwerpunkt auf das Schaffen von Wolfgang Rihm legen. Als Regisseur für die Uraufführung von Dalbavies Oper konnten wir Luc Bondy gewinnen, der gerade mit dem Nestroy 2013 für sein Le- benswerk ausgezeichnet wurde. Der Schweizer Regisseur kehrt damit zu den Salzburger Festspielen zurück, wo er u.