Comeniusstraße 32, Villa Des NS-Gauleiters Martin Mutschmann
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
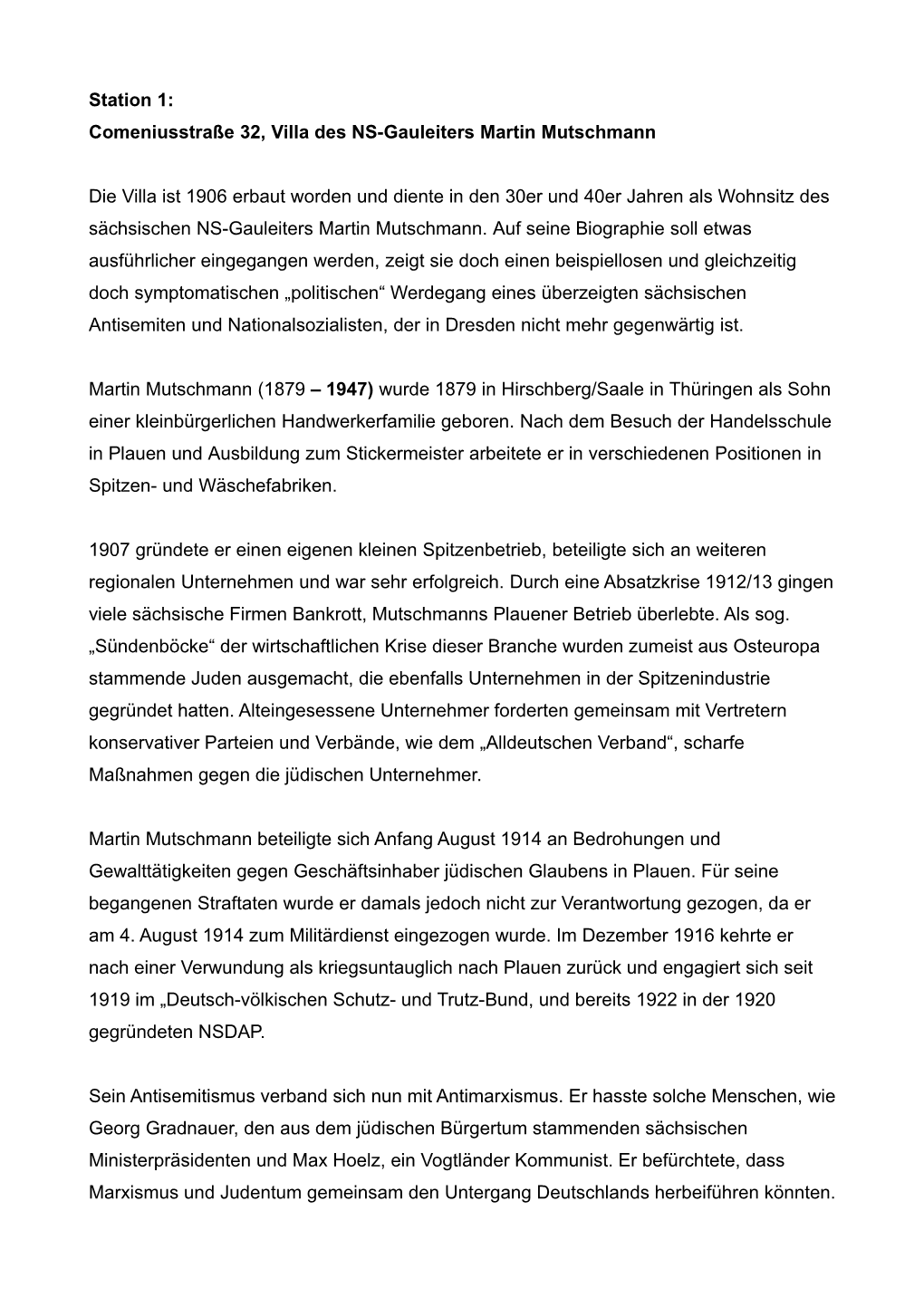
Load more
Recommended publications
-

Plauen 1945 Bis 1949 – Vom Dritten Reich Zum Sozialismus
Plauen 1945 bis 1949 – vom Dritten Reich zum Sozialismus Entnazifizierung und personell-struktureller Umbau in kommunaler Verwaltung, Wirtschaft und Bildungswesen Promotion zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Chemnitz eingereicht von Dipl.-Lehrer Andreas Krone geboren am 26. Februar 1957 in Plauen angefertigt an der Technischen Universität Chemnitz-Zwickau Fachbereich Regionalgeschichte Sachsen betreut von: Dr. sc. phil. Reiner Groß Professor für Regionalgeschichte Sachsen Beschluß über die Verleihung des akademischen Grades Doktor eines Wissenschaftszweiges vom 31. Januar 2001 1 Inhaltsverzeichnis Seite 0. Einleitung 4 1. Die Stadt Plauen am Ende des 2. Weltkrieges - eine Bilanz 9 2. Zwischenspiel - die Amerikaner in Plauen (April 1945 - Juni 1945) 16 2.1. Stadtverwaltung und antifaschistischer Blockausschuß 16 2.2. Besatzungspolitik in der Übergangsphase 24 2.3. Anschluß an die amerikanische Zone? 35 2.4. Resümee 36 3. Das erste Nachkriegsjahr unter sowjetischer Besatzung 38 (Juli 1945 - August 1946) 3.1. Entnazifizierung unter der Bevölkerung bis Ende 1945 38 3.2. Stadtverwaltung 53 3.2.1. Personalreform im Stadtrat 53 3.2.2. Strukturelle Veränderungen im Verwaltungsapparat 66 3.2.3. Verwaltung des Mangels 69 a) Ernährungsamt 69 b) Wohnungsamt 72 c) Wohlfahrtsamt 75 3.2.4. Eingesetzte Ausschüsse statt gewähltes Parlament 78 3.2.5. Abhängigkeit der Stadtverwaltung von der Besatzungsmacht 82 3.2.6. Exkurs: Überwachung durch „antifaschistische“ Hauswarte 90 3.3. Wirtschaft 93 3.3.1. Erste personelle Maßnahmen zur Bereinigung der Wirtschaft 93 3.3.2. Kontrolle und Reglementierung der Unternehmen 96 3.3.3. Entnazifizierung in einer neuen Dimension 98 a) Die Befehle Nr. -

Vorbemerkung
5 Vorbemerkung Im Kreis der 43 Gauleiter des „Großdeutschen Reiches“ zählte Martin Mutsch- mann zu den mächtigsten: Es gab nur wenige „politische Generale“ (Karl Höffkes), die neben der politischen Führung des Gaus auch die entscheidenden staatlichen Führungspositionen in den Händen hielten und überdies zu Hitlers frühesten Ge- folgsleuten zählten. Seit 1925 war er Gauleiter der sächsischen NSDAP, seit 1933 Reichsstatthalter und seit 1935 Ministerpräsident in Sachsen. 1939 kam der einfluss- reiche Posten eines Reichsverteidigungskommissars hinzu. Noch Anfang 1945, aus Anlass seines 20-jährigen Gauleiter-Jubiliäums, ließ sich Mutschmann von der ei- genen Presse als ein „Vorbild an Treue und Tatkraft“ würdigen. „Damals schon“, von den „Anfängen der NSDAP an“1, so verkündete ein Dresdner Blatt in Super- lativen, sei er einer der „bewährtesten und mutigsten, treuesten und einsatzbereites- ten, tatkräftigsten und fanatischsten Gefolgsmänner des Führers“ gewesen, eben: Hitlers „getreuer Paladin“. Das, was da zu Anfang 1945 etwas unfreiwillig wie ein Nachruf klang, erscheint nicht in allen Punkten übertrieben oder gar erdichtet. Mutschmann war tatsächlich ein „perfekter Nazi-Gauleiter“. Ein Urteil, das der deutsch-britische Historiker Claus-Christian W. Szejnmann so begründete: „Er war Hitler besonders treu ergeben, ein gewalttätiger Antisemit, extrem skrupellos und entschlossen.“2 Gerade weil der sächsische „Gaufürst“ vor 1945 so allgegenwärtig schien, wirkte sein beinahe spurloses Ende seltsam unbefriedigend. Dass er noch im Mai 1945 in sowjetische -

Nazi Party and Other Early 20Th Century German History Related Posters; Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress, Washington, D.C
Nazi Party and Other Early 20th Century German History Related Posters; Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress, Washington, D.C. ; 2017 Nazi Party Posters from the Third Reich Collection A Finding Aid to the Collection in the Library of Congress Compiled by Debra Wynn Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress Washington, D.C. 2017 Contact information: http://www.loc.gov/rr/rarebook/contact.html Catalog Record: http://lccn.loc.gov/2006590669 Finding aid encoded by Elizabeth Gettins, Library of Congress.2017 Finding aid URL: http://hdl.loc.gov/loc.rbc/eadrbc.rb017001 file:///lcdataserver/LOCPROF.003/eget/Desktop/naziposters.html[10/18/2017 4:19:12 PM] Nazi Party and Other Early 20th Century German History Related Posters; Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress, Washington, D.C. ; 2017 Table of Contents Collection Summary Selected Search Terms Administrative Information Processing History Copyright Status Access and Restrictions Preferred Citation Scope and Content Note Arrangement of the Records Other Related Finding Aids Description of Series Container List Nazi Posters, 1941-1944 file:///lcdataserver/LOCPROF.003/eget/Desktop/naziposters.html[10/18/2017 4:19:12 PM] Nazi Party and Other Early 20th Century German History Related Posters; Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress, Washington, D.C. ; 2017 Collection Summary Title: Nazi Party and Other Early 20th Century German History Related Posters Span Dates: 1917-1945 ID No.: rb0170001 Creator: Library of Congress. Rare Book and Special Collections Division Extent: 16 containers ; Linear feet of shelf space occupied: 30 linear feet ; Approximate number of items: 425 Language: Collection material is primarily in German and some items in Polish. -

2 Schaarschmidt Mulit-Level Governance in Hitler's Germany
www.ssoar.info Multi-Level Governance in Hitler's Germany: Reassessing the Political Structure of the National Socialist State Schaarschmidt, Thomas Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Schaarschmidt, T. (2017). Multi-Level Governance in Hitler's Germany: Reassessing the Political Structure of the National Socialist State. Historical Social Research, 42(2), 218-242. https://doi.org/10.12759/hsr.42.2017.2.218-242 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur This document is made available under a CC BY Licence Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden (Attribution). For more Information see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Diese Version ist zitierbar unter / This version is citable under: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-51891-0 Multi-Level Governance in Hitler’s Germany: Reassessing the Political Structure of the National Socialist State ∗ Thomas Schaarschmidt Abstract: »Mehrebenenverwaltung im Nationalsozialismus: Eine Neubewer- tung der politischen Struktur des NS-Staats«. To explain the fatal efficiency and relative stability of the Nazi dictatorship, it is necessary to analyze how governmental institutions and society at various levels of the political system interacted. Contrary to the expectation that polycratic structures hampered administrative efficiency and tended to undermine well-established political structures it turns out that new models of governance evolved from the chaot- ic competition and short-lived cooperation of traditional administrations, party structures and newly created special institutions. -

Braune Karrieren Braune
Braune Karrieren Braune Braune Karrieren Dresdner Täter und Akteure im Nationalsozialismus Herausgegeben von C H ristine Pie P e r · M i k e s C H M e i t z n e r · g e r H a r d n a s e r Braune Karrieren Dresdner Täter und Akteure im Nationalsozialismus Herausgegeben von CH ristine PieP er · M i k e s C H Mei tz n er · ger Ha r d nas er San dStein Verlag Inhalt Vorwort und Einleitung SA, SS, Gestapo Justiz Fachleute der Vernichtung 9 Dirk Hilbert 60 CH ristine PiePer 106 Wolfgang HoWald 154 Bor is böhm Grußwort Georg von Detten und Hans Hayn Otto Georg Thierack Alfred Fernholz Die sächsischen SA-Gruppenführer Hitlers willfähriger Justizminister Ein Schreibtischtäter im Dienste 10 CH ristine PiePer und der »Röhm-Putsch« der »Volksgesundheit« Mi ke Schmeitzn er 115 Bi rgit saCk ger Har d naser 66 Si egfr i ed gru n dMan n Heinrich von Zeschau 162 Bi rgit töPolt Vorwort Arno Weser Ankläger beim Volksgerichtshof Heinrich Eufinger Der »Spucker«, aber auch Schläger Chefarzt der Frauenklinik 13 CH ristine PiePer 120 Gerald HaCke Dresden-Friedrichstadt und Mitver- Mi ke Schmeitzn er 72 I r i na suttn er Heinz Jung antwortlicher an der Zwangs- Täter und Akteure im Nationalsozialismus gu n da u lbr icht Sachsens Generalstaatsanwalt sterilisierung Dresdner Frauen Ein forschungsgeschichtlicher Überblick Henry Schmidt Leiter des Judendezernats 128 Clau dia bade 168 J u li us Schar n etzky der Dresdner Gestapo Alfred Häbler, Günther Jahn Horst Schumann und Rudolf Fehrmann Ein aktiver Anhänger der 78 Carsten Sch r ei ber Partei und Verwaltung Heeresrichter -

The Curious History of Leipzig's Richard Wagner Monument
Grit Hartmann. Richard Wagner gepfändet: Ein Leipziger Denkmal in Dokumenten 1931-1955. Leipzig: Forum Verlag Leizig, 2003. 264 S.; 36 Abb. EUR 14.00, broschiert, ISBN 978-3-931801-35-9. Reviewed by Charles Lansing Published on H-German (March, 2006) This slim collection of primary documents ficulties the National Socialist state and party en‐ presents the interesting story of the decades-long, countered in their efforts to transform German though ultimately fruitless, efforts of Leipzig mu‐ society and culture. However, the book's useful‐ nicipal administrations and citizens to build a ness would be greater if the author had fore‐ monument to honor one of the city's most famous grounded these themes. sons, Richard Wagner. Consisting primarily of cor‐ The frst group of documents focuses on the respondence that passed through the Leipzig city monument's genesis in the early 1930s. At a July government, the volume begins with the genesis 1931 meeting of a special commission that includ‐ of the monument in the early 1930s and ends with ed Leipzig's Lord Mayor, Carl Friedrich Goerdeler, the ignominious partial destruction of the unfin‐ and several members of the city's cultural elite, ished monument and the dispersal of fragments commission members resolved to hold a design to several West German private collectors in the competition for a possible Richard Wagner monu‐ 1950s. Essays written by editor Grit Hartmann in‐ ment in Leipzig. Significantly, the commission troducing each of the four chronologically divided members also formulated a backup plan, one far groups of documents both provide the reader less grand and much less expensive: should a with the historical context needed to make sense monument not be possible, Leipzig would display of the individuals and institutions involved in the in a new location an already extant plinth, de‐ monument project and also help situate the docu‐ signed by Max Klinger and intended to be the ments into the larger story of the reception of base of a 17.5-foot statue of Richard Wagner. -

Publikationen Seite 1
Publikationen Seite 1 Publikationen Monografien Richard Löwenthal. Widerständler – Wissenschaftler – Weltbürger (Jüdische Miniaturen, Band 211), Berlin 2017 Immer eine Reise wert? Fremdenverkehr in „Klein-Tirol“ 1887-1945, Lichtenau bei Chemnitz 2016 Sachsen 1933-1945. Der historische Reiseführer, Berlin 2014 (zus. mit Francesca Weil) Eine totalitäre Revolution? Richard Löwenthal und die Weltanschauungsdiktaturen im 20. Jahrhundert (Gesprächskreis Geschichte der Friedrich-Ebert-Stiftung Nr. 96), Bonn 2012 Der Fall Mutschmann. Sachsens Gauleiter vor Stalins Tribunal, Beucha und Markkleeberg 2011 (3. Auflage 2012) Doppelt verfolgt. Das widerständige Leben des Arno Wend, Berlin 2009 Im Schatten der FDJ. Die “Junge Union” in Sachsen 1945-1950 (Berichte und Studien des HAIT 47), mit einem autobiographischen Essay von Wolfgang Marcus, Göttingen 2004 Die Partei der Diktaturdurchsetzung. KPD/SED in Sachsen 1945-1952 (Schriften des HAIT, Band 21), Köln/Weimar/Wien 2002 (zus. mit Stefan Donth) Schulen der Diktatur. Die Kaderausbildung der KPD/SED in Sachsen 1945–1952 (Berichte und Studien des HAIT 33), Dresden 2001 Alfred Fellisch 1884–1973. Eine politische Biographie (Geschichte und Politik in Sachsen 12), Köln 2000 „Einer von beiden muß so bald wie möglich entfernt werden“. Der Tod des sächsischen Ministerpräsidenten Rudolf Friedrichs vor dem Hintergrund des Konflikts mit dem sächsischen Innenminister Kurt Fischer 1947. Expertise des Hannah-Arendt-Instituts im Auftrag der Sächsischen Staatskanzlei, Leipzig 1999 (zus. mit Michael Richter) Geschichte der Sozialdemokratie im Sächsischen Landtag. Darstellung und Dokumentation 1877–1997, Dresden 1997 (zus. mit Michael Rudloff) Prof. Dr. Mike Schmeitzner │ [email protected] Stand: 08/2018 Publikationen Seite 2 Herausgeberschaften Das Konzentrationslager Sachsenburg (1933-1937) (Schriftenreihe der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Band 16), Dresden 2018 (zus. -

Behrens V. Düsseldorf” * by HENNING KAHMANN and VARDA NAUMANN © 1
Comment on the Recommendation by the Advisory Commission in the case of “Behrens v. Düsseldorf” * by HENNING KAHMANN and VARDA NAUMANN © 1 In its recommendation of February 3, 2015 2 the Advisory Commission on the return of cultural property seized as a result of Nazi persecution, especially Jewish property ( Beratende Kommission für die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter or Limbach Commission for short) has advised against the restitution of a painting. The work concerned is “Pariser Wochentag” by Adolph von Menzel. The claimant was the community of heirs to the estate of George Eduard Behrens. The respondent, the City of Düsseldorf, opposed the claim arguing that the sale of the painting from the Behrens collection to the municipal art collections (Städtische Kunstsammlungen Düsseldorf) had not been a loss of property as a consequence of Nazi persecution. I. Factual background The factual background to the recommendation was essentially as follows: “Pariser Wochentag” was painted by Adolph von Menzel in 1869 and acquired by Eduard Ludwig Behrens, the owner of L. Behrens & Söhne, a private bank in Hamburg, for his art collection in or before 1886. The painting remained in the family’s ownership until 1935. In March of that year George E. Behrens informed the Hamburger Kunsthalle about the proposed sale of 33 paintings from the Behrens collection which were on loan to the Kunsthalle. That same year, Hans-Wilhelm Hupp 3, the director of Düsselsdorf’s municipal art collections since 1933, was attempting to acquire a “major work by Menzel”. In July 1935 Menzel’s painting “Pariser Wochentag” came into the possession of the Galerie Paffrath, the same gallery which earlier that year Hupp had commissioned to look for a work by Menzel. -

Ehrenbürger Der Stadt Dresden Johann Paul Von
Ehrenbürger der Stadt Dresden Johann Paul von Falkenstein geb.: 15.06.1801 Hof- und Justizrat, Geheimer Regierungsrat gest.: 14.01.1892 7. Oktober 1833 Friedrich August Bevilaqua geb.: nach 30.04.1777 Generalmajor, Kommandant der Kommunalgarde gest.: 18.12.1845 21. Juni 1838 Bernhard August von Lindenau geb.: 11.06.1779 Staatsminister, Verfasser der Allgemeinen Städteordnung für Sachsen gest.: 21.05.1854 4. September 1843 Karl Heinrich Westen geb.: vor 1790 Registrator im Kriegsministerium, Armenvorsteher gest.: 09.06.1849 17. Dezember 1848 Karl Gottfried Theodor Winkler (Theodor Hell) geb.: 07.02.1775 Schriftsteller, Hofrat, gest.: 24.09.1856 Vizedirektor der kgl. musikalischen Kapelle und des Hoftheaters 5. März 1851 Friedrich Ferdinand Gottlieb von Globig geb.: 15.12.1771 Geheimrat und Kammerherr gest.: 08.09.1852 5. Dezember 1851 D. Friedrich August Franke geb.: 1792 Konsistorialrat, Hofprediger gest.: 17.07.1855 1. August 1853 Graf Franz Seraphicus von Kuefstein geb.: 08.03.1794 Wirkl. Geheimrat und Kämmerer, bevollm. Minister, gest.: 03.01.1871 österreichischer Gesandter in Dresden von 1845 - 1854 21. November 1855 Kronprinz Albert geb.: 23.04.1828 30. Mai 1857 gest.: 19.06.1902 Friedrich Ferdinand von Beust geb.: 13.01.1809 Staatsminister gest.: 24.10.1886 30. Mai 1857 .../2 Dr. Ferdinand von Zschinsky geb.: 22.02.1797 Staatsminister gest.: 28.10.1858 30. Mai 1857 Eduard von Könneritz geb.: 10.04.1802 Wirkl. Geheimer Rat, Kreisdirektor gest.: 12.08.1875 15. Dezember 1864 Heinrich Gustav Friedrich von Hake geb.: um 01.03.1797 Generalleutnant, Gouverneur von Dresden gest.: 15.12.1877 15. Dezember 1864 Johann Meyer geb.: 28.01.1800 Großkaufmann, Stifter von Stipendien gest.: 06.01.1887 1. -

Antisemitismus Und Judenverfolgung in Dresden 1933–19451
Mike Schmeitzner Tödlicher Hass: Antisemitismus und Judenverfolgung in Dresden 19 –19"#1 In Dresden existierte seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ein antisemitisch-völkisches Milieu, das die Präsenz eines wirkmächti en Antisemitismus, den Aufstie der #$DAP und deren Juden%&litik nach 1933 rundle end (eeinflusste. Tr&tz der verhältnismä*i erin en +ahl an Juden in der $tadt er ri""en die #ati&nals&zialisten und ihr ,ührer Martin Mutschmann zahlreiche .i eninitiativen, um das /0-dische Pr&(lem‘ zu (eseiti en. Der Aufsatz zeichnet 2rundla en und Praxis der nati&nal- s&zialistischen Juden%&litik in der sächsischen 2auhauptstadt zwischen 1933 und 1944 nach, die durch verschiedene Bes&nderheiten -(er die all emeine .ntwicklun v&n .ntrechtun , Aus renzun und 6er"&l un der Juden hinaus in . An anti-$emitic and nati&nalistic milieu emer ed in Dresden in the last third &f the 19th century. It had a fundamental influence &n eneratin a %&werful anti-$emitism, as well as &n the rise &f the re i&nal #$DAP and its 8Jewish %&licies8 after 1933. .ven th&ugh there were relatively "ew Jews in the city, the #ati&nal $&cialists and their $ax&n leader Martin Mutschmann underto&k numer&us initiatives to eliminate the 8Jewish %r&(lem8. This article traces the fundamentals and %ractices &f #ati&nal $&cialist 8Jewish %&licies8 in the $ax&n ca%ital &f the 2au fr&m 1933 t& 1944. These went far (e7&nd the typical de%rivati&n, s&cial exclusi&n, and %ersecuti&n &f Jewish citizens that devel&%ed elsewhere in 2ermany. -

Völkisch Writers and National Socialism
CULTURAL HISTORY AND LITERARY IMAGINATION This book provides a view of literary life under the Nazis, highlighting • Guy Tourlamain the ambiguities, rivalries and conflicts that determined the cultural climate of that period and beyond. Focusing on a group of writers – in particular, Hans Grimm, Erwin Guido Kolbenheyer, Wilhelm Schäfer, Emil Strauß, Börries Freiherr von Münchhausen and Rudolf Binding – it examines the continuities in völkisch-nationalist thought in Germany from c.1890 into the post-war period and the ways in which völkisch-nationalists identified themselves in opposition to four successive German regimes: the Kaiserreich, the Weimar Republic, the Third Reich and the Federal Republic. Although their work Völkisch predated Hitler’s National Socialist movement, their contribution to preparing the cultural climate for the rise of Nazism ensured them continued prominence in the Third Reich. Those who survived into the post-war era continued to represent the völkisch-nationalist worldview in the West German public sphere, opposing both Socialism and National Writers the Soviet and liberal-democratic models for Germany’s future. While not uncontroversial, they were able to achieve significant publishing success, suggesting that a demand existed for their works among the German public, stimulating debate about the nature of the recent past and its effect on Germany’s cultural and political identity and position in the world. Völkisch Writers and National Socialism Guy Tourlamain received his D.Phil. from Oxford University in 2007. He also spent time as a visiting student at the University of Gießen, A Study of Right-Wing Political Culture University of Hamburg and Humboldt University in Berlin as well as undertaking postdoctoral research at the German Literature in Germany, 1890–1960 Archive in Marbach am Neckar. -

APOCALYPSE Setting 1995(Quarkx)
David Irving is the son of a Royal Navy commander. Educated at Imperial College of Science & Technology and at University College London, he subsequently spent a year in Germany working in a steel mill and perfecting his fluency in the language. Among his thirty books the best-known include Hitler’s War, The Trail of the Fox: The Life of Field-Marshal Rommel, Accident, the Death of General Siko- rski, The Rise and Fall of the Luftwaffe and Göring: a Biography. He has translated several books by other authors. He lives in Grosvenor Square, London, and is the father of five daughters. In 1963 he published his first English language book, The Destruction of Dresden. Translated and published around the world, it became a best-seller in many countries. The present volume, Apocalypse 1945, revises and updates that work on the basis of information which has become available since 1963. DAVID IRVING APOCALYPSE 1945 The Destruction of Dresden F FOCAL POINT Copyright © Focal Point, London 1995 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied, or transmitted save with written permission of in accordance with the provisions of the Copyright Act 1956 (as amended). Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. The Destruction of Dresden was first published in Great Britain by William Kimber & Co. Ltd 1963, in a revised and updated edition in 1971 by Corgi Books Ltd, and by Papermac, a division of Macmillan Publishers Ltd, in 1985.