Gerstenmaier Und Adenauer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
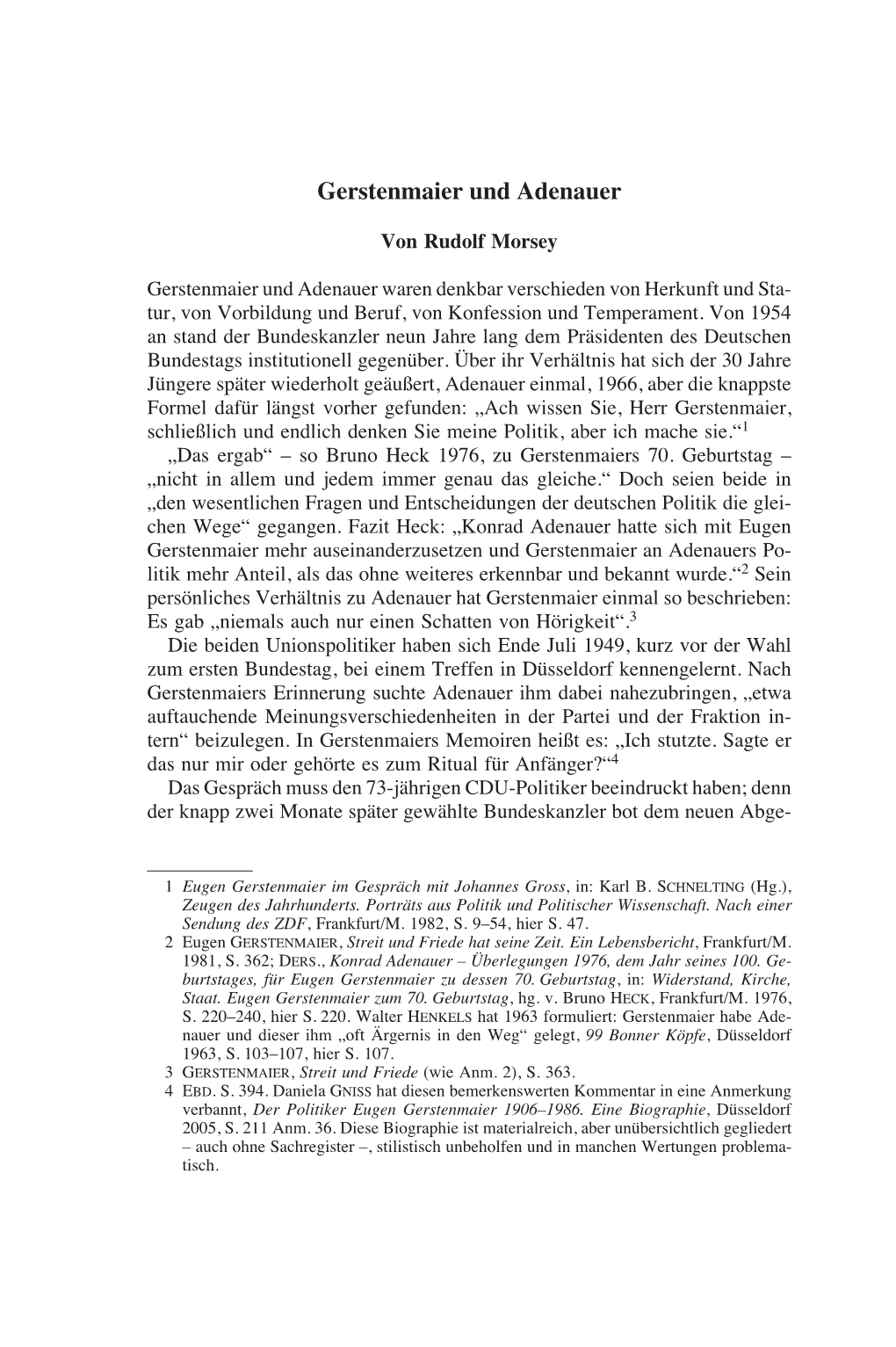
Load more
Recommended publications
-

Central Europe
Central Europe West Germany FOREIGN POLICY wTHEN CHANCELLOR Ludwig Erhard's coalition government sud- denly collapsed in October 1966, none of the Federal Republic's major for- eign policy goals, such as the reunification of Germany and the improvement of relations with its Eastern neighbors, with France, NATO, the Arab coun- tries, and with the new African nations had as yet been achieved. Relations with the United States What actually brought the political and economic crisis into the open and hastened Erhard's downfall was that he returned empty-handed from his Sep- tember visit to President Lyndon B. Johnson. Erhard appealed to Johnson for an extension of the date when payment of $3 billion was due for military equipment which West Germany had bought from the United States to bal- ance dollar expenses for keeping American troops in West Germany. (By the end of 1966, Germany paid DM2.9 billion of the total DM5.4 billion, provided in the agreements between the United States government and the Germans late in 1965. The remaining DM2.5 billion were to be paid in 1967.) During these talks Erhard also expressed his government's wish that American troops in West Germany remain at their present strength. Al- though Erhard's reception in Washington and Texas was friendly, he gained no major concessions. Late in October the United States and the United Kingdom began talks with the Federal Republic on major economic and military problems. Relations with France When Erhard visited France in February, President Charles de Gaulle gave reassurances that France would not recognize the East German regime, that he would advocate the cause of Germany in Moscow, and that he would 349 350 / AMERICAN JEWISH YEAR BOOK, 1967 approve intensified political and cultural cooperation between the six Com- mon Market powers—France, Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. -

Bbm:978-3-322-95484-8/1.Pdf
Anmerkungen Vgl. hierzu: Winfried Steffani, Monistische oder pluralistische Demokratie?, in: Günter Doeker, Winfried Steffani (Hrsg.), Klassenjustiz und Pluralismus. Festschrift ftir Ernst Fraenkel, Ham burg 1973, S. 482-514, insb. S. 503. 2 Da es im folgenden um die Untersuchung eines speziellen Ausschnittes des bundesdeutschen Regierungssystems geht, kann unter dem Aspekt arbeitsteiliger Wissenschaft auf die Entwick lung eines eigenständigen ausgewiesenen Konzepts parlamentarischer Herrschaft verzichtet werden. Grundlegend ftir diese Untersuchung ist die von Winfried Steffani entwickelte Parla mentarismustheorie, vgl. zuletzt: ders., Parlamentarische und präsidentielle Demokratie, Opla den 1979, S. 160-163. 3 Steffani, Parlamentarische und präsidenticlle Demokratie, a.a.O., S. 92f. 4 Theodor Eschenburg, Zur politischen Praxis in der Bundesrepublik, Bd. 1, 2. überarbeitete und mit Nachträgen versehene Auflage, München 1967, Vorwort, S. 10. 5 Zur Bedeutung des Amtsgedankens für die politische Theorie vgl. Wilhelm Hennis, Amtsgedanke und Demokratiebegriff, in: ders., Die mißverstandene Demokratie, Freiburg im Breisgau 1973, S.9-25. 6 Ein Amtseid für Parlamentspräsidenten, so wie er von Wolfgang Härth gefordert wird, würde dieser Verpflichtung des Bundestagspräsidenten öffentlichen Ausdruck verleihen und sie damit zusätzlich unterstreichen. Eine Vereidigung des Bundestagspräsidenten wäre schon allein aus diesem Grunde sinnvoll und erforderlich. Vgl. Wolfgang Härth, Parlamentspräsidenten und Amtseid, in: Zeitschrift ftir Parlamentsfragen, Jg. 11 (1980), S. 497·503. 7 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, übersetzt und herausgegeben von Franz Dirlmeier, 5. Aufl. Berlin (Akademie-Verlag) 1969, 1094b (S. 6f): "Die Darlegung wird dann befriedigen, wenn sie jenen Klarheitsgrad erreicht, den der gegebene Stoff gestattet. Der Exaktheitsanspruch darf nämlich nicht bei allen wissenschaftlichen Problemen in gleicher Weise erhoben werden " 8 Vgl. als Kritik aus neuerer Zeit z. -

Erdverbunden Und Einfallsreich Lebenserinnerungen Des Sozialdemokraten Hans „Lumpi“ Lemp
Erdverbunden und einfallsreich Lebenserinnerungen des Sozialdemokraten Hans „Lumpi“ Lemp Lebenserinnerungen des Sozialdemokraten Hans „Lumpi“ Lemp ISBN 978-3-95861-499-4 Reihe Gesprächskreis Geschichte ISSN 0941-6862 und einfallsreich Erdverbunden Heft 106 Erdverbunden und einfallsreich Lebenserinnerungen des Sozialdemokraten Hans „Lumpi“ Lemp Gesprächskreis Geschichte Heft 106 Friedrich-Ebert-Stiftung Archiv der sozialen Demokratie GESPRÄCHSKREIS GESCHICHTE | HEFT 106 Herausgegeben von Anja Kruke und Meik Woyke Archiv der sozialen Demokratie Kostenloser Bezug beim Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung Email: [email protected] <http://library.fes.de/history/pub-history.html> © 2017 by Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn Eine gewerbliche Nutzung der von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegebenen Medien ist ohne schriftliche Zustimmung der Herausgeberin nicht gestattet. Redaktion: Jens Hettmann, Patrick Böhm unter Mitarbeit von Helmut Herles Gestaltung und Satz: PAPYRUS – Lektorat + Textdesign, Buxtehude Umschlag: Pellens Kommunikationsdesign GmbH Druck: bub Bonner Universitäts-Buchdruckerei Bildmaterial: Soweit nicht anders vermerkt, stammen die hier verwendeten Fotos aus dem Familienbesitz Lemp; die Coverabbildung und die Abbildung auf S. 40 wurden uns von Volker Ernsting freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt; das Foto auf S. 22 haben wir unentgelt- lich von der Rechteinhaberin Nordphoto Vechta (Ferdinand Kokenge) erhalten. Eventuelle Rechte weiterer Dritter konnten nicht ermittelt werden. Für aufklärende -

Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis Jürgen Peter Schmied Sebastian Haffner Eine Biographie 683 Seiten, Gebunden ISBN: 978-3-406-60585-7 © Verlag C.H.Beck oHG, München Quellen- und Literaturverzeichnis I. Quellen A Ungedruckte Quellen 1. Akten Archiv der Humboldt Universität zu Berlin. Matrikelbuch, Rektorat, 600/116. Jur. Fak., Bd. 309. BBC Written Archive Centre, Reading. RCont 1, Sebastian Haffner File 1. Bundesarchiv. Personalakte Raimund Pretzel, R 3001, 71184. Personalakte Raimund Pretzel, ehemals BDC, RKK 2101, Box 0963, File 09. Bundesbehörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Berlin. ZA, MfS – HA IX/11. AF Pressemappe. ZA, MfS – HA IX/11. AF Z I, Bd. 3. ZA, MfS – HA IX/11. AF N-II, Bd. 1, Bd. 2. ZA, MfS – F 16/HVA. ZA, MfS – F 22/HVA. National Archives, Kew. FO 371/24424 FO 371/26554 FO 371/106085 HO 334/219 INF 1/119 KV 2/1129 KV 2/1130 PREM 11/3357 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin. B 8, Bd. 1498. B 11, Bd. 1019. 2 2. Nachlässe NL Konrad Adenauer Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, Rhöndorf. NL Raymond Aron École des hautes études en sciences sociales, Paris. Centre de recherches politiques Raymond Aron. NL David Astor Privatbesitz. NL Margret Boveri Staatsbibliothek zu Berlin, Handschriftenabteilung. NL Willy Brandt Archiv der sozialen Demokratie. Friedrich-Ebert- Stiftung, Bonn. NL Eugen Brehm Institut für Zeitgeschichte, München. NL William Clark Bodleian Library, Oxford. Department of Special Col- lections and Western Manuscripts. NL Arthur Creech Jones Rhodes House Library, Oxford. NL Isaac Deutscher International Institute of Social History, Amsterdam. NL Sebastian Haffner Bundesarchiv. -

Information Issued by the Association of Jewish Refugees in Great Britain
Vol. XVIII No. 1 January, 1963 INFORMATION ISSUED BY THE ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN a FAIRFAX MANSIONS, FINCHLEY RD. (corner Fairfax Rd.), London, N.W.3 Off let and Consulting Houn: Telephone : MAIda Vale 9096.'7 (General Ofhce and Welfare for the Aged) Monday to Tluirsday 10 a.m.—1 p.m. 3—6 p.m. MAIda Vale 4449 (Employment Agency, annually licensed by the L.C.C.. and Social Services Dept.) fridaf 10 ajn.-1 p.m. Or. Rudolf R. Levy against any reference to international jurisdiction, and those who—as did Great Britain, France and Holland—sponsored the appeal to an ii}temational court, whether the Intemational Court of Justice PROTECTION AGAINST GROUP ATROCITIES or a special international high court for deating with acts of genocide. The latter took their stand on the fact that genocide could rarely be com The Genocide Convention mitted without the participation and tolerance of the State and therefore it would be, as the repre In connection with the neo-Nazi occurrences acceptance of rules applied first only among sentative of the Philippines formulated it, para Sir Barnett Janner, M.P., President of the Board of several nations and gradually becoming recognised doxical to leave punishment to the same State. Deputies, initiated a debate in the House of principles of international law." On the other hand, it may safely be assumed that Commons some time ago on the question of Great To avoid difficulties arising from the interpreta those who oppose international jurisdiction on Britain's accession to the Genocide Convention, tion of a general concept, a list of acts was given this matter would also not accept the jurisdiction the international agreement against group murder, in Article 2 which fall within the meaning of of a high court of this kind. -

01-026 Margot Kalinke
01-026 Margot Kalinke ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 01 – 026 MARGOT KALINKE SANKT AUGUSTIN 2014 I Inhaltsverzeichnis 1 Persönliches 1 2 Korrespondenz 5 3 Zonenbeirat und Wirtschaftsrat der Bizone 8 4 Deutscher Bundestag 9 4.1 Bundestagsausschuss für Sozialpolitik 9 5 Deutsche Partei (DP) 12 5.1 Parteitage der DP 14 6 CDU 16 7 Wahlen 17 7.1 Bundestagswahlen 17 7.2 Landtagswahlen Niedersachsen 18 7.3 Kommunalwahlen Niedersachsen 19 8 Materialsammlung 20 Sachbegriff-Register 21 Ortsregister 27 Personenregister 28 Biographische Angaben: 1909 04 23 geboren in Bartschin (Posen-Westpreußen), evangelisch deutsches Lyzeum und Gymnasium in Bromberg (Oberprimareife) 1925 Ausweisung aus Polen 1926 Ansiedlung in Niedersachsen höhere Handelsschule 1926-1927 kaufmännische Angestellte in der Textilindustrie 1927-1937 Leiterin einer Fabrikniederlage in Goslar und Hannover 1926-1933 Mitglied des Verbandes Weiblicher Angestellter (VWA) 1937-1946 Geschäftsführerin des Verbandes der Angestelltenkrankenkassen in Hannover 1946-1948 Mitglied des Zonenbeirats der Britischen Besatzungszone 1947-1952 Verband der Angestelltenkrankenkassen in Hamburg 1947 Mitbegründerin der Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -Gestaltung 1947-1949 Mitglied des Landtages in Niedersachsen (NLP) ab 1949 erneut Mitglied des Verbandes Weiblicher Angestellter (VWA), 1949-1969 Hauptausschussvorsitzende, seit 1969 Bundesvorsitzende 1949-1953 und 1955-1972 Mitglied des Bundestages, für die Wahlkreise Burgdorf-Celle und Hannover-Nord -

Archivbericht Quellen Zur Planung Des Verteidigungsbeitrages Der
Archivbericht Dieter Krüger / Dorothe Ganser Quellen zur Planung des Verteidigungsbeitrages der Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 1955 in westdeutschen Archiven' Seit etwa 15 Jahren wendet sich die Zeitgeschichtsschreibung verstärkt der Frühphase der Bundesrepublik im Kontext der zeitgenössischen internationalen Entwicklung zu. Zwangs- läufig standen in diesen Jahren infolge des Krieges sozial-, wirtschafts- und finanzpolitische Fragen gegenüber der Sicherheitspolitik im Vordergrund der innenpolitischen Debatten und des Interesses der Bürger. Gleichwohl wurde nicht nur die Außen-, sondern auch die Innen- politik und die politische Kultur der frühen Bundesrepublik von der Auseinandersetzung um einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag nachhaltig geprägt. So in etwa lautet die Quint- essenz der beiden ersten Bände der vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt herausgege- benen Reihe »Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik«'. Im Gegensatz zu diesen den aktuellen Forschungsstand wiedergebenden Bänden schöpften die nach wie vor wichtigen älteren Studien von Gerhard Wettig, Arnulf Baring, Edward Furs- don, Paul Noack, Gunther Mai und Klaus v. Schubert vorwiegend aus publizierten Quellen^. Von den jüngst erschienenen Arbeiten von Armand Glesse, Montecue Lowry und Rolf Stei- ninger führt eigentlich nur der letzte über den gegenwärtigen Stand hinaus^. Die nicht nur in der Bundesrepublik übliche Dreißig-Jahre-Sperrfrist für die Benutzung amt- licher Unterlagen"* erlaubt freilich mittlerweile die Benutzung und nicht zuletzt das Zitie- ren der -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Inhaltsübersicht über die Bände 2 und 3 XVIII Einleitung XXXV Abbildungsteil XL ff. 1 Wann beginnt der neue deutsch-jüdische Dialog? 3 1.1 Dr. Siegfried Moses: Die Wiedergutmachungsforderungen der Juden . 3 1.2 Bevor der offizielle Teil der Geschichte beginnt 15 1.3 Ein Gutachten von Hendrik van Dam 19 2 Die ersten Fühler werden ausgestreckt 26 2.1 Ereignisreiches Jahr 1950 26 2.2 Zum ersten Mal: Deutsche Abgeordnete bei einem Kongreß der Interparlamentarischen Union 27 2.3 Weitere Kontakte im menschlichen Bereich - Friede mit Israel 30 2.3.1 Erich Lüth und Rudolf Küstermeier 31 3 Die bedeutende Note vom 12. März 1951 — Auf dem Weg zu den deutsch-israelischen Verhandlungen 33 3.1 Die Note der israelischen Regierung zum 12. März 1951 33 3.2 Erste offizielle Überlegungen zur Wiedergutmachung in der Bundesrepublik 39 3.2.1 Kurt Schuhmachers Rede vor dem Deutschen Bundestag vom 21. September 1949 39 3.2.2 Regierungserklärung zur jüdischen Frage und zur Wieder- gutmachung 45 3.3 Auf dem Wege zu den deutsch-israelischen Verhandlungen 50 3.3.1 Deutsche Verhandlungsvorbereitungen 51 3.3.2 Die Londoner Schuldenkonferenz und die Wiedergutmachungs- verhandlungen 53 4 Die Wiedergutmachungsverhandlungen in Wassenaar 55 4.1 Der Verlauf der Verhandlungen 55 4.1.1 Das finanzielle Limit bringt Komplikationen 58 4.1.2 Prof. Böhm schreibt an den Bundeskanzler 61 4.1.3 Im Hinblick auf die Londoner Schuldenverhandlungen werden die Wassenaaer Beratungen unterbrochen 64 4.1.4 Goldmann und Böhm treffen sich in Paris 67 4.1.5 Das Kommunique -

HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv Für Christlich-Demokratische Politik
1 HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv für Christlich-Demokratische Politik Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. herausgegeben von Günter Buchstab und Hans-Otto Kleinmann 7. Jahrgang 2000 BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN 2 HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv für Christlich-Demokratische Politik 7. Jahrgang 2000 Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. herausgegeben von Dr. Günter Buchstab und Prof. Dr. Hans-Otto Kleinmann Redaktion: Dr. Felix Becker Anschrift: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Wissenschaftliche Dienste Archiv für Christlich-Demokratische Politik Rathausallee 12 53757 Sankt Augustin bei Bonn Tel 02241 / 246 210 Fax 02241 / 246 669 e-mail: x.400: c=de: a=dbp; p=kas; o=wd; s=zentrale-wd internet: [email protected] Verlag: Böhlau Verlag GmbH & Cie, Ursulaplatz 1, D-50668 Köln e-mail: [email protected] Die Zeitschrift »HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN/Archiv für Christlich-Demokratische Politik« erscheint einmal jährlich mit einem Heftumfang von ca. 260 Seiten. Der Preis beträgt DM 38,–. Ein Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn die Kündigung nicht zum 1. Dezember erfolgt ist. Zuschriften, die Anzeigen und Vertrieb betreffen, werden an den Verlag erbeten. © 2000 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Alle Rechte vorbehalten Satz: Satzpunkt Bayreuth GmbH Druck und Verarbeitung: MVR-Druck, Brühl ISSN 0943-691X Inhalt AUFSÄTZE Winfried Becker Die Deutsche Zentrumspartei gegenüber dem Nationalsozialismus und dem Reichskonkordat 1930–1933: Motivationsstrukturen und Situationszwänge . 1 Herbert Hömig Heinrich Brüning – Kanzler in der Krise der Weimarer Republik. Eine Bilanz nach siebzig Jahren . 39 Bernd Schäfer Priester in zwei deutschen Diktaturen. Die antifaschistische Legende des Karl Fischer (1900–1972) . 53 Gerhard Wettig Programmatische und pragmatische Elemente in Stalins Deutschland- Politik 1945–1953. -

Christdemokratische Grundwerte Der Adenauer-CDU Im Spiegel Der Deutsch-Deutschen Teilung Und in Ableitung Auf Den Realsozialistischen Osten (1945 Bis 1966)
„Es sind Deutsche, in unseren Augen sowjetische Satelliten…“: Christdemokratische Grundwerte der Adenauer-CDU im Spiegel der deutsch-deutschen Teilung und in Ableitung auf den realsozialistischen Osten (1945 bis 1966) Dissertation zur Erlangung des sozialwissenschaftlichen Doktorgrades der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen vorgelegt von Karolina Lang-Vöge, geborene Lang aus Gdingen, Polen Göttingen 2012 1 1. Gutachter: Professor Dr. Franz Walter, Universität Göttingen 2. Gutachter: Professor Dr. Klaus Ziemer, Universität Trier Tag der mündlichen Prüfung: 5. März 2012 2 Gliederung der Dissertation: I. Hinführung zum Thema (S. 5) II. Forschungsdesign II. 1. Erkenntnisinteresse (S. 24) II. 2. Operationalisierung und konstruktivistischer Ansatz (S. 30) II. 3. Stand der Forschung (S. 37) II. 4. Quellenkorpus und Quellenkritik (S. 39) III. Würde, Freiheit und Frieden III. 1. Christliches Menschenbild und ‚interkonfessionelle Brücke der Freiheit‘ (S. 45) III. 2. Unfreiheit und Unwürde (S. 57) III. 3. Frieden vs. Gewalt (S. 70) III. 4. Evolution statt Revolution (S. 94) III. 5. Kern des Kapitels (S. 101) IV. Staat, Recht und Wahrheit IV. 1. Demokratie vs. Totalitarismus (S. 103) IV. 2. Recht vs. Unrecht (S. 114) IV. 3. Illegitimität, Unwahrheit und Unwürde (S. 130) IV. 4. Kern des Kapitels (S. 142) V. Volk und Auftrag V. 1. Bekenntnis und Verantwortung (S. 143) V. 2. Sendung, Symbole und Vertrauen (S. 154) V. 3. Einheit der Deutschen und Einheit der Christen (S. 177) V. 4. Kern des Kapitels (S. 192) VI. Christ im Westen, Antichrist im Osten VI. 1. Vermassung, Materialismus und Kollektivismus (S. 194) VI. 2. Christ und Antichrist in Deutschland und Europa (S. 219) VI. -

Förderalistische Politik in Der CDU/CSU. Die
WOLFGANG BENZ FÖDERALISTISCHE POLITIK IN DER CDU/CSU DIE VERFASSUNGSDISKUSSION IM „ELLWANGER KREIS" 1947/48 Nach dem Zusammenbruch des wilhelminischen Reichs beschäftigte sich im De zember 1918 eine Expertenkommission unter dem Vorsitz von Hugo Preuß in Berlin mit dem Entwurf einer neuen Reichsverfassung. Wenig später setzten sich in Stuttgart die Regierungschefs und Minister der süddeutschen Länder zu sammen, um ihrerseits zu beraten, wie das Schlimmste zu verhindern sei, nämlich eine zentralistische Verfassungsordnung des Deutschen Reiches, auf die die Ber liner Bemühungen ihrer Meinung nach zwangsläufig hinauslaufen würden. Die Entstehungsgeschichte der Weimarer Verfassung stand dann auch im Zeichen des Widerstreits zwischen Föderalismus und Zentralismus1. Auf der einen Seite wurde mit dem Prinzip der Volkssouveränität argumentiert, mit Blick auf eine verfas sunggebende Nationalversammlung, auf ein möglichst omnipotentes zentrales Parlament und auf eine starke Reichsexekutive, auf der Gegenseite wurde der Grundsatz der Eigenstaatlichkeit der Länder zäh verteidigt: Dem Gesamtstaat sollten nur die notwendigsten Souveränitätsrechte für Legislative und Exekutive übertragen werden. Diese Antagonie zeigte sich während der ganzen Weimarer Zeit am deutlichsten in den Streitigkeiten zwischen Bayern und dem Reich. Zieht man jedoch ab, was dem Konto des partikularen Egozentrismus der bayerischen Regierungen — von Eisner bis Held — speziell anzulasten war, so blieb ein beacht licher Grundsatz-Dissens zwischen der föderal-gouvernementalistischen -
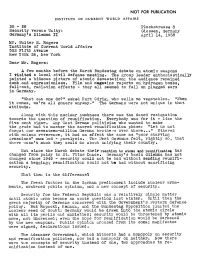
Security Versus Unity: Germany's Dilemma II
NOT FOR PUBLICATION INSTITUTE OF CURRENT VORLD AFFAIRS DB- 8 Plockstrasse 8 Security versus Unity: Gie ssen, Germany Germany' s Dilemma II April l, 19G8 Mr. Walter S. Rogers Institute of Current World Affairs 522 Fifth Avenue ew York 36, Eew York Dear Mr. Rogers: A few months before the -arch Bundestag debate on atomic weapons I Islted a local civil defense meeting. The group leader enthusiastically painted a hideous picture of atomic devastation; the audience remained dumb arid expressionless. Film and magazine reports on hydrogen bombs, fall-out, radiation effects they all seeme to fall on plugged ears in Germany. "at can one do?"'asked Kurt Odrig, who sells me vegetables. "Yhen it comes, we're all goers anyway." The Germans were not uique in that attitude. Along with this nuclear numbness there was the dazed resignation towards the question of reunification. Everybody was for it like the fiv cent clgar. Any West German politlclan who wanted to make the rade had to master the sacred roeunification phase: "Let us not forget our seventeen-million German brothe.,,_s over there..." Uttered ith solen reverence, it had an effect tho same as ,'poor starving rmenlans" ,once had paralysis. The Test Germans felt, rightly so, that there ,sn't much they could do about uifying their country. But since the arch debate their ,reaction to atoms and reunificatoa has changed from palsy to St. Vitus Dance. Germany's basic dilemma has not changed since 1949 security could not be had without sending reunifi- cation a begging; reunification could not be had without sacrificing security.