Clausewitz-Gesellschaft E.V. Jahrbuch 2011
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

List of Participants Based on Information Received by Thursday, 20 September 2012
Atoms for Peace General Conference GC(56)/INF/9 Date: 21 September 2012 General Distribution English only Fifty-sixth regular session Vienna, 17–21 September 2012 List of Participants Based on information received by Thursday, 20 September 2012 Pages 1. Member States 1–109 2. Representation of States not Members of the Agency 110 3. Entities Having Received a Standing Invitation to Participate as Observers 111 in the Sessions and Work of the General Conference 4. United Nations and Specialized Agencies 112 5. Intergovernmental Organizations (IGOs) other than the United Nations and 113–116 its Specialized Agencies 6. Non-Governmental Organizations (NGOs) 117–123 The List of Participants contains information as provided by delegations. Member States Alternates: Mr Spiro KOÇI Afghanistan, Islamic Republic of Ambassador Head of Delegation: Resident Representative to the IAEA Permanent Mission to the IAEA in Vienna Mr Abdul M. SHOOGUFAN Ambassador* Advisers: Resident Representative to the IAEA Permanent Mission to the IAEA in Vienna Mr Jovan THERESKA Adviser to the Ambassador Alternates: Permanent Mission to the International Organizations in Vienna Mr Abdul Hai NAZIFI Director General Other members of delegation: Afghan Atomic Energy High Commission Mr Adhurim RESULI Mr Sayed Yusuf GAILANI Minister Minister-Counsellor Alternate to the Resident Representative Alternate to the Resident Representative Permanent Mission to the IAEA in Vienna Permanent Mission to the IAEA in Vienna Mr Milo KUNESHKA Mr Daoud HACHEMI Director First Secretary National -

Zur Wehrpflicht: Es Geht Um Sicherheit Und Freiheit —
Nr. 1/2013 Herausgeber: Chef der Armee Beilage zur ASMZ 6/13 und RMS 3/13 Military Power Revue — der Schweizer Armee de l’Armée Suisse T PFLICH WEHR ZUR Der Chef der Armee ist Herausgeber der Herstellung: Redaktionskommission: MILITARY POWER REVUE. Zentrum elektronische Medien ZEM, Oberst i Gst Jürg Kürsener Stauffacherstrasse 65/14 Chefredaktor MILITARY POWER REVUE Die MILITARY POWER REVUE erscheint zweimal 3003 Bern jährlich (Ende Mai und Ende November). 031 325 55 90 Colonel EMG Laurent Currit Leiter Doktrinforschung & Entwicklung Die hier dargelegten Analysen, Meinungen, Druck: (Armeestab) Schlussfolgerungen und Empfehlungen sind galledia ag ausschliesslich die Ansichten der Autoren. Burgauerstrasse 50, Oberst i Gst Christoph Müller Sie stellen nicht notwendigerweise den Stand- 9230 Flawil Chef Heeresdoktrin und Redaktor Bereich Heer punkt des Eidgenössischen Departementes Tel. 058 344 96 96 für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Oberst i Gst Wolfgang Hoz (VBS) oder einer anderen Organisation dar. Chefredaktion Military Power Revue: Chef Doktrin, Luftwaffe und Redaktor Bereich Oberst i Gst Jürg Kürsener Luftwaffe Die Artikel der MILITARY POWER REVUE Sonnenbergstrasse 14 können unter Angabe der Quelle frei kopiert 4573 Lohn-Ammannsegg und wiedergegeben werden. Ausnahmen gelten Tel. 032 677 18 63. dort, wo explizit etwas anderes gesagt wird. E-Mail: [email protected] Die MILITARY POWER REVUE ist Beiheft der Chefredaktion ASMZ: Allgemeinen Militärzeitschrift ASMZ und Oberst i Gst Peter Schneider der Revue Militaire Suisse -

EU-Mission Im Kongo • Milieu-Studie • »Gewissen Und Gehorsam« – 46
HEFT 263 – SEPTEMBER 2006 46. JAHRGANG • EU-Mission im Kongo • Milieu-Studie • »Gewissen und Gehorsam« – 46. Woche der Begegnung • Menschenrecht Religionsfreiheit Bioethik Gefunden auf der Wäscheleine des Saarbrücker Katholikentages www.katholische-soldaten.de HEFT 263 – SEPTEMBER 2006 AUFTRAG 46. JAHRGANG INHALT EDITORIAL .......................................................... 3 Widerlegt die Renaissance des Religiösen die Säkularisierungsthese? (KNA)...................... 34 SICHERHEIT UND FRIEDENSETHIK Pfarrgemeinden im Urteil der Katholiken: ZUR DEUTSCHEN BETEILIGUNG AN DER KONGO-MISSION Erstaunliche Zustimmung – „Nicht nur Niedergang“ DER EU.................................................................... 4 (KNA) ............................................................... 34 Der Kongoeinsatz der Europäischen Union Von Wohnzimmern und Sinn im Leben – Religiöse – ein tragbares Risiko? von Ludwig Jacob und und kirchliche Orientierungen im Spiegel der H.G. Justenhoven ................................................ 4 Sinus-Milieus von Martin Hochholzer ................... 36 Stimmen zum Kongo-Einsatz der Bundeswehr Joseph Ratzinger über die Demokratie (KNA) ................................................................. 9 in der Kirche (ZENIT.org) ................................ 40 UN: Kinder in Konflikten besser schützen ............ 10 Interview: „Ein Stück Gelassenheit“ GESELLSCHAFT NAH UND FERN von KNA-Mitarbn. B. Buchner u. C. Scholz ....... 11 Universalen Menschenrechten droht Relativierung Segen der missio-Präsidenten -

Die Neue Bundeswehr
SOWI-ARBEITSPAPIER Nr. 112 Heiko Biehl Die neue Bundeswehr Wege und Probleme der Anpassung der deutschen Streitkräfte an die außen- und sicherheitspolitischen Herausfor- derungen nach dem Ende des Kalten Krieges ________________________ Strausberg, August 1998 2 Vorwort des Herausgebers Im vorliegenden Arbeitspapier analysiert der Autor den erforderlichen Anpassungs- prozeß der Bundeswehr an die außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen nach dem Ende des Kalten Krieges, setzt sich dabei kritisch mit den Planungen zur Struktur und Ausrüstung der Bundeswehr auseinander und beleuchtet schließlich aus- führlich die aus dem Anpassungsprozeß resultierenden Implikationen für die zukünftige Ausbildung der Soldaten und des Führerkorps der Bundeswehr sowie damit einherge- hende Änderungen im soldatischen Selbstverständnis. Insgesamt handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine gekürzte Fassung der Magisterarbeit des Autors an der Universität Potsdam, die in wesentlichen Teilen wäh- rend eines Praktikums am Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr entstanden ist. Ich lege dabei allerdings Wert auf die Feststellung, daß die vorgenommenen Bewertun- gen und Schlußfolgerungen – insbesondere zur Struktur und Ausrüstung der Bundes- wehr – ausschließlich die Auffassung des Autors widerspiegeln und nicht mit einer wie auch immer gearteten Institutsmeinung gleichzusetzen sind. Der Veröffentlichung dieser Arbeit in einer Publikationsreihe des Sozialwissen- schaftlichen Instituts der Bundeswehr habe ich dennoch gern zugestimmt, da -
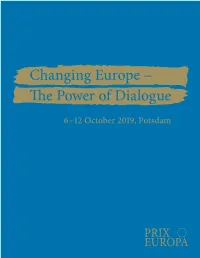
Changing Europe – the Power of Dialogue
Changing Europe – The Power of Dialogue 6 –12 October 2019, Potsdam Changing Europe – The Power of Dialogue 6 –12 October 2019, Potsdam hosted by supported by 2 Changing Europe – The Power of Dialogue In a world that is faster, more complicated and fragmented than ever, it is easy to only speak and never listen, to only tweet and never talk. Pressures of pace and finance are mounting. So it is more important than ever to have strong public service media that provide quality journalism that goes out of its way to be a trusted guide, to bring people together and set a tone that enables dialogue. PRIX EUROPA is ALL about dialogue: Come together from all corners of the continent to exchange views, to see/listen for yourself together with the others, to talk and discuss, to meet and be constructive, rather than judgmental or clever. Grab the opportunity to get into conversation, to change perspective, to challenge your opinions and take away inspiration, a shared experience and new ideas. Cilla Benkö PRIX EUROPA President Director General Sveriges Radio – SR 3 Changing Europe – The Power of Dialogue Dear friends and colleagues, PRIX EUROPA is dedicated to the ideal of a united Europe, which commits itself to democratic, ethical and cultural values. This ideal is, however, in acute danger. We have to dread being abruptly pulled out of a dream that we have been living for over six decades. Of all countries, the Mother of all Democracies, the United Kingdom, is separating itself from our community. Over our Europe of togetherness, that so many people envy us for, the threat of disaster is looming. -

Randauszaehlungbrdkohlband
Gefördert durch: Randauszählungen zu Elitestudien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel Band 21 Die Politisch-Administrative Elite der BRD unter Helmut Kohl (1982 – 1998) Bastian Strobel Simon Scholz-Paulus Stefanie Vedder Sylvia Veit Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen des von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien geförderten Forschungsprojektes „Neue Eliten – etabliertes Personal? (Dis-)Kontinuitäten deut- scher Ministerien in Systemtransformationen“. Zitation: Strobel, Bastian/Scholz-Paulus, Simon/Vedder, Stefanie/Veit, Sylvia (2021): Die Poli- tisch-Administrative Elite der BRD unter Helmut Kohl (1982-1998). Randauszählungen zu Elite- studien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel, Band 21. Kassel. DOI: 10.17170/kobra-202102193307. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ...................................................................................................................................... 1 2 Personenliste ................................................................................................................................ 4 3 Sozialstruktur .............................................................................................................................. 12 4 Bildung ........................................................................................................................................ 16 5 Karriere ....................................................................................................................................... 22 6 Parteipolitisches -

Stadtchronik 1996 – Zusammengestellt Vom Stadtarchiv Koblenz
Stadtchronik 1996 – zusammengestellt vom Stadtarchiv Koblenz Stadtchronik 1996 1. Januar Innerhalb der Stadtverwaltung Koblenz werden das Amt 12/Amt für Statistik und Einwohnerwesen sowie die Abteilungen „Ruhender Verkehr“ und „Bußgeldstelle“ des Amtes 32/Straßenverkehrsamt organisatorisch dem Amt 31/Ordnungsamt angegliedert. Der bisherige Eigenbetrieb „Wertstoffe und Abfälle“ und das Stadtreinigungsamt werden zum Eigenbetrieb „Koblenzer Entsorgung“ zusammengeschlossen. Das neu geschaffene städtische Umweltamt nimmt im Rathausgebäude II seine Tätigkeit auf. Es nimmt folgende Aufgaben wahr, die bislang bei anderen Ämtern angesiedelt waren: Untere Abfallbehörde, Altlasten und Immissionsschutz, Untere Landespflegebehörde, Untere Wasserbehörde, Beseitigung von Autowracks sowie Öffentlichkeitsarbeit und allgemeine Verwaltung. Mitteilungsblatt 34 (1995) Nr. 37, S. 2 - Mitteilungsblatt 35 (1996) Nr. 1; RZ 20./21.1.1996, S. 14 - RZ 30.1.1996, S. 14. Brigitte Doetsch wird als Nachfolgerin von Detlef Knopp Fraktionsvorsitzende der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Das Amt des Stellvertreters übernimmt Professor Dr. Ulrich Furbach. Mitteilungsblatt 34 (1995) Nr. 37, S. 3. Die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein- Hunsrück, Rhein-Lahn und Westerwald sowie die Stadt Koblenz schließen sich zur „Verkehrsbund Rhein-Mosel GmbH“ zusammen. Zweck dieser Gesellschaft ist die Planung und Gestaltung des ÖPNV und seine Koordination mit dem Schienennahverkehr. RZ 1./2.7.1995, S. 12; RZ 22.12.1995, S. 3, 15. Dr. -

Annäherung an Paul Von Hase. Preußischer Gardeoffizier Und Verschwörer Am 20
1 Heiner Möllers Annäherung an Paul von Hase. Preußischer Gardeoffizier und Verschwörer am 20. Juli 1944 Vorbemerkung Es ist ein mutiges Unterfangen, selbst als Historiker, vor der weiterverzweigten Familie von Hase die Lebensgeschichte von Generalleutnant Paul von Hase nachzuerzählen. Vieles kann man zu diesem General auf dem Weg vom Alexander-Regiment nach Plötzensee, von seinen Anfängen in der preußischen Garde bis zum Todesurteil nach dem 20. Juli in Roland Kopp, „Paul von Hase: Von der Alexander-Kaserne nach Plötzensee“1, nachlesen. Dieses grund- legende Buch dürfte den meisten, wenigstens den historische Interessierten in der Großfamilie von Hase bekannt sein. In allen Tiefen hat Kopp die Person Karl Paul Immanuel von Hase erfasst und beschrieben. Nimmt man die beinahe ausufernde Literatur zum militärischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus hinzu, der am 20. Juli 1944 im Staatstreichversuch mündete, lernt man vieles über die Motive der Widerständler, die Abläufe des Staatstreiches und die Rache Hitlers. Paul von Hase hingegen bleibt dabei meistens etwas unscharf, weil er nicht im Zentrum des Staatstreiches steht – er war nicht der Stauffenberg oder der Tresckow. Der Besuch des Familienverbandes von Hase in Potsdam reizt aber, sich mit diesem damaligen Stadtkommandanten von Berlin zu befassen. Paul von Hase und der 20. Juli Generalleutnant Paul von Hase war eine von den vielen in der zweiten Reihe stehenden Personen am 20. Juli 1944. Als Stadtkommandant von (Groß-)Berlin war er nach den Planungen der Operation Walküre dafür zuständig, das Regierungsviertel abzusperren. Und schon diese militärisch recht einfache, klar umrissene Aufgabe, scheiterte. Nicht wegen Paul von Hase, der alles ordnungsgemäß, wie der Plan es vorschrieb einleitete, sondern weil ein Rädchen im Räderwerk von Walküre nicht mitmachte, geradezu den Dienst verweigerte: Major Otto Ernst Remer, Kommandeur des Wachbataillons Großdeutschland, sollte mit seinen Truppen das Regierungsviertel absperren und die dort greifbaren Minister verhaften. -

The Challenging Continuity of Change and the Military: Female Soldiers – Conflict Resolution – South America
The Challenging Continuity of Change and the Military: Female Soldiers – Conflict Resolution – South America. Proceedings of the Interim Conference 2000 of ISA RC 01 SOZIALWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT DER BUNDESWEHR internationales Band FORUM Cahier 22 international Volume Gerhard Kümmel (Ed.) The Challenging Continuity of Change and the Military: Female Soldiers – Conflict Resolution – South America. Proceedings of the Interim Conference 2000 of ISA RC 01 Strausberg, August 2001 Opinions expressed are solely those of the authors. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autoren. Copyright by Sozialwissenschaftliches SOWI 2001 Institut der Bundeswehr All rights reserved Prötzeler Chaussee 20 Alle Rechte vorbehalten 15344 Strausberg ISSN 0177-7599 Tel.: 03341/58-1801 Fax: 03341/58-1802 www.sowi-bundeswehr.de Table of Contents Introduction Gerhard Kümmel 9 I. Female Soldiers: Integration on the Rise? 13 Women in the Canadian Forces Donna Winslow & Jason Dunn 15 Women in the Portuguese Armed Forces: From Visibility to ‘Eclipse’ Helena Carreiras 57 Affirming Gender Equality: The Challenges Facing the South African Armed Forces Lindy Heinecken 97 Women in the South Korean Military Doo-Seung Hong 123 Challenging Gender Roles? Male Soldiers and the Complete Opening of the Bundeswehr for Women Gerhard Kümmel 143 Die ‚Soldatin‘ in den Printmedien der Bundeswehr: Eine inhaltsanalytische Untersuchung Sylvia Schiesser 169 5 The Gender Perspective of Civil-Military Relations in Israeli Society Uta Klein 201 Civil-Military Relations and Gender Equality in the South African National Defence Force at the Beginning of the New Millennium Rialize Ferreira 211 Dutch Female Peacekeepers in Bosnia and Kosovo: Between Marginality and Acceptance Liora Sion 233 Women Soldiers: The Enemy Within Marcia Kovitz 247 II. -
Første Hund Ut
nr. LS 2007: 4 HV gjorde “rent bord” 2007 06: Alt om LS 2007 14: Skrev bok med pris på hodet HV 20: Toppdommer og innsatsstyrkesjef bladet 24: Nytt utstyr til HV HV i INTOPS: Første hund ut september 07 // HVbladet 1 // leder HVBLADET 60. årgang nr. 3 juli 2007 REDAKSJONEN Heimevernsbladet Oslo mil/Grev wedelsplass 9, 0015 OSLO GIHV brovold e-post: [email protected] Tlf: 23 09 50 32 Solide resultater – og utfordringer Fax: 23 09 3750 AnsvarliG REDAKTØR Brigader Geir Olav Kjøsnes Det var med stolthet jeg overvar årets betydelige samfunnsressurser, både i form Landskytterstevne i Steinkjer. Ikke bare av mannskaper og økonomiske midler, og REDAKTØR / REDAKSJONEN gjorde Heimevernet, representert ved vi skal fremdeles fastholde målet. På veien Stian B. Støvland HV-12, en solid jobb med arrangementet, dit må vi dog akseptere at milepælen full men vi vant også det meste som kunne operativ kapasitet må skyves ut i tid. VPL JOURNALIST vinnes! For meg er dette et tydelig tegn på Forsvaret har jobbet hardt i flere år Oddbjørn Vistnes at Heimevernet har meget gode ferdigheter for å forbedre sin forvaltning. Det siste innenfor den viktigste soldatdisiplinen. initiativet i så måte er LOS-programmets Gratulerer til alle som vant priser og alle økonomiprosjekt, som skal gi Forsvaret de tusen som står bak og sørger for en en komplett økonomi- styrings- og REDAKSJONSKOMITÉ bærekraftig skytterkultur. forsyningsløsning. Innføringen har Brigader Geir Olav Kjøsnes Forsvarssjefens høyeste prioritet i 2008 Kommandør Vidar Tollefsen Forsvaret har i inneværende planperiode og vil treffe Heimevernet i april og mai. Oberst Karl Egil Hanevik blitt betydelig underfinansiert. -

Download (15MB)
The Politics of German Defence Policy Policy Leadership, Bundeswehr Reform and European Defence and Security Policy Philip Thomas Adrian Dyson London School of Economics, University of London, PhD. UMI Number: U194842 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Disscrrlation Publishing UMI U194842 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 IP Library bnic: ..iTdiy 01 Political and Economic Science TM£S£S F q^946Z Abstract This thesis is a study of the role of policy leadership in German defence and security policy between 1990 and 2002, with particular reference to reform of the Bundeswehr. It situates this case study in the framework of a set of analytical perspectives about policy change derived from public policy theory, arguing that public policy theory has either underestimated policy leadership or failed to discriminate different leadership roles, styles and strategies. The author rejects the dominant contextualist and culturalist approach to leadership in studies of German defence and security policy in favour of an interactionist approach that stresses the dialectical interaction between policy skills and strategic context. -

Supreme Allied Commander Europe (SACEUR)
5 December 2000 Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) GEN Of The Army Dwight D. Eisenhower, US A 2 Apr 51 – 30 May 52 GEN Matthew B. Ridgway, US A 30 May 52 – 11 Jul 53 GEN Alfred M. Gruenther, US A 11 Jul 53 – 20 Nov 56 GEN Lauris Norstad, US AF 20 Nov 56 – 1 Jan 63 GEN Lyman L. Lemnitzer, US A 1 Jan 63 – 1 Jul 69 GEN Andrew J. Goodpaster, US A 1 Jul 69 – 15 Dec 74 GEN Alexander M. Haig, Jr. US A 15 Dec 74 – 29 Jun 79 GEN Bernard W. Rogers, US A 29 Jun 79 - 26 Jun 87 GEN John R. Galvin, US A 26 Jun 87 - 24 Jun 92 GEN John M. Shalikashvili, US A 24 Jun 92 - 22 Oct 93 GEN George A. Joulwan, US A 22 Oct 93 - 11 Jul 97 GEN Wesley K. Clark, US A 11 Jul 97 - 3 May 00 GEN Joseph W. Ralston, US AF 3 May 00 - present Deputy Supreme Allied Commander Europe (DSACEUR) Field Marshal The Viscount Montgomery 2 Apr 51 - 23 Sep 58 of Alamein, UK A GEN Sir Richard Gale, UK A 23 Sep 58 - 22 Sep 60 GEN Sir Hugh Stockwell, UK A 22 Sep 60 - 1 Jan 64 Marshal of The Royal Air Force 1 Jan 64 - 1 Mar 67 Sir Thomas G. Pike, UK AF GEN Sir Robert Bray, UK A 1 Mar 67 - 1 Dec 70 GEN Sir Desmond Fitzpatrick, UK A 1 Dec 70 - 12 Nov 73 GEN Sir John Mogg, UK A 12 Nov 73 - 15 Mar 76 GEN Sir Harry Tuzo, UK A 15 Mar 76 - 2 Nov 78 (2 DSACEURs from Jan 78 – Jun 93) LT GEN Gerd Schmueckle, GE A 3 Jan 78 - 1 Apr 80 GEN Sir Jack Harman, UK A 2 Nov 78 - 9 Apr 81 ADM Gunther Luther, GE N 1 Apr 80 - 1 Apr 82 ACM Sir Peter Terry, UK AF 9 Apr 81 - 16 Jul 84 GEN G.