Die Neue Bundeswehr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nato Enlargement and Central Europe a Study in Cml-Military Relations Nato Enlargement and Central Europe a Study in Cml-Military Relations
NATO ENLARGEMENT AND CENTRAL EUROPE A STUDY IN CML-MILITARY RELATIONS NATO ENLARGEMENT AND CENTRAL EUROPE A STUDY IN CML-MILITARY RELATIONS by Jeffrey Simon 1996 Institute For National Strategic Studies National Defense University National Defense University Press Publications To increase general knowledge and inform discussion, the Institute for National Strategic Studies, through its publication arm the NDU Press, publishes McNair Papers; proceedings of University- and Institute-sponsored symposia; books relating to U.S. national security, especially to issues of joint, combined, or coalition warfare, peacekeeping operations, and national strategy; and a variety of briefer works designed to circulate contemporary comment and offer alternatives to current poli- cy. The Press occasionally publishes out-of-print defense classics, historical works, and other especially timely or distinguished writing on national security. Opinions, conclusions, and recommendations expressed or implied within are sole- ly those of the authors, and do not necessarily represent the views of the National Defense University, the Department of Defense, or any other U.S. Government agency. Cleared for public release; distribution unlimited. Portions of this book may be quoted or reprinted without permission, provided that a standard source credit line is included. NDU Press would appreciate a courtesy copy of reprints or reviews. Many NDU Press publications are sold by the U.S. Government Printing Otiice. For ordering information, call (202) 783-3238 or write to the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Oflqce, Washington, DC 20402. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Simon,Jeffrey, 1942- NATO enlargement and Central Europe: a study in civil-military relations / Jeffrey Simon. -

European Force Structures Papers Presented at a Seminar Held in Paris on 27 & 28 May 1999
OCCASIONAL PAPERS 8 EUROPEAN FORCE STRUCTURES PAPERS PRESENTED AT A SEMINAR HELD IN PARIS ON 27 & 28 MAY 1999 Timothy Garden, Kees Homan, Stuart Johnson, Jofi Joseph, Adam Daniel Rotfeld, Bryan Wells Edited by Gordon Wilson INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES - WESTERN EUROPEAN UNION INSTITUT D’ETUDES DE SECURITE - UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE 43 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 75775 PARIS CEDEX 16 August 1999 OCCASIONAL PAPERS 8 European force structures Papers presented at a seminar held in Paris on 27 & 28 May 1999 Edited by Gordon Wilson THE INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES WESTERN EUROPEAN UNION 43 AVE DU PRESIDENT WILSON, 75775 PARIS CEDEX 16 August 1999 Occasional Papers are essays that, while not necessarily authoritative or exhaustive, the Institute considers should be made available, as a contribution to the debate on topical European security issues. They will normally be based on work carried out by researchers granted awards by the Institute; they represent the views of the authors, and do not necessarily reflect those of the Institute or of the WEU in general. Publications of Occasional Papers will be announced in the Institute’s Newsletter, and they will be available on request, in the language used by the author. EUROPEAN FORCE STRUCTURES Papers presented at a seminar held in Paris on 27 & 28 May 1999 Timothy Garden, Robert Grant, Kees Homan, Stuart Johnson & Jofi Joseph, Franz-Josef Meiers, Adam Daniel Rotfeld, Bryan Wells and Gordon Wilson Edited by Gordon Wilson Contents Preface iii The need for an increased European defence -

Der Deutsche Militarismus Ist Nicht Tot Er Riecht Nur Streng
Der deutsche Militarismus ist nicht tot er riecht nur streng Analysen zur Militarisierung der bundesdeutschen Gesellschaft Kommission „Neofaschismus“ der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes- Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) in NRW und Hartmut Meyer Archiv Wie kommt der Militarismus in die Köpfe? Seite 1 Titelseite: Karikatur von George Grosz Neonazi Burschenschafter der Libertas &Bundeswehr& Alte Herren beim Heldengedenken am 1933 eingeweihten „Ehrenmal“ in Aachen visdP. Kurt Heiler Aachen Gestaltung: Andrej Hunko Druck :UWZ -Schnelldruck GmbH Münster Seite 2 Wie kommt der Militarismus in die Köpfe? Inhaltsverzeichnis Einleitung Seite 5 Winfried Wolf Neue Aufrüstung, wachsende Kriegsgefahr und Militärisch-Industrieller Komplex Seite 6 Die Zäsur von 1989/90 - Charakter der Rüstungsindustrie und des MIK - MIK und kapitalistische Produktion - Einfluss des MIK-Militärpolitik und Veränderung des weltweiten MIK - Neue Militarisierung der Gesellschaft Kurt Heiler Panzer zu verkaufen - Fregatte gefällig - Die Zeitschriften des MIK Seite 10 „Soldat und Technik“ - „Wehrtechnik“ - BDI nimmersatt - 2 Karrieren: A. Schnez und D. Wellershoff- Rüstungsexporte Gerd Deumlich Bundeswehr und Neonazismus Seite 16 Im Panzerschrank - von Geburt an rechtslastig - Bewunderung für die Kriegsgeneration - Marschziel Kriegstüchtigkeit - den 20. Juli zum „Symbol“ gemacht - das Hauptverbrechen des Faschismus war der Krieg - den gleichen Feind im Visier - Kämpfer oder Wohltäter der Menschheit? Fabian Virchow „Deutsch wählen heißt Frieden -

List of Participants Based on Information Received by Thursday, 20 September 2012
Atoms for Peace General Conference GC(56)/INF/9 Date: 21 September 2012 General Distribution English only Fifty-sixth regular session Vienna, 17–21 September 2012 List of Participants Based on information received by Thursday, 20 September 2012 Pages 1. Member States 1–109 2. Representation of States not Members of the Agency 110 3. Entities Having Received a Standing Invitation to Participate as Observers 111 in the Sessions and Work of the General Conference 4. United Nations and Specialized Agencies 112 5. Intergovernmental Organizations (IGOs) other than the United Nations and 113–116 its Specialized Agencies 6. Non-Governmental Organizations (NGOs) 117–123 The List of Participants contains information as provided by delegations. Member States Alternates: Mr Spiro KOÇI Afghanistan, Islamic Republic of Ambassador Head of Delegation: Resident Representative to the IAEA Permanent Mission to the IAEA in Vienna Mr Abdul M. SHOOGUFAN Ambassador* Advisers: Resident Representative to the IAEA Permanent Mission to the IAEA in Vienna Mr Jovan THERESKA Adviser to the Ambassador Alternates: Permanent Mission to the International Organizations in Vienna Mr Abdul Hai NAZIFI Director General Other members of delegation: Afghan Atomic Energy High Commission Mr Adhurim RESULI Mr Sayed Yusuf GAILANI Minister Minister-Counsellor Alternate to the Resident Representative Alternate to the Resident Representative Permanent Mission to the IAEA in Vienna Permanent Mission to the IAEA in Vienna Mr Milo KUNESHKA Mr Daoud HACHEMI Director First Secretary National -

Zur Wehrpflicht: Es Geht Um Sicherheit Und Freiheit —
Nr. 1/2013 Herausgeber: Chef der Armee Beilage zur ASMZ 6/13 und RMS 3/13 Military Power Revue — der Schweizer Armee de l’Armée Suisse T PFLICH WEHR ZUR Der Chef der Armee ist Herausgeber der Herstellung: Redaktionskommission: MILITARY POWER REVUE. Zentrum elektronische Medien ZEM, Oberst i Gst Jürg Kürsener Stauffacherstrasse 65/14 Chefredaktor MILITARY POWER REVUE Die MILITARY POWER REVUE erscheint zweimal 3003 Bern jährlich (Ende Mai und Ende November). 031 325 55 90 Colonel EMG Laurent Currit Leiter Doktrinforschung & Entwicklung Die hier dargelegten Analysen, Meinungen, Druck: (Armeestab) Schlussfolgerungen und Empfehlungen sind galledia ag ausschliesslich die Ansichten der Autoren. Burgauerstrasse 50, Oberst i Gst Christoph Müller Sie stellen nicht notwendigerweise den Stand- 9230 Flawil Chef Heeresdoktrin und Redaktor Bereich Heer punkt des Eidgenössischen Departementes Tel. 058 344 96 96 für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Oberst i Gst Wolfgang Hoz (VBS) oder einer anderen Organisation dar. Chefredaktion Military Power Revue: Chef Doktrin, Luftwaffe und Redaktor Bereich Oberst i Gst Jürg Kürsener Luftwaffe Die Artikel der MILITARY POWER REVUE Sonnenbergstrasse 14 können unter Angabe der Quelle frei kopiert 4573 Lohn-Ammannsegg und wiedergegeben werden. Ausnahmen gelten Tel. 032 677 18 63. dort, wo explizit etwas anderes gesagt wird. E-Mail: [email protected] Die MILITARY POWER REVUE ist Beiheft der Chefredaktion ASMZ: Allgemeinen Militärzeitschrift ASMZ und Oberst i Gst Peter Schneider der Revue Militaire Suisse -

EU-Mission Im Kongo • Milieu-Studie • »Gewissen Und Gehorsam« – 46
HEFT 263 – SEPTEMBER 2006 46. JAHRGANG • EU-Mission im Kongo • Milieu-Studie • »Gewissen und Gehorsam« – 46. Woche der Begegnung • Menschenrecht Religionsfreiheit Bioethik Gefunden auf der Wäscheleine des Saarbrücker Katholikentages www.katholische-soldaten.de HEFT 263 – SEPTEMBER 2006 AUFTRAG 46. JAHRGANG INHALT EDITORIAL .......................................................... 3 Widerlegt die Renaissance des Religiösen die Säkularisierungsthese? (KNA)...................... 34 SICHERHEIT UND FRIEDENSETHIK Pfarrgemeinden im Urteil der Katholiken: ZUR DEUTSCHEN BETEILIGUNG AN DER KONGO-MISSION Erstaunliche Zustimmung – „Nicht nur Niedergang“ DER EU.................................................................... 4 (KNA) ............................................................... 34 Der Kongoeinsatz der Europäischen Union Von Wohnzimmern und Sinn im Leben – Religiöse – ein tragbares Risiko? von Ludwig Jacob und und kirchliche Orientierungen im Spiegel der H.G. Justenhoven ................................................ 4 Sinus-Milieus von Martin Hochholzer ................... 36 Stimmen zum Kongo-Einsatz der Bundeswehr Joseph Ratzinger über die Demokratie (KNA) ................................................................. 9 in der Kirche (ZENIT.org) ................................ 40 UN: Kinder in Konflikten besser schützen ............ 10 Interview: „Ein Stück Gelassenheit“ GESELLSCHAFT NAH UND FERN von KNA-Mitarbn. B. Buchner u. C. Scholz ....... 11 Universalen Menschenrechten droht Relativierung Segen der missio-Präsidenten -

Info Magazin
info magazin 01/97(1) ...bis zum Umfallen 8:00 Min. Eignungstest für das Kommando Spezialkräfte (KSK). Neuaufstellung am 01. Oktober 1996 in Calw. Stärke etwa 1000 Mann. Aufgaben: Nachrichtengewinnung und Aufklärung, Schutz eigener Kräfte auf Distanz und Kampfeinsätze im gegnerischen Gebiet. Offz/Fw können sich bewerben, müssen sprung- u. tropentauglich und auslandsdienstverwendungsfähig sein. 01/97(2) Viel Licht - wenig Schatten 8:00 Min. Holloman in Neu-Mexiko bietet ideale Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung von deutschen TORNADO-Besatzungen. Hochwert-Ausbildung: 10 Tage Training, Taktische Weiterbildung im Luft- und Luft-Boden-Kampf bei idealen Wetterbedingungen und ausreichendem Platz. 01/97(3) "BAYERN" ahoi 7:00 Min. Die Fregatte BAYERN stellt sich vor. Drei Schwesterschiffe tragen auch den Namen von Bundesländern: SCHLESWIG-HOLSTEIN, MECKLENBURG-VORPOMMERN und BRANDENBURG. Im Film werden technische Angaben angesprochen sowie Ausrüstung und Bewaffnung gezeigt; u.a. der Bordhubschrauber "SEA LYNX". 01/97(4) Blickpunkt Bundeswehr 8:00 Min. - Entscheidung des Bundestages über den Einsatz der Bundeswehr in Bosnien als internationale Friedenstruppe zur Stabilisierung des Friedens (SFOR). - Bundespräsident Herzog besucht die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw) in Hamburg. - Studenten, die ihren Wehrdienst bereits abgeleistet haben, erhalten eine preiswerte Unterkunft in Kasernen. - United Service Organization (USO) zeichnet deutsche Soldaten für außergewöhnliche Leistungen im und außer Dienst aus. 02/97(1) Auftrag und Einsatz 5:00 Min. Die Bundeswehr in Ex-Jugoslawien: gestern - heute - morgen. Würdigung des deutschen IFOR-Einsatzes im In- und Ausland. 3000 Soldaten sind seit Dezember 1996 für weitere 18 Monate im SFOR-Einsatz (Stabilization Force). 02/97(2) Feuer und Bewegung 8:00 Min. Der Schützenpanzer MARDER - ein Waffenportrait. -
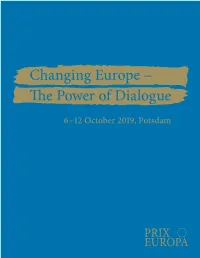
Changing Europe – the Power of Dialogue
Changing Europe – The Power of Dialogue 6 –12 October 2019, Potsdam Changing Europe – The Power of Dialogue 6 –12 October 2019, Potsdam hosted by supported by 2 Changing Europe – The Power of Dialogue In a world that is faster, more complicated and fragmented than ever, it is easy to only speak and never listen, to only tweet and never talk. Pressures of pace and finance are mounting. So it is more important than ever to have strong public service media that provide quality journalism that goes out of its way to be a trusted guide, to bring people together and set a tone that enables dialogue. PRIX EUROPA is ALL about dialogue: Come together from all corners of the continent to exchange views, to see/listen for yourself together with the others, to talk and discuss, to meet and be constructive, rather than judgmental or clever. Grab the opportunity to get into conversation, to change perspective, to challenge your opinions and take away inspiration, a shared experience and new ideas. Cilla Benkö PRIX EUROPA President Director General Sveriges Radio – SR 3 Changing Europe – The Power of Dialogue Dear friends and colleagues, PRIX EUROPA is dedicated to the ideal of a united Europe, which commits itself to democratic, ethical and cultural values. This ideal is, however, in acute danger. We have to dread being abruptly pulled out of a dream that we have been living for over six decades. Of all countries, the Mother of all Democracies, the United Kingdom, is separating itself from our community. Over our Europe of togetherness, that so many people envy us for, the threat of disaster is looming. -

Germany and the Use of Force.Qxd 30/06/2004 16:25 Page 118
Longhurst, Germany and the use of force.qxd 30/06/2004 16:25 Page 118 6 The endurance of conscription Universal conscription is an element of Germany’s security insurance and will continue to be indispensable.1 I believe that conscription is an essential instrument for the Bundeswehr’s integration into society. Therefore, it shall remain.2 The conscription puzzle When considered against the expansion of the Bundeswehr’s remit dur- ing the 1990s and the associated efforts at restructuring its armed forces, Germany’s stalwart commitment to retaining conscription is an area of profound stasis, an anomaly warranting further investigation. In the face of ever-more acute strategic, economic and social challenges to the utility of compulsory military service since the ending of the Cold War, conscription was maintained and developed in Germany in the 1990s by both the CDU- and the SPD-led Government to enhance its rele- vance and thus ensure its survival. Moreover, the issue of conscription’s future, whenever it has been debated in Germany over the past decade, has been hampered by the overwhelming support given to the practice by the Volksparteien, as well as the Ministry of Defence; as a conse- quence, no serious consideration has been given to alternatives to conscription. This situation sets Germany apart from countries across Europe (and beyond) where the trend has been away from the mass-armed force pre- missed on compulsory military service and towards fully professional smaller forces. Germany’s lack of engagement with the issue of con- scription derives from the prevailing belief among the political and mil- itary elite that, stripped of its compulsory military service element, the Kerry Longhurst - 9781526137401 Downloaded from manchesterhive.com at 10/02/2021 05:08:06PM via free access Longhurst, Germany and the use of force.qxd 30/06/2004 16:25 Page 119 The endurance of conscription 119 Bundeswehr would become irretrievably undemocratic and that unde- sirable changes to the form and substance of Germany’s foreign and security policy would follow. -

PAZIII Abo.Qxd
Massenmörder bleiben unbehelligt S.5 Das Ostpreußenblatt Einzelverkaufspreis: 2,50 Euro Nr. 28 – 13. Juli 2013 U NABHÄNGIGE W OCHENZEITUNG FÜR D EUTSCHLAND C5524 - PVST. Gebühr bezahlt DIESE WOCHE JAN HEITMANN: Ad absurdum Aktuell a ist ein Mann, der die To- Beklemmende Bilanz Ddesstrafe riskiert, um die Freiheitsrechte des Individuums Schäuble feiert Leistungen auch in Deutschland zu schüt- beim Schuldenabbau, doch zen. Und was tut die Bundesre- Fakten sprechen gegen ihn 2 gierung, um Edward Snowden zu schützen? Nichts. Die ge- Preußen / Berlin nannten Gründe für die Ableh- nung seines Aufnahmegesuchs Wenn Polizisten am Ende sind sind erbärmlich, ja geradezu ab- surd. Mit diesen Argumenten Todesschuss vom Neptun- hätte die Bundesrepublik sei- brunnen: Überlastung der nerzeit auch die Aufnahme von Beamten wird gefährlich 3 Alexander Solschenyzin oder DDR-Häftlingen ablehnen kön- Hintergrund nen. Zudem wird sonst bald jeder mit offenen Armen emp- Politik lähmt Entwicklung fangen, der nur laut genug „Asyl“ ruft. Das gilt selbst für Fehlende Investitionen von denjenigen, der in seinem Hei- Staat und Wirtschaft verhin- matland gar keine Verfolgung dern zukünftiges Wachstum 4 zu befürchten hat, der als Wirt- Deutschland als Handlanger fremder Mächte? Der jetzige Abhörskandal belebt alte Befürchtungen neu Bild: action press schaftsflüchtling zu uns kommt Deutschland oder auch einfach nur den deut- schen Sozialstaat ausnutzen will. Massenmord ungesühnt Und selbst derjenige, dessen An- Mutmaßliche Täter des Brand- trag rechtskräftig abgelehnt anschlags auf Aleviten leben Land minderen Rechts wurde, wird oftmals weiter ge- unbehelligt in Deutschland 5 duldet und durchgefüttert. Für NSA-Skandal wirft alte Frage neu auf: Wie souverän ist Deutschland? den Mann aber, der das welt- umspannende US-Schnüffelsy- Ausland Kanzlerin und Opposition spielen geblich nehmen Westalliierten ihr die Akte zu unterzeichnen. -

Randauszaehlungbrdkohlband
Gefördert durch: Randauszählungen zu Elitestudien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel Band 21 Die Politisch-Administrative Elite der BRD unter Helmut Kohl (1982 – 1998) Bastian Strobel Simon Scholz-Paulus Stefanie Vedder Sylvia Veit Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen des von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien geförderten Forschungsprojektes „Neue Eliten – etabliertes Personal? (Dis-)Kontinuitäten deut- scher Ministerien in Systemtransformationen“. Zitation: Strobel, Bastian/Scholz-Paulus, Simon/Vedder, Stefanie/Veit, Sylvia (2021): Die Poli- tisch-Administrative Elite der BRD unter Helmut Kohl (1982-1998). Randauszählungen zu Elite- studien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel, Band 21. Kassel. DOI: 10.17170/kobra-202102193307. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ...................................................................................................................................... 1 2 Personenliste ................................................................................................................................ 4 3 Sozialstruktur .............................................................................................................................. 12 4 Bildung ........................................................................................................................................ 16 5 Karriere ....................................................................................................................................... 22 6 Parteipolitisches -

The German Domestic Dispute on Military Deployment Overseas Nils Martin James Madison University
James Madison University JMU Scholarly Commons Masters Theses The Graduate School Spring 2016 Germany in Afghanistan: The German domestic dispute on military deployment overseas Nils Martin James Madison University Follow this and additional works at: https://commons.lib.jmu.edu/master201019 Part of the European History Commons, Political History Commons, and the Social History Commons Recommended Citation Martin, Nils, "Germany in Afghanistan: The German domestic dispute on military deployment overseas" (2016). Masters Theses. 118. https://commons.lib.jmu.edu/master201019/118 This Thesis is brought to you for free and open access by the The Graduate School at JMU Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of JMU Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. Germany in Afghanistan: The German Domestic Dispute on Military Deployment Overseas A thesis submitted to the Graduate Faculty of JAMES MADISON UNIVERSITY In Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Masters of Arts World History May 2016 FACULTY COMMITTEE: Committee Chair : Dr. Christian Davis Committee Members/ Readers: Dr. Steven Guerrier Dr. Michael Gubser Table of Contents List of tables………………………………………………………………………iii Abstract………………………………………………………………………..…iv I. Introduction……………………………………………………………………..1 II. The Rise of German Anti-Militarism………………………………….…14 III. Foreign Policy Development in Post-World War II Germany…………..42 IV. Afghanistan: German Domestic Dispute over Troop