Transformatorische Kulturpolitik
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
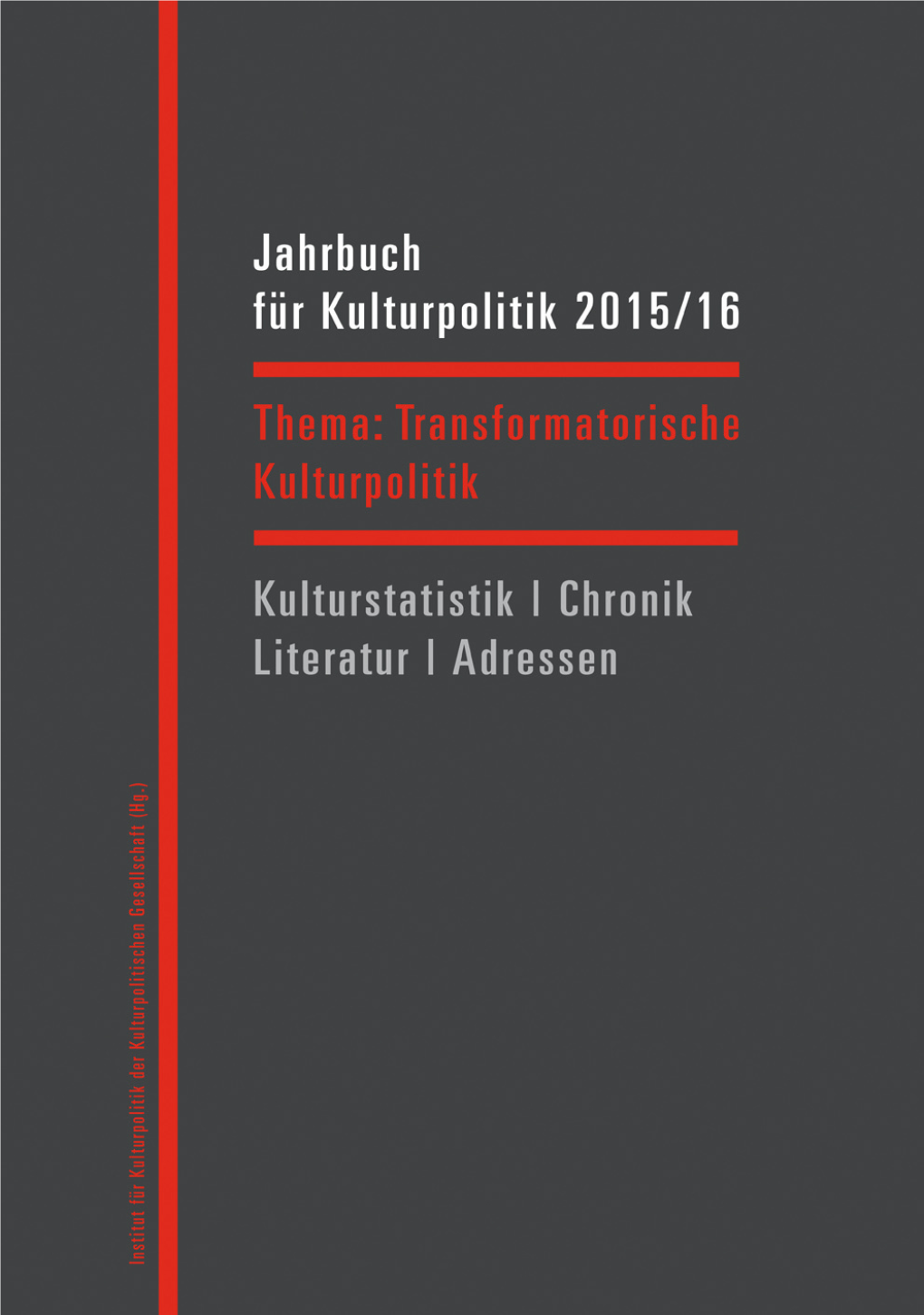
Load more
Recommended publications
-

MDM Online: Quedlinburg/Harz
PR O D U K TIO N SZEN TR U M Q U ED LIN BU R G /H A R Z IN H A LT Produktionszentrum Quedlinburg/Harz 2 Lage in Mitteldeutschland 3 Übersicht 4 Antragstellung 5 Adressen Locations und Dienstleister 6 Immobilien, Hallen und Produktionsbüros 6 Unterkünfte und Hotels 6 Gastroverzeichnis 7 Notdienste und Gesundheitsversorgung 7 Energie, Wasser, Abwasser und Abfall 7 Verkehrsinformationen 7 Kinos und Theater 8 Regionale Pressekontakte 9 Referenzprojekte 10 Kontakt & Impressum 11 Seite 1 von 11 PR O D U K TIO N SZEN TR U M Q U ED LIN BU R G /H A R Z OBERBÜRGERMEISTER Frank Ruch Das Produktionszentrum Quedlinburg liegt im nordöstlichen Harzvorland GEOGRAFISCHE LAGE 10° 09` östliche Länge im geschichtsträchtigen Harzer Städtedreieck Wernigerode-Halberstadt- 51° 48` nördliche Breite Quedlinburg. In einer Reichweite von einer Stunde Fahrtzeit sind der FLÄCHE DES STADTGEBIETES 102 km2 Harz, das Harzvorland sowie Magdeburg und Halle gut erreichbar. Das nördliche Harzvorland zeigt sich als sanft gewellte Landschaft mit EINWOHNER 23.800 weitläufigen Ackerflächen, Höhenzügen und Flussniederungen, die von ENTFERNUNGEN Hannover 135 km (01:40 h) der Landwirtschaft bestimmt wird. Niederungs-und Wiesenlandschaften Magdeburg 59 km (00:50 h) mit schilf- und weidengesäumten Gräben, alte Buchenwälder und die Halle 83 km (01:10 h) bizarren Felsformationen der Teufelsmauer sind Teil der Leipzig 122 km (01:30 h) wildromantischen Harzer Natur. Dresden 146 km (01:30 h) Besonderes Merkmal ländlicher und städtischer Baukultur ist das vielfältig Erfurt 130 km (02:00 h) genutzte Fachwerk, welches den Großteil der Region bestimmt. Die historischen Zentren weltlicher und sakraler Macht stellen sich als bedeutende Sandsteinbauwerke dar. -

REFORM, RESISTANCE and REVOLUTION in the OTHER GERMANY By
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Birmingham Research Archive, E-theses Repository RETHINKING THE GDR OPPOSITION: REFORM, RESISTANCE AND REVOLUTION IN THE OTHER GERMANY by ALEXANDER D. BROWN A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Modern Languages School of Languages, Cultures, Art History and Music University of Birmingham January 2019 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract The following thesis looks at the subject of communist-oriented opposition in the GDR. More specifically, it considers how this phenomenon has been reconstructed in the state-mandated memory landscape of the Federal Republic of Germany since unification in 1990. It does so by presenting three case studies of particular representative value. The first looks at the former member of the Politbüro Paul Merker and how his entanglement in questions surrounding antifascism and antisemitism in the 1950s has become a significant trope in narratives of national (de-)legitimisation since 1990. The second delves into the phenomenon of the dissident through the aperture of prominent singer-songwriter, Wolf Biermann, who was famously exiled in 1976. -

Naumburg/Zeitz 2 Lage in Mitteldeutschland 3 Übersicht Burgenlandkreis 4 Übersicht Naumburg 5 Übersicht Zeitz 6 Antragstellung Naumburg 7 Antragstellung Zeitz 8
PR O D U K TIO N SZEN TR U M N A U M BU R G /ZEITZ IN H A LT Produktionszentrum Naumburg/Zeitz 2 Lage in Mitteldeutschland 3 Übersicht Burgenlandkreis 4 Übersicht Naumburg 5 Übersicht Zeitz 6 Antragstellung Naumburg 7 Antragstellung Zeitz 8 Adressen Locations und Dienstleister 9 Immobilien, Hallen und Produktionsbüros 9 Unterkünfte und Hotels 9 Gastroverzeichnis 9 Notdienste und Gesundheitsversorgung 9 Energie, Wasser, Abwasser und Abfall 9 Verkehrsinformationen 10 Kinos und Theater 10 Regionale Pressekontakte 11 Referenzprojekte 12 Kontakt & Impressum 13 Seite 1 von 13 PR O D U K TIO N SZEN TR U M N A U M BU R G /ZEITZ N A U M B U R G OBERBÜRGERMEISTER Bernward Küper Das Produktionszentrum Naumburg/Zeitz liegt im Süden Sachsen- GEOGRAFISCHE LAGE 11° 80` östliche Länge Anhalts. Mit der günstigen Position im Dreiländereck Sachsen, Sachsen- 51° 15` nördliche Breite Anhalt und Thüringen ist das Produktionszentrum über die nahe gelegene A9 hervorragend an Magdeburg, Leipzig und Erfurt angebunden. In einer FLÄCHE DES STADTGEBIETES 123 km2 Reichweite von einer Stunde Fahrtzeit sind u. a. Merseburg und Querfurt, die Weinanbaugebiete der Saale-Unstrut Region und länderübergreifend EINWOHNER 32.150 Städte wie Altenburg, Weimar, Jena und Leipzig gut erreichbar. ENTFERNUNGEN Magdeburg 162 km (01:38 h) Halle 56 km (00:55 h) Zwei landschaftlich sehr verschiedene Gebiete gehen in dieser Region Leipzig 68 km (00:50 h) ineinander über. Die nordöstlich gelegenen Ackerebenen des Altenburg 55 km (01:04 h) Halle/Leipziger Industriegroßraums werden im Wesentlichen durch Gera 61 km (00:48 h) Schichten wie Löß, Moränen und Sander sowie Flussablagerungen und Jena 32 km (00:37 h) Auen gebildet. -

Integration: the Cultural Politics of Migration and Nation in the New German Public
University of Pennsylvania Masthead Logo ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2017 Integration: The ulturC al Politics Of Migration And Nation In The ewN German Public Kate Zambon University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Communication Commons Recommended Citation Zambon, Kate, "Integration: The ulturC al Politics Of Migration And Nation In The eN w German Public" (2017). Publicly Accessible Penn Dissertations. 2661. https://repository.upenn.edu/edissertations/2661 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/2661 For more information, please contact [email protected]. Integration: The ulturC al Politics Of Migration And Nation In The ewN German Public Abstract This dissertation examines public discourse on culture and integration and asks how do mediated public discussions about integration reproduce norms of national culture and identity that operate to represent and manage “Other” (immigrant, minority, etc.) populations in the German context? Through a case study approach, this dissertation uses critical discourse theory to analyze public campaigns, media events, and mediated controversies since the mid-2000s that sought to define the qualifications for cultural citizenship. Although in recent years an increasing number of publications have addressed Germany’s diverse and transnational population, examinations of processes and policies of integration have tended to focus either on the level of the government or on the level of everyday life. Although ideas about integration and multiculturalism are predominantly forged through events and the surrounding representations in the media, the mid-level processes of the media sphere have been neglected in scholarship. -

The Jews of Magdeburg Under Nazi Rule Michael E. Abrahams-Sprod A
Life under Siege: The Jews of Magdeburg under Nazi Rule Michael E. Abrahams-Sprod BA (UNSW), Grad Dip Ed (UNSW), Cert T (NSW DSE), MA (UNSW) A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Hebrew, Biblical and Jewish Studies The University of Sydney June 2006 ii Table of Contents Declaration iv Abstract v Dedication vii Abbreviations and Acronyms viii Glossary x Acknowledgements xviii Introduction 1 Aim and Focus 1 The History of the Community until 1933 4 Archival Material and Oral History 11 Historical Approaches and Interpretation 16 Chapter One: The Structure of the Jewish Community 20 Religious, Social, Cultural and Economic Structures 20 The Dissolution of Communal Organisations 45 The Religious Congregations 54 Strategies of Communal Defence and Survival 65 Chapter Two: The Destruction of Jewish Livelihoods, 1933–1938 78 From Boycott to Expropriation 78 The Process of Aryanisation 115 Chapter Three: Daily Life in the Public Domain, 1933–1938 125 Nazi Policy toward the Jews 125 Daily Life and Exclusion 140 Contact with Non-Jews 152 Rassenschande 163 The Destruction of the German-Jewish Symbiosis 176 Chapter Four: Daily Life in the Private Domain, 1933–1938 182 Jewish Family Life and Social Life 182 The Emigration Quandary 191 iii Chapter Five: Daily Lives of Children and Youth, 1933–1938 202 Jewish and Non-Jewish Schools 202 Youth Movements 220 Preparation for Emigration 229 Children and Youth Leaving Home 241 Chapter Six: The Reichskristallnacht and Its Aftermath until September -

Post-Mining Regions in Central Europe
Umschlag_Wirth_Mining_165x235_4c_Layout 1 10.05.12 12:06 Seite 1 This volume is about post-mining regions in Central Europe, where people have taken up Peter Wirth, Barbara erni Mali, the challenge of overcoming the crisis provoked by the cessation of mining. Although the Wolfgang Fischer (Editors)Č č situation in these regions is mostly difficult, the book is not about decline and desperation. It is about concepts and strategies for shaping new perspectives at the beginning of the 21st century. It is about people who envisage new leisure attractions where excavators left a lunar landscape a few years ago, who create new technology centres on the sites of aban- doned processing plants, and who plan to extract clean energy from mine-water flowing Post-Mining Regions hundreds of meters under the surface; people intent on exploiting so-called »post-mining potentials« – the central topic of this volume. Mali, (Editors) Fischer W. After more than three years of common research, a group of scientists from Austria, the č in Central Europe Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, and Slovenia present an overview of the current erni Č situation and development perspectives in seven post-mining regions of Central Europe. They show that sustainable post-mining development is a highly relevant subject in our times. Problems, Potentials, Possibilities Despite the innumerable problems, a positive conclusion can be drawn: change is possible, and cooperation across the borders of European countries can contribute to its success. P. Wirth, B. P. Peter Wirth is a project coordinator in the Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development in Dresden/Germany. -

The Eastern German Education System in Transition. INSTITUTION Bundeswehr Univ., Hamburg (Germany)
DOCUMENT RESUME ED 380 336 SO 024 215 AUTHOR Block, Klaus-D.; Fuchs, Hans-W. TITLE The Eastern German Education System in Transition. INSTITUTION Bundeswehr Univ., Hamburg (Germany). REPORT NO ISSN-0175-310X PUB DATE Jan 93 NOTE 45p.; Revised version of a paper presented at the Annual Conference of German Studies (16th, Minneapolis, MN, October 1-4, 1992). PUB TYPE Reports Descriptive (141) Speeches/Conference Papers (150) EDRS PRICE MF01/PCO2 Plus Postage. DESCRIPTORS *Educational Change; Educational Development; *Educational Improvement; Educational Objectives; Educational Practices; Educational Trends; Elementary Secondary Education; Foreign Countries; Higher Education; Preschool Education IDENTIFIERS *Germany ABSTRACT This research summary presents a status report on the process of the thorough restructuring of eastern Germany since unification. Education and science are in the center of this effort. Explanation of the roles of education in the lives of citizens in both the former socialist and democratic republics is given. Both the ideological and practical influences are discussed. The paper gives an overall picture of the transformation process and deals particularly with:(1) thorough reform efforts with respect to contents, structures, and concepts as. demanded by the politically revelant participants (citizens movements, political parties, churches);(2) changes within the education system as put through by the last two German Democratic Republic (GDR) governments until October 3, 1990;(3) transitional regulations as provided by the Unity Treaty and its consequences for teachers, scholars, and students; (4) the reestablishing of the Lander of the former GDR and the emergei.ce of their new education policies; and (5) the transformation of social studies from socialist "Staatsburgerkunde" to a democratic political education. -

Recht: Ausbürgerung in Den Osten Vergessene Republik China
FÜR FREIHEIT, RECHT UND DEMOKRATIE 13017 Nr. 4/2011 Recht: Ausbürgerung in den Osten Vergessene Republik China Hoheneck: Auf die Freiheit! Gegründet 1991 vom BSV-Landesverband Berlin Aktuell2 Inhalt „Stasi in die Produktion!“ Aktuell Von Rainer Wagner 3 Unterstützung für Roland Jahn Doppelt bestraft Kaßberg als Gedenkstätte So lautete eine der wichtigsten Forde- Besonders unerträglich ist ihre Präsenz Die Mauer war Krieg rungen der Friedlichen Revolution 1989. in der für die Aufarbeitung des Stasi- Kommentar Die Angehörigen der DDR-Staatssicher- Unrechts zuständigen Institution, in der heit nannten sich Tschekisten, nach der Behörde des Bundesbeauftragten für die Recht Organisation ihres Idols Feliks Tserschin- Unterlagen des ehemaligen Staatssicher- 4 Opferrente und Stiftungsleistungen ski – einer der Führer des bewaffneten heitsdienstes (BStU). Welchen Einfluß die Die Gefangenenakten der DDR, Teil 7 Aufstandes der Bolschewiken während Staatssicherheit zeitweise dort hatte, er- 5 Ausbürgerung in den Osten der sogenannten Oktoberrevolution, der gab ein von Staatsminister Neumann in die gerade entstehenden zarten Ansät- Auftrag gegebenes Gutachten, aus dem International ze einer freiheitlichen Entwicklung im hervorging, daß ein ehemaliger Oberst 6 Vorbereitung auf Wiedervereinigung früheren Zarenreich in einem Meer von und ein ehemaliger Oberstleutnant des Die vergessene Republik China Blut und Tränen ertränkte. Der russische MfS gerade in den besonders brisanten Lenin-Putsch von 1917 war der Anfang IM-Verdachtsfällen Manfred Stolpe, Lo- Fragebogen einer bis dahin unvorstellbaren Terror- thar de Maizière und Gregor Gysi mit 8 Fragen zum Thema „Freikauf“ herrschaft, die zeitweise fast ein Drit- Sonderrecherchen in der BStU beauftragt tel der Welt unterdrückte und die mehr waren. Da wundert nicht mehr, daß einst Berichte Menschenleben forderte als die Tyrannen der PDS, heute Linkspartei, aus dieser 9 Abgestempelt des alten Roms, die mittelalterliche In- Behörde Stasi-Akten zugespielt worden Treffen der Waldheimer quisition und der Faschismus in seinen sind. -

The Evolution of PIK's Research Programme
Impressum Publisher Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V. (PIK) Postal address P.O. Box 601203 14412 Potsdam Germany Visitor address Telegrafenberg 14473 Potsdam Germany Phone +49 - 331-288-2500 Fax +49 - 331-288-2600 E-mail [email protected] Internet http://www.pik-potsdam.de Main Editor Margret Boysen Technical Management Dietmar Gibietz-Rheinbay Layout Margret Boysen (photo layout), Dietmar Gibietz-Rheinbay (template design), Wilhelmine Seelig, Ursula Werner (technical assistance). Cover design: POLYFORM, Büro für Grafik- und Produktdesign, Berlin. Printed by neue odersche Verlag und Medien GmbH Photo and Illustration Credits Illustrations: Front cover: Pol de Limbourg “Très Riches Heures du duc de Berry”, Janvier: le duc à table (banquet scene), vellum, 15th Century, Calendrier, Ms. 65/ 1284 f.1v, Musée Condé, Chantilly, France, © Giraudon/Brigdeman Art Library. Back cover: Pol de Limbourg, “Très Riches Heures du duc de Berry”, Novembre: la glandée; (feeding acorns to the pigs), vellum, avec zodiaque, 15th Cen- tury, Calendrier. Ms. 65/1284 f.11v, vellum. Musée Condé, Chantilly, France, © Giraudon/Bridgeman Art Library. Inside: all illustrations by PIK scientists or from publications to which PIK scientists have contributed, except: p. 13: Simon Bening, “Die Sint- flut”, 16. Jh. © Faksimile Verlag Luzern (www.faksimile.ch); p. 104: reprinted with permission from: Vörösmarty, C.J. et al., 2000, Science, 289, pp. 284-288, © AAAS; p. 101 POLYFORM, Büro für Grafik- und Produktdesign; p. 90, p. 100: Architektenbüro Borck, Boye, Schaefer. Photos by: ARDAU Weinimport GmbH (www.hola-iberica.de): p. 75; Hans Bach: (© PIK) pp. 19, 20, 22, 87, 92 bottom, 93 middle, 94 middle, 95, 96 1st row right, 97, 100 right; Helmut Biess: (© PIK) p. -

Antwort Der Landesregierung Auf Eine Kleine Anfrage Zur Schrift- Lichen Beantwortung
Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/4289 03.05.2019 Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift- lichen Beantwortung Abgeordnete Christina Buchheim (DIE LINKE) Fehlende Kandidaten zu den Ortschaftsratswahlen am 26. Mai 2019 Kleine Anfrage - KA 7/2467 Vorbemerkung des Fragestellenden: Wie die Mitteldeutsche Zeitung unter der Überschrift „Keine Kandidaten für Ort- schaftsrat - Wahl in Glauzig wird abgesagt“ berichtete, muss in der Stadt Südliches Anhalt die Ortschaftsratswahl in Glauzig abgesagt werden, weil es keinen einzigen Kandidaten gibt. „Ein neuer Termin werde von der Kommunalaufsicht festgelegt. Auch sonst fanden sich in einigen Orten nicht so viele Kandidaten wie benötigt. In Großbadegast, Wieskau und Zehbitz melden sich jeweils nur drei Kandidaten, ob- wohl in den Räten je fünf Plätze zu vergeben wären. Hier müssen Ergänzungswah- len angesetzt werden. Weil das Problem bekannt war, hatte es vor einigen Monaten die Option gegeben, die Ortschaftsräte zu verkleinern auf bis zu drei Personen oder ganz abzuschaffen zugunsten eines Ortsvorstehers.“ heißt es im entsprechenden MZ-Artikel. Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: Vorbemerkung des Fragestellenden: Die Durchführung der Kommunalwahlen, einschließlich der Wahlen des Ortschaftsra- tes und der Ortsvorsteher ist eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises der Ge- meinden. Statistische Daten liegen der Landesregierung daher nicht vor. Die Landes- Hinweis: Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage ist in Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader. Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt er- folgen oder die gedruckte Form abgefordert werden. -

Intensive Service in New Territories
THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE www.lrta.org www.tautonline.com NOVEMBER 2020 NO. 995 INTENSIVE SERVICE IN NEW TERRITORIES How LRT provided the foundations for modern Hong Kong UK: ‘Devastating consequences’ ahead? Berlin confirms expansion timetable Bucharest opens first M5 metro phase T yne and Wear Haifa – Nazareth £4.60 Looking forward to Global experience Metro’s next 40 years shapes Israeli LRT Certifi cate: PA05/04429 The design and implementation of urban Urban Transit light rail networks in busy towns and cities present signifi cant engineering challenges. Innovation Whether it’s for road or pedestrian crossings, tram stops, depots or complex crossovers Metro & Tramway Crossing Systemsand turnouts, our engineered solid rubber panels help you overcome your challenges Rosehill faster and more cost-effectively than other systems. Think Rosehill. For more information, call the Rosehill Rail sales team on +44 (0)1422 839 610. rosehillrail.com Rosehill Rail - TAUT Half page Ad_185x130mm_NOV2020.indd 1 30/09/2020 15:32 THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE Hong Kong Now amongst MTR’s worldwide operations, SYSTEMS the Hong Kong Light Rail system was devised to support local www.lrta.org FACTFILE and feeder www.tautonline.com demand No. MTR Light Rail - in newly- CHINA Hong Kong SAR, China urbanised areas. NOVEMBER 2020 N O. 995 157 By Neil Pulling. Hong Kong SUB SCRIBE NOW! INTENSIVE SERVICE IN NEW TERRITORIES Now in its 83rd year, Tramways & Urban Transit is ong Kong’s Light Rail A pair of Phase 1 LRVs (HKLR) system Wai (classified with Yuen Long). the world’s leading monthly publication dedicated solely to with a 706 circular installation sometimes followed The Wharf group, then owners of serves neighbouring service on Tin Shui construction of buildings, many being the tramway dating from 1904 on communities in a Road on 7 August 2020. -
Download Brochure (PDF)
THE STAGE FOR YOUR SUCCESS FACTS, FIGURES & CONTACTS www.halle-investvision.com WELCOME TO HALLE (SAALE)! CONTENTS WHAT THE CITY OFFERS Dear Reader, 2 A Business Location for Visionaries Halle (Saale) is a dynamic city of culture, the birth- spin-offs from research facilities. Wein- place of Georg Friedrich Handel and Germany's berg Campus, the second largest techno- 3 Excellent Reasons in Favour of Halle (Saale) greenest major city offering a wide range of facilities logy park in eastern Germany, supports in- for sport and leisure. Culture, business and science novative fields of the future and promotes 4 Top Location – Outstanding Transport Connections form an irresistible trinity here. They provide the ba- new developments in the bioscience and sis for the promising future of this growing cosmopo- nano industries. The university institutes 6 A Dynamic Labour Market litan city with its celebrated universities and research on the campus alone are home to 8,000 institutes. Further features of the city are its distin- up-and-coming natural scientists. The 8 Benefits of the Location – the Facts guished cultural and artistic institutions, including campus is also the meeting place for start- an opera house, theatres, choirs, the Staatskapelle up businesses and entrepreneurs on the 10 Life and Leisure in Handel's Birthplace orchestra, museums, art galleries and cinemas. The one hand and on the other researchers annual international Handel Festival is a special high- from the MLU, Max Planck, Fraunhofer light in the city's calendar. and Leibniz institutes as well as the Helm- holtz Association. So far over €1 billion has SECTORS OF INDUSTRY & LOCATIONS As a business location Halle (Saale) offers a vibrant been invested here.