Aktuelle Verkehrsprojekte in Der Ostschweiz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
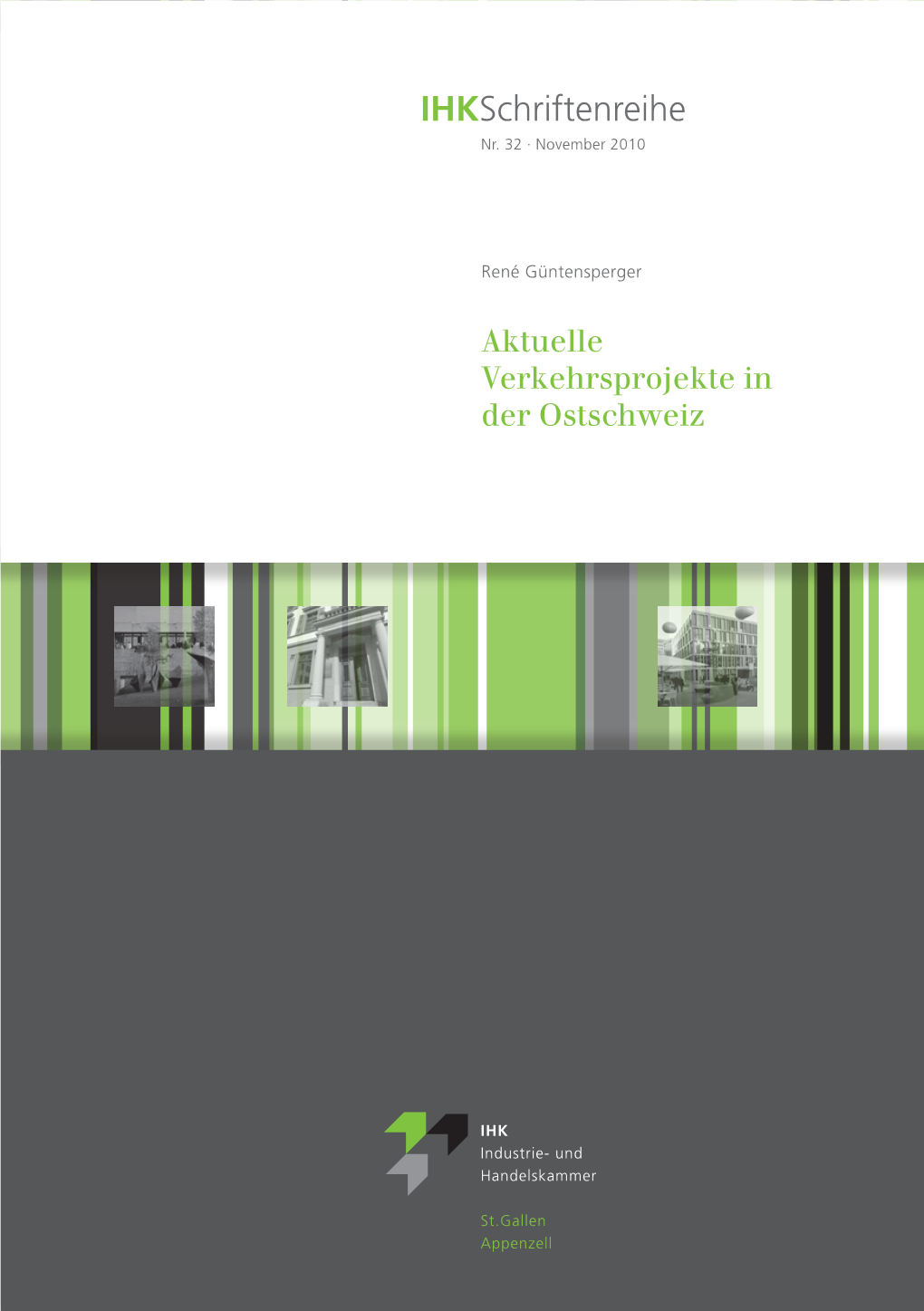
Load more
Recommended publications
-

Winter Im Toggenburg
NATUR WILLKOMMEN ANREISE Mit Oskar in die WINTER IM UND IM TOGGENBURG Ferien sparen. TOGGENBURG KLANG Das Toggenburg im Sommer. Zwischen Churfirsten Im Herzen der Ostschweiz - eine Autostunde von Zürich Die verschneite Winterlandschaft glitzert vor der und Säntis, Wildhaus und Wil. Sanfte Hügel, herausra- und vom Bodensee entfernt, liegt das Toggenburg. Ausflug Sport Familie Kultur Genuss Kulisse der Churfirsten in der Sonne. Hier geht es auch TOGGENBURG gende Gipfel, lauschige Flusstäler, weite Hochplateaus Gut erschlossen mit dem öffentlichen Verkehr, lässt im Winter entspannt zu und her. Kilometerweise SCHWEIZ – kurz: Postkartenansichten, wohin das Auge blickt. sich die Ferien- und Ausflugsregion mit Zug und Skipisten, Schneeschuh-Trails, Winterwanderwege, Wohltuende Bergluft und unverfälschte Landschaften. Postauto erreichen. Auto- und Motorradfahrer reisen Langlaufloipen und Schlittelbahnen. Obendrein coole Willkommen in der Heilen Welt, wo Natur und Klang von den Autobahnen A1, A3 und A13 ins Toggenburg. Funparks und eine spiegelglatte Eisfläche. aufeinandertreffen. Aus dem süddeutschen Raum Klang, Resonanz und Brauchtum werden hier in der Via Bregenz und St.Margrethen auf der A13 bis Klangwelt Toggenburg in authentischer Umgebung Haag und die Ausfahrt Toggenburg/Wildhaus nehmen. erlebbar gemacht. Oder via Konstanz bis Wil und dann ins Toggenburg abbiegen. In der Ferienregion fühlen sich Familien besonders wohl. Unzählige Themenwege, kindergerechte und kinderwa- Aus dem Grossraum Zürich und der Innerschweiz gentaugliche Wanderungen, Erlebnisse mit Tieren, Auf der A3 bei Reichenburg Richtung Rapperswil halten Spielplätze, Feuerstellen und Spassfahrzeuge lassen und danach über den Rickenpass nach Wattwil. keine Langeweile aufkommen. Deshalb tragen wir mit Stolz das Gütesiegel «Family Destination». toggenburg.swiss/ Aus der Ostschweiz winter Lassen Sie sich von unseren ausgewählten Von St.Gallen nach Herisau und weiter über die Ideen inspirieren. -

Unteres Neckertal
Aus der Gemeinde Unteres Neckertal www. ref-unteresneckertal.ch Pfarramt Mogelsberg, Pfarramt Brunnadern Pfarramt Oberhelfenschwil Sekretariat, Schulweg 5, 9126 Necker 071 374 28 09 071 374 11 97 071 374 11 75 071 374 23 57 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Diesen Tag hat Gründungsfest er zum Fest Kirchgemeindezentrum Necker Musikgesellschaft Evang. Kirchgemeinde 11.30 Uhr, Apéro Oberhelfenschwil, Jugendband gemacht, lasst Unteres Neckertal 12.30 Uhr, Mittagessen Alle sind herzlich eingeladen! Sonntag, 2. Juni 2013 und Dessertbuffet uns fröhlich Für Gottesdienstbesucher, die sein und jubeln! Kirche Brunnadern Mit Spiel und Spass für Gross und nicht nach Necker laufen oder 10 Uhr, Festgottesdienst mit der Klein, musikalische Umrahmung: velofahren können, stehen «Taxi»- Psalm 118, 24 Singgruppe, Kinderhüti Landfrauenchörli Brunnadern, Fahrer bereit. Wir haben Grund Gesamtgemeinde aufgenommen. Neue Ideen und Team-Konstella - möglich gewesen ohne die gute zum Feiern! Die zentralen Räume im alten tionen entstehen. Erlebnispro - Vorarbeit, die von den früheren Schulhaus Necker (Kirchgemein - gramme sind eingeführt und Vorstehern, Haupt- und Neben - Die Fusion ist gut über die Bühne dezentrum!) werden durch Ju - funktionieren. All dies wäre nicht amtlichen in unsern Dörfern über gelaufen. Zwei neue Pfarrpersonen gendtreffen, Musikproben und Sit - möglich gewesen ohne die unzäh - Jahre geleistet wurde. Wir stehen und ein neuer Präsident sind in ih - zungen belebt. Das Gemeinde- ligen Stunden, die Kirchenvorste - als Kirchgemeinde auf einem re Ämter eingesetzt worden. Eine leben in den Dörfern blüht weiter herschaft und viele Freiwillige in - guten Boden. Das möchten wir Sekretärin hat ihre Arbeit für die auf. -

Referenzen Naturschutz / Landschaft
20.09.2021 REFERENZEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFT Auftragsbezeichnung Unsere Leistungen Auftraggeber Jahr Besucherlenkungskonzept Erstellung eines Besucherlenkungs- Gemeinde Nesslau, Kanton 2021 Wolzenalp konzeptes in der Moorlandschaft St.Gallen ANJF Wolzenalp Kartierung der Biotope von Vegetationskartierung der Schutzgebiete/ Kanton St.Gallen ANJF, Guido 2021 lokaler Bedeutung im Kanton Potenzialstandorte von lokaler Bedeutung, Ackermann / Thomas St.Gallen 2021 Abgrenzung im Feld und Erhebung des Ellenbroek Zustandes. Biodiversitätskonzept Gemeinde Aufnahme der Flächen, Erarbeitung von Gemeinde Oberhelfenschwil 2021 Oberhelfenschwil Aufwertungsmassnahmen, Berichterstellung. Vergleich und Aktualisierung des Heckeninventars von 2009. Kanton St.Gallen, ANJF, Heckenmonitoring St.Gallen Luftbildvergleiche, Photogrammetrische 2021 Herr Erich Fischer Auswertung, GIS-Überarbeitung, Berichterstellung. Biodiversitätmonitoring (BDM) Testkartierung aller Tagfalter entlang Kanton Graubünden, ANU, 2021 Graubünden einem 2.5km langen Transekt. Herr Luis Lietha Überarbeitung der Auenperimeter von Kanton St.Gallen, ANJF, Auenperimeter St.Gallen nationaler und regionaler Bedeutung im 2021 Herr Guido Ackermann GIS mithilfe der aktuellen Luftbilder. Heckenmonitoring St.Gallen Kanton St.Gallen, ANJF, Projekterarbeitung, Konzepterstellung 2020 Vorprojekt Herr Erich Fischer SVO Wildhaus-Alt St.Johann Überarbeitung des Teils Natur- und Gemeinde Wildhaus-Alt St. 2020 - heute Landschaftsschutz der Schutzverordnung, Johann GIS-Analyse, Feldarbeit Gutachten Wegebau -

Richtplan Kanton St.Gallen
Kanton St.Gallen Richtplan Kanton St.Gallen Amt für Raumentwicklung und Geoinformation Stand April 2021 Informationen Raumentwicklungsstrategie Siedlung V Natur und Landschaft VI Verkehr VII Versorgung und Entsorgung Karte I Informationen I 11 Einleitung I 12 Übersicht Koordinationsblätter und Karte I 13 Stand der Richtplanung Einleitung I 11 Einleitung Auftrag Das Instrument des kantonalen Richtplans ist mit dem Bundesgesetz über die Raumplanung (SR 700; abgekürzt RPG) vom 22. Juni 1979 eingeführt worden. Mit der Revision des RPG – in Kraft seit Mai 2014 – wurde die Rolle des Richt- plans im Bereich der Siedlungsentwicklung präzisiert und verstärkt. Der kantonale Richtplan ist nach Art. 9 Abs. 3 RPG in der Regel alle zehn Jah- re gesamthaft zu überprüfen und nötigenfalls anzupassen. Der erste Richtplan wurde am 27. September 1989 vom Grossen Rat erlassen und am 16. Oktober 1990 durch den Bundesrat genehmigt (Richtplan 87). Eine erste Gesamtüber- arbeitung wurde am 23. April 2002 von der Regierung erlassen und vom Bun- desrat am 15. Januar 2003 genehmigt (Richtplan 01). Aktuell befindet sich der Richtplan des Kantons St.Gallen in seiner zweiten Gesamtüberarbeitung. Nach Art. 8 RPG zeigt der Richtplan mindestens: a. wie der Kanton sich räumlich entwickeln soll; b. wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Ent- wicklung aufeinander abgestimmt werden; c. in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufga- ben zu erfüllen. Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen einer Grundlage im Richtplan. Die raumwirksamen Aufgaben des Bundes und der Nachbarkantone müssen sachgerecht berücksichtigt werden (Art. 11 RPG). Der kantonale Richtplan ist für die Behörden der Gemeinden, des Kantons und des Bundes verbindlich (Art. -

Meeting Planner 2019
Meeting planner 2019 Ideas for meetings & congresses in Eastern Switzerland Meeting planner 2019 Need more inspiration? Just visit our plattform: www.st.gallen-convention.ch Fresh ideas, surprising offers, daily updates. For congresses. For meetings. For events. For social activities. For your event. St.Gallen-Bodensee Tourismus Convention Bureau Bankgasse 9 CH-9001 St.Gallen T +41 71 227 37 32 F +41 71 227 37 67 [email protected] www.st.gallen-convention.ch st.gallen-convention.ch Gratis spielen, 10’000 CHF und grosser Jackpot zu gewinnen. Unterhaltung Gambling Night mit DJ/Live Music. www.swisscasinos.ch www.st.gallen-convention.ch | 1 Conferences in Eastern Switzerland – let us explore it together. A retreat in monastic seclusion, a large convention in the city of St.Gallen or a seminar in maritime surroundings: we know Eastern Switzerland like the back of our hand and will find the right conference venue and social programme for you. Passion, personal dedication, a knack for recognising new and innovative ideas and a love of the destination: that is what makes our team so special. We would be happy to put our experience and local expertise at your disposal to help organise your event. Whether convention, seminar, event or social programme – we set you up with the right local partners. This is the key to suc- cess. We focus on your individual needs. They are our highest priority. After all, you want your event to be an unforgettable experience for your guests – in beautiful Eastern Switzerland. We offer you compe- tance, expertise and a single local contact, all from a single source. -

Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal Jubiliert
Mitteilungsblatt Ausgabe Nr. 10 | 20. Mai 2021 Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal jubiliert Die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal Gerne lade ich Sie dazu ein, die neue Feuerstelle, das gross- feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Die Feier- zügige Geschenk der Jubilarin, zu nutzen. Ein Erlebnis für lichkeiten hätten am vorletzten Wochenende stattgefun- Gross und Klein, Jung und Alt, das viel Freude bereitet. Die den, konnten aber aufgrund der Corona-Situation leider Feuerstelle liegt gleich hinter der Säge Hätschberg mitten nicht durchgeführt werden. Als ehemalige Darlehenskasse im Wald und entlang des Sägewegs. Ungestört kann man in Bütschwil ist die Bank seit 1921 tief mit der Geschichte un- dieser Naturidylle dem Zwitschern der Vögel lauschen und serer Gemeinde verbunden. Die Raiffeisenbanken als selb- das Plätschern des Säge-Baches nebenan geniessen. Wer ständige, genossenschaftlich organisierte Banken sind in ein schattiges Örtchen für eine Zwischenverpflegung sucht, unserer Talschaft mit der Bevölkerung, dem Gewerbe und der ist hier genau richtig. Geniessen Sie Ihre Wurst und andere Wirtschaft stark verwurzelt. Die damit verbundene Nähe zu Leckereien zubereitet auf der offenen Feuerstelle, und gön- den Kunden hält die Raiffeisenbanken deshalb auch stark auf nen Sie sich Ruhe und Musse bei einer Auszeit auf dem ein- Erfolgskurs. Der Wunsch nach Vertrauen und Sicherheit ist ein zigartigen R-Bänkli. Anliegen aller Bankkunden, denn ohne Vertrauen und Sicher- heit kann keine fruchtbare Beziehung aufgebaut werden. Im Namen des Gemeinderates und der ganzen Bevölkerung der Politischen Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil gratuliere Die Raiffeisenbanken stellen den Menschen in den Mittel- ich der Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Necker- punkt und zeichnen sich durch einen unabhängigen und re- tal zu ihrem 100-jährigen Bestehen. -

Kennen Sie Thurbo?
Kennen Sie Thurbo? Das Selbstverständnis von Thurbo „Als Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Verkehrs stehen für uns 3 die Bedürfnisse der Fahrgäste im Mittelpunkt. Darauf ausgerichtet gestalten wir die Angebote so aus, dass sie unsere Mitarbeitenden in einem moti- vierenden Umfeld erbringen können. Die fi nanziellen Folgen entsprechen gleichzeitig den Möglichkeiten der öffentlichen Hand.“ Auszug aus dem Leitbild Facts & Figures Netzlänge 1) 580 km Die Zahlen gelten für Thurbo. Ferner erbringt Thurbo 5 Bahnhöfe und Haltepunkte 1) 173 Leistungen im Auftrag der Deutschen Bahn (DB) und der Schweizerischen Südostbahn (SOB). Triebfahrzeuge 2) 90 Personenwagen 3) 4 1) Die Infrastruktur (Bahnhöfe, Gleise) gehört der Zugkilometer pro Jahr 11,5 Mio. Zkm SBB. Die Strecke Wil–Weinfelden–Tägerwilen Fahrgäste pro Jahr 30 Mio. (Abzweigung Tägermoos) gehört Thurbo, wird Personen-Kilometer 4) 435 Mio. Pkm aber von der SBB bewirtschaftet. Mitarbeitende 426 2) Die Zahl setzt sich zusammen aus 10 elektrischen Bevölkerung im Einzugsgebiet 800 000 GTW 2/6 der 1. Serie, 41 zweiteiligen elektri schen Aktionäre SBB (90%) GTW 2/6 der 2. Serie und 39 drei teiligen GTW 2/8. 3) Kanton TG (10%) Steuerwagen zu den GTW 2/6 der 1. Serie 4) Geschäftsführer Dr. Ernst Boos Von allen Reisenden zusammen zurückgelegte Distanz. 1.1.2011 Unterwegs im modernen Gelenktriebwagen (GTW) Thurbo setzt auf neues Rollmaterial. Typ GTW 2/6 GTW 2/6 (AK) GTW 2/8 (AKL) 7 Zufriedene Fahrgäste wissen das zu RABe RABe RABe schätzen. Innert weniger Jahre hat Thurbo 526 680–689 526 701…751 526 752–790 vollständig auf neue Gelenktriebwagen Anzahl 10 41 39 (GTW) umgestellt. -

Result List Men 42 Km
42. ENGADIN SKIMARATHON FIS MARATHON CUP 2010 S-chanf 14/03/2010 Starttime: Result List Men 42 Km Jury Course Rounds HD MC TC TD - FIS BARCATTA Bruno (ITA) 42 K 1 TD - FIS Ass. POOL Marianne (SUI) Chief of Competition GIGER Albert (SUI) Technic Free Codex 3050 Rk Bib Name YoB Place Time Delay km/h 1. 222 Cologna Dario 1986 Müstair 1:36.58,1 ------ 26,108 2. 208 Tynell Daniel 1976 S-Borlänge 1:37.00,9 0.02,8 26,095 3. 205 Perrillat Christophe 1979 F-Le Grand Bornand 1:37.01,0 0.02,9 26,095 4. 204 Cattaneo Marco 1974 I-Caronno Pertusella (VA) 1:37.01,5 0.03,4 26,093 5. 207 Carrara Bruno 1977 I-Serina (BG) 1:37.04,0 0.05,9 26,082 6. 201 Santus Fabio 1976 I-Gromo (BG) 1:37.05,4 0.07,3 26,075 7. 322 Galli Morris 1981 I-Livigno (SO) 1:37.07,9 0.09,8 26,064 8. 325 Ahrlin Jerry 1978 S-Vålådalen 1:37.12,6 0.14,5 26,043 9. 206 Andréasson Rikard 1979 S-Mora 1:37.13,2 0.15,1 26,040 10. 318 Eberharter Michael 1983 A-Tux 1:37.13,8 0.15,7 26,038 11. 299 Sim Ben 1985 AUS-Cooma Nth, NSW 1:37.14,8 0.16,7 26,033 12. 231 Freimuth Thomas 1980 D-Lindberg 1:37.15,6 0.17,5 26,030 13. 203 Fredriksson Mathias 1973 S-Östersund 1:37.17,7 0.19,6 26,020 14. -

Brunnadern, Mogelsberg Brunnadern 1
Kt. Bez. Gemeinde Ort ISOS SG 04/ Brunnadern, Mogelsberg Brunnadern 1. Fassung 08.2003/fsr O 12 Nachträge ox aufgenommen Do–l–X/-X/-X/ o besucht, nicht aufgenommen o Streusiedlung Qualifikation Bewertung des Ortsbildes im regionalen Vergleich Mehrteiliges, ehemaliges Bauerndorf in teilweise verbauter Situation am linken Talrand und in der Talsohle des Neckers. Bescheidene Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Gewisse Lagequalitäten dank der auf die Topografie eingehenden Siedlung mit langgestreckter Silhouette, darin die Pfarrkirche mit spitzhelmigem Turm als Akzent. Teilweise gut in die Wieslandschaft eingebettete kleinere Ortsteile. Gewisse räumliche Qualitäten wegen des Strassenraums im Ortskern und dank der klaren baulichen Hierarchie im Dorf. Zum Teil noch begrünte Zwischenbereiche und sanfte Übergänge in die nahe Umgebung. Gewisse architekturhistorische Qualitäten dank der Pfarrkirche, einzelner intakter Bürger- und Fabrikantenhäuser, der für die Region typischen Bauernhäuser und Gasthäuser sowie wegen ein- zelner Wohnhäuser aus dem 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Vergleichsraster o Stadt (Flecken) ox Dorf Lagequalitäten X / o Kleinstadt (Flecken) o Weiler räumliche Qualitäten X / o Verstädtertes Dorf o Spezialfall architekturhistorische Qualitäten X / zusätzliche Qualitäten Siedlungsentwicklung Historischer und räumlicher Zusammenhang der wesentlichen Gebiete, Baugruppen, Umgebungen und Einzelelemente; Konflikte; spezielle Erhaltungshinweise Das im Herzen des Neckertals und im nördlichen Zipfel der mittelgrossen Gemeinde liegende Pfarrdorf taucht erstmals 1377 als "Brunadran" in den Urkunden auf. Der Name scheint sich von besonders ergiebigen Quelladern herzuleiten. Die dünn besiedelte Gegend stand im Spätmittelal- ter unter der Herrschaft der Grafen von Toggenburg und kam 1468 mit dem gesamten Toggenburg durch Kauf an die Fürstabtei St. Gallen. Der neue Landesherr unterstellte den Ort dem Gericht Neckertal. Kirchliches Zentrum war während Jahrhunderten Oberhelfenschwil. -

Gemeinden: Hemberg, Neckertal, Oberhelfenschwil
Kanton St.Gallen Waldregion 5 Toggenburg Waldentwicklungsplan Nr. 16 "Neckertal" Gemeinden: Hemberg, Neckertal, Oberhelfenschwil Volkswirtschaftsdepartement | Kantonsforstamt Impressum Planungsleitung Gantner Christof, Regionalförster, Waldregion 5 Toggenburg, 9642 Ebnat-Kappel Leitungsgruppe Gantner Christof, Regionalförster, Waldregion 5 Toggenburg, und Bearbeitung 9642 Ebnat-Kappel Wild Vreni, Gemeindepräsidentin Neckertal, 9122 Mogelsberg Weibel Florian, Revierförster Forstrevier Wilket, 9621 Oberhelfenschwil Stacher Max, Wildhüter, 9608 Ganterschwil Bürge Michael, Wildhüter, 9604 Lütisburg Hugentobler Ivo, Naturkonzept AG, 8266 Steckborn Arbeitsgruppe Ammann Mario, Orientierungslauf, 9442 Berneck Ammann Stefan, Gemeinderat Oberhelfenschwil, 9621 Oberhelfenschwil Anderegg Hans, Privatwaldbesitzer, 9014 St.Gallen Baumann Ernst, Orientierungslauf, 9536 Schwarzenbach Baumann Peter, Jagdgesellschaft Oberhelfenschwil, 9444 Diepoldsau Brander Walter, Gemeinderat Neckertal, 9114 Hoffeld Brazerol Roman, Revierförster Forstrevier Lichtensteig, 9630 Wattwil Büchler Urs, Wildhut, 9655 Stein Bühler Bruno, Privatwaldbesitzer, 9127 St.Peterzell Fäh Adolf, Neckertal Tourismus, 9125 Brunnadern († 13.01.2016) Forrer Werner, Kirchgemeinde Ob. Necker, 9107 Urnäsch Haas Ralph, Revierförster Kloster Magdenau, 9116 Wolfertswil Holenstein Jerry, Naturschutzverein Oberhelfenschwil, 9621 Oberhelfenschwil Kern Urs, Revierförster Forstrevier Lichtensteig, 9630 Wattwil Koller Daniel, Neckertal Tourismus / Biker, 9122 Mogelsberg 2/106 Litscher Daniel, Langsamverkehr -
Festführer Mv-Degersheim.Ch Herzlich Willkommen
Festführer mv-degersheim.ch Herzlich Willkommen Liebe Musikantinnen und Musikanten Geschätzte Ehrengäste, Musikfreunde, Gönner und Festbesucher Das OK und der Musikverein Harmonie heissen Sie alle in Degers- heim herzlich willkommen. Ganz herzlich begrüssen wir sämtliche Musikvereine des Kreises Neckertal zum Kreismusiktag. Besonders freuen wir uns über die Teilnahme der Gastvereine aus Bad Ragaz, Flawil, Wängi TG und Chamoson VS. Schön, euch bei uns zu haben! Das musigfest 18 bietet Unterhaltung pur. Davon können Sie sich auf den folgenden Seiten in den Detailprogrammen überzeugen. Natürlich stehen Ihnen auch die Türen für Festwirtschaft, Kaffee- stube und Bar offen. Wir laden Sie ein, einige frohe und unter- haltsame Stunden mit uns zu verbringen. Während dem ganzen Kreismusiktag geniessen Sie freien Eintritt. Seien Sie unser Gast und lassen Sie es sich gut gehen. Wir ver- wöhnen Sie gerne mit Unterhaltung aber auch mit kulinarischen Highlights! Ich freue mich, Sie am musigfest 18 begrüssen zu dürfen und wünsche Ihnen ein unvergessliches und gemütliches Fest in Degersheim! Die MG sorgt für optimale Ein herzliches Dankeschön gebührt meinen Kolleginnen und Kollegen im OK, den vielen Helferinnen und Helfern, der St.Galler Stimmung am Kreismusiktag. Kantonalbank (Hauptsponsor), den zahlreichen Tombolaspendern, Sponsoren und Gönnern, den Behörden und Ihnen, die Sie mit Wir sorgen für optimales Klima. Ihrem Besuch unser musigfest 18 zu einem festlichen Höhepunkt werden lassen. Thomas Bohler OK-Präsident, musigfest 18 Krüger + Co. AG entfeuchten heizen 9113 Degersheim ⁄ T 071 372 82 82 kühlen [email protected] ⁄ krueger.ch sanieren Krueger_Inserat_Musikgesellschaft_105x210_DE.indd 1 19.03.18 09:27 Lageplan Tagesprogramm 2. Juni 2018 12.30 – 15.50 Bewertungsvorträge 8 Altersheim Steinegg 7 Schwimmbad 6 Bahnhof SOB 5 Gemeindehaus 4 Kath. -

St. Peterzell/Herisau/Wattwil 273 Gültig Ab 13
St. Peterzell/Herisau/Wattwil 273 Gültig ab 13. Dezember 2020 Uzwil Isnyplatz 741 Flawil Bahnhof Gerbhof 151 Maestrani Migros-MarktFalkenstr.MooswiesMettendorfMigros BZCoop BZ Bruggwis Unterrindal 750 Bahnhofstr. Herisauerstr. 155 Unterstr. Im Alterssiedlung Kirchstr. Grütli Oberrindal Landhaus Ramsau Ritzenhüsli Buebental Bärenplatz Glatthalde Oberglatt Poststr. 767 751 Oberstr. Badstr. Lindengut 152 Rindal IC IR S1 IC IR S1 S5 Birkenstr. St. Gallen Grünhügel Reithalle 751 Gossau Bahnhof Schändrich Burgau 158 Multstr. S23 Talstr. Abzw. Tufertschwil Magdenau Geissberg Nordhalde Lütisburg Fennhof Rütihalde Herisau Bahnhof Rietwis Talweg Tüfi Dorf Burghalde Friedhof Sportzentrum alte Post Stelz 173 Ebnet 768 Psychiatrisches Zentrum Kreuzweg 171 767 152 Schachen 182 158 Grund Ramsenhof Cilander (Herisau) 176 Ramsen Tüfenau Huebstr. Kaserne Ganterschwil Kreuzstr. Obere Fabrik 181 Müli 183 alte Post Wiesental Migros/ 175 Spital Schloss Obstmarkt 172 180 Ifang Bruggeregg 174 S4 Post/Casino Hirschen S2 Am Bach GemeindehausBergstr.Steinegg IR Degersheim 751 Ifang Oetschwilerstr. Glattmüli Hinterschwil Sonnenberg Wil Lederbach Au Johannesbad Post Landersberg Wilen Engi Bütschwil Degersheim St. Gallen Wolfhag Langelen Bahnhof Hohrain Hofwiesen Sommertal S23 Ziegelhütte Scheidweg Pflegeheim Hoffeld Dorf Post Mogelsberg Schwellbrunn Bütschwil Bahnhof Halden Säge Säge-Waldbach 184 171 Auerhof Mosnang Risi Waldstatt Strickwald 180 Oberhelfenschwil Tobelacker 182 Auerhof Dorf 181 771 Waldstatt Hirschenkreuzung Metzwil Dorf Neudietfurt Tobelacker Wigetshof Necker Dietfurt Grütli Bahnhof Adler 772 Dietfurt Winkfeld Langensteig Brunnadern-Neckertal Bahnhof Freihof Alters- u. Pflegeheim Einsiegele Brisig 182 Dicken Dorf Rotschwendi Steigrüti 186 Anker 770 Teufen (Tüfi) St. Loreto Wohnheim Spreitenbach Gurtbergwald Schwindel 182 Hof 183 Furth Auboden Postgarage Krinau Mühle 184 Dorf Stafel Zürchersmühle Gurtberg Obertor S4 Schönengrund S2 Restaurant Lichtensteig IR Rüti Schönenbühl Bahnhöfli Dorf 182 Untertor St.