Als PDF Downloaden
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Regelungstechnische Analyse Und Synthese Von MEMS Mit Elektrostatischem Wirkprinzip
Regelungstechnische Analyse und Synthese von MEMS mit elektrostatischem Wirkprinzip von der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Chemnitz genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) vorgelegt von Dipl.-Ing. Heiko Wolfram geboren am 28. September 1972 in Plauen eingereicht am 22. Juni 2006 Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Wolfram Dötzel Technische Universität Chemnitz Prof. Dr.-Ing. Jozef Suchý Technische Universität Chemnitz Dr.-Ing. habil. Peter Schwarz Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen Außenstelle Entwurfsautomatisierung Dresden Tag der Verleihung: 22. Mai 2007 Bibliographische Beschreibung Regelungstechnische Analyse und Synthese von MEMS mit elektrostatischem Wirkprinzip Wolfram, Heiko — 185 Seiten, 74 Abbildungen, 8 Tabellen, 172 Literaturstellen Technische Universität Chemnitz Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Dissertation, 2007 erschienen unter Shaker Verlag Aachen c Shaker Verlag 2007 ISBN 978-3-8322-6348-5 ISSN 0945-1005 Stichworte Beschleunigungssensor elektrostatisches Wandlerprinzip Identifikation MEMS Modellbildung Regelung H-unendlich Regelung Nichtlineare Regelung Stabilitätsanalyse Ljapunow-Funktion Kurzreferat Die vorliegende Arbeit gibt eine umfassende Beschreibung elektrostatisch erregter und kapa- zitiv detektierter MEMS am Beispiel eines Beschleunigungssensors. Ausgehend von einem Feder-Masse-Dämpfer System wird ein mathematisches Modell des Gesamtsystems für den Reglerentwurf aufgestellt. Neuartige Identifikationsmethoden -

Karlheinz Stockhausen
Karlheinz Stockhausen Copyright ©: Archiv der Stockhausen-Stiftung für Musik, Kürten, Deutschland (www.stockhausen.org) 2 Nisan 2009 - 19.30 işbirliği ile 1 KARLHEINZ STOCKHAUSEN (22.Ağustos.1928 [Mödrath] – 5.Aralık.2007) Bu yazıda, ikinci dünya savaşı sonrası döneminin en önemli ve en etkin temsilcilerinden biri olan Alman besteci Karlheinz Stockhausen’ı tanıyacağız. Prensipte her besteci ayrı bir dünyadır. Ancak söz konusu Stockhausen gibi bir besteci olduğunda, bu dünyanın bir hayli genişlediğini, kendi içerisinde yeni dünyalar yarattığını ve bir hayli karmaşık bir hal aldığını söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Stockhausen “20.yüzyıl müziğinin devi”, “20.yüzyıl müziğinin en büyük hayalperesti” ve benzeri pek çok nitelendirmelerle anılan bir sanatçıdır. Müzik sanatının pek çok türünde - ki bunlara yeni türler de dâhildir - 370’in üzerinde eser vermiştir. Stockhausen 22. Ağustos.1928’de Köln’ün Burg Mödrath köyünde doğdu ve yaşamının yine önemli bir kesitini Köln ve civarında geçirdi. Stockhausen küçük yaşta annesi vasıtasıyla müzikle tanıştı ve üstün müzikal algısıyla dikkat çekti. Annesinden aldığı ilk piyano derslerini (1936-37), yerel bir okulda obua dersleri izledi ve üstün yeteneği sayesinde, kısa sürede senfoni orkestrasına ikinci obuacı olarak girmeyi başardı. 13 yaşındayken, savaş sonucunda her iki ebeveynini de kaybeder. Annesi Nazi asimilasyon politikasının kurbanı olmuş ve yattığı psikiyatri enstitüsünde öldürülmüştür. Babası ise savaş alanında hayatını kaybetmiştir. Tüm bu travmatik olaylar, onun “otobiyografik” olarak nitelediği “Licht” adlı operasının “Donnerstag” kesitinde de son derece dramatik bir anlatımla kendini gösterir. Stockhausen, II. Dünya Savaşı yıllarında, savaş cephesi yakınlarındaki bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışır. Bu onda derin bir iz daha bırakır. Kendisi bu deneyimini “ölümden korkacak hiçbir şeyim kalmadı” sözleriyle ifade eder. -

Phasespace Dynamics of Strongly Interacting Bose Systems
Masterthesis Phasenraumdynamik von stark wechselwirkenden Bose Systemen Phasespace dynamics of strongly interacting Bose systems vorgelegt von Eduard Seifert September 2014 Betreuer: Prof. Dr. Dr. Wolfgang Cassing Institut fur¨ Theoretische Physik Fachbereich 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie Justus-Liebig-Universit¨at Gießen Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Theoretische Einfuhrung¨ 5 2.1 Kadanoff-Baym Gleichungen . .5 2.2 Transport . 15 2.2.1 Nicht-relativistische on-shell Transporttheorie . 15 2.2.2 Relativistische off-shell Tranporttheorie . 19 2.2.3 Phasenr¨aume . 22 2.3 Numerische Implementierung . 27 3 Transportsimulation in 2+1 Dimensionen 31 3.1 Kopplung λ=14 GeV . 31 3.2 Kopplung λ=18 GeV . 40 3.3 L¨osung der Kadanoff-Baym Gleichungen . 41 4 Zusammenfassung 49 A Gradientenentwicklung 53 B Volumenabh¨angigkeit der L¨osung der Tranportgleichung 55 Literaturverzeichnis 57 a Kapitel 1 Einleitung In weiten Teilen der Physik sind es Vielteilchensysteme außerhalb des Gleichgewichts, die das Interesse der Forschung bilden. Aus diesem Grund wird sich seit Jahrzehnten darum bemuht¨ die verschiedenen Transportprozesse, wie sie in der Kernphysik, Plasmaphy- sik, Festk¨orperphysik oder in Schwerionenkollisionen vorkommen, theoretisch korrekt zu beschreiben. Vor allem die Nichtgleichgewichtsdynamik von sehr schnell ablaufen- den Prozessen steht dabei im Mittelpunkt. Den Anfang solcher Nichtgleichgewichts- Beschreibungen machte Boltzmann mit seiner beruhmten¨ Transportgleichung [1] En- de des 19. Jahrhunderts, welche die kinetische -

Siegener Beiträge Zur Geschichte Und Philosophie Der Mathematik Band 10
Ralf Krömer und Gregor Nickel (Hrsg.) Band 10 • 2018 SieB – Siegener Beiträge zur Siegener Beiträge zur Geschichte und Philosophie Geschichte und Philosophie der Mathematik SieB der Mathematik Bd. 10 (2018) Mit Beiträgen von Edward Kanterian What is in a Definition? Understanding Frege’s Account Karl Kuhlemann Über die Technik der infiniten Vergrößerung und ihre mathematische Rechtfertigung Karl Kuhlemann Zur Axiomatisierung der reellen Zahlen Andrea Reichenberger Walther Brand and Marie Deutschbein’s Introduction to the Philosophical Foundations of Mathematics (1929): A Book for Teaching Practice? Tilman Sauer & Gabriel Klaedtke Eine Leibnizsche Identität Siegener Beiträge zur Geschichte und Philosophie der Mathematik Shafie Shokrani & Susanne Spies „Feeling the essence of mathematics“ – Sokratische Gespräche im Mathematischen Haus in Isfahan Klaus Volkert Mathematische Modelle und die polytechnische Tradition Mit Beiträgen von Matthias Wille Bd 10 (2018) • E. Kanterian | K. Kuhlemann | ›so müssen sie auch geschehen können‹ – Über die philosophischen Sinnbedingungen deontologischer SieB A. Reichenberger | T. Sauer & G. Klaedtke | Modellbildung S. Shokrani & S. Spies | K. Volkert | M. Wille ISSN 2197-5590 Ralf Krömer, Gregor Nickel (Hrsg.) SieB Siegener Beiträge zur Geschichte und Philosophie der Mathematik Band 10 (2018) Mit Beiträgen von: E. Kanterian | K. Kuhlemann | A. Reichenberger | T. Sauer & G. Klaedtke S. Shokrani & S. Spies | K. Volkert | M. Wille Ralf Krömer Gregor Nickel Fachgruppe Mathematik Departement Mathematik Bergische -

SUCCESS in Der Praxis Komplexitätscontrolling "Corporate Planner Finance – Auch Ein Teil Von Uns." *
2013 Nov./Dez. I Ausgabe 6 I www.controllermagazin.de Zugleich Mitgliederzeitschrift des Internationalen Controller Vereins B 12688 I 38. Jg I EUR 27,80 I ISSN 1616-0495 und der Risk Management Association e.V. CONTROLLER® Arbeitsergebnisse aus der Controller-Praxis Life Cycle Costing Jahresabschlusszeiten Business Continuity Werkzeugkosten Themen im Focus Green Controlling SUCCESS in der Praxis Komplexitätscontrolling "Corporate Planner Finance – auch ein Teil von uns." * Corporate Planner Finance – Die Softwarelösung für Integrierte Finanzplanung. Corporate Planning hat gemeinsam mit Controllern mittelständischer Unternehmen eine einzigartige Software entwickelt, die operatives Controlling, Integrierte Finanzplanung und Konsolidierung vereint. Das Ergebnis: Praxiserprobt. Einfach. Überzeugend. www.cp-fi nance.de *Oben links nach rechts: Thomas Krützfeldt (Kaufmännischer Leiter und Prokurist, Gübau Speditions- und Logistikgruppe), Andree Bauer (Controller, BMV Mineralölgesellschaft mbH), Eduard Siekendieck (Leiter Controlling, Gustav Wolf Seil- und Drahtwerke GmbH & Co. KG), Heiko Niendorf (Mitarbeiter Controlling, PRO Klinik Holding GmbH). Vorne links nach rechts: Reiko Weber (Controller, VIA Verbund für Integrative Angebote Berlin gemeinnützige GmbH), Manuela Orlandini (Steuerfachwirtin, BMV Mineralölgesellschaft mbH), Bernd Heesch (Prokurist und kaufmännischer Leiter, normpack GmbH directmail engineers), Michael Kühl (Mitarbeiter Controlling, PRO Klinik Holding GmbH). CM November / Dezember 2013 Editorial Sehr geehrte Leserin, sehr -

Langzeitprognose Der Straßenerhaltung
REALITÄTSNAHE LANGFRISTPROGNOSE UND ERHALTUNGSSTRATEGIEN VON BUNDESFERNSTRASSEN BESCHREIBUNG DER METHODIK Ingenieurbüro ASTRA GmbH, Rennbahnallee 110, 15366 Dahlwitz-Hoppegarten T. Huber, MBA; Dipl.Ing. St. Klinghammer ; Dr. M. Nagel Zusammenfassung Zusammenfassung In diesem Bericht werden die methodischen Grundlagen einer realitätsnahen Langfristprognose der Straßenerhaltung vorgestellt. Planerisch ist die Langfristprognose zwischen der kurzfristigen Maßnahmenrei- hung eines Pavement-Management-Systems und den globalen Schätzungen der Makroökonomen anzusiedeln. Das hier vorgestellte Instrumentarium ermöglicht dem Planer, strategische Optionen zu testen und diese auf transparente Weise zu vergleichen und zu bewerten. Langfristprognose auf Simulationsbasis Das verwendete Modell trennt die Prognosefunktion in eine passive (Verbrauch durch den Verkehr) und eine aktive (Maßnahmen des Straßenerhalters) Kompo- nente. Der passive Verbrauch wird durch die Alterungsfunktionen beschrieben und als stochastischer Prozeß simuliert. Das Alterungsverhalten des Netzes kann durch den Erhalter mittels Maßnahmen indirekt, aber aktiv beeinflußt werden. Da diese Maßnahmen das Netz verändern, wird sich die Prognose je nach Verhaltens- weise (Erhaltungsstrategie) in eine andere Richtung entwickeln. Um diesem dyna- mischen Verhalten gerecht zu werden, baut die Langfristprognose auf Simulationen mit Einjahreszyklen auf. Alterungsfunktionen auf Wahrscheinlichkeitsbasis Die Alterungsfunktionen werden aufgrund der Zustandsmessungen und der kumu- lativen Verkehrsbelastung -

Die Direkte Bestimmung Der Massgebenden Gleitfläche Und Des Minimalen Gleitsicherheitsfaktors Homogener Und Inhomogener Böschungen
Research Collection Doctoral Thesis Die direkte Bestimmung der massgebenden Gleitfläche und des minimalen Gleitsicherheitsfaktors homogener und inhomogener Böschungen Author(s): Gerber, Fritz Peter Publication Date: 1965 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-000091968 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Prom. Nr. 3622 Die direkte Bestimmung der maßgebenden Gleitfläche und des minimalen Gleitsicher¬ heitsfaktors homogener und inhomogener Böschungen VON DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN ZÜRICH ZUR ERLANGUNG DER WÜRDE EINES DOKTORS DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN GENEHMIGTE PROMOTIONSARBEIT VORGELEGT VON FRITZ PETER GERBER dipl. Bauingenieur ETH von Langnau i. E. Referent: Herr Prof. G. Schnitter Korreferent: Herr Prof. Dr. P. Läuchli 1965 Zürich Ed. Truninger VORWORT In der vorliegenden Arbeit wird eine Methode zur mathematischen Be¬ stimmung der massgebenden Gleitfläche und damit des minimalen Gleitsicher¬ heitsfaktors beliebiger Böschungen entwickelt. Die praktische Anwendung des Verfahrens, welche erst meine Untersuchungen sinnvoll macht, soll da¬ bei durch das gegebene ALGOL - Programm erleichtert werden. Es ist mir ein Bedürfnis an dieser Stelle allen die direkt oder indi¬ rekt zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Der Ausdruck meiner tiefsten Verbundenheit gilt vorab Herrn Prof. G. Schnitter -

Inaugural-Dissertation
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde¨ der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Gesamtfakult¨at der Ruprecht-Karls-Universit¨at Heidelberg vorgelegt von Dipl.-Phys. Timo Friedhelm Bergmann aus Kassel Tag der mundlichen¨ Prufung:¨ 19.07.2006 Theorie des longitudinalen Atomstrahl-Spinechos und parit¨atsverletzende Berry-Phasen in Atomen Gutachter: Prof. Dr. Otto Nachtmann Priv.-Doz. Maarten DeKieviet, PhD. Theorie des longitudinalen Atomstrahl-Spinechos und parit¨atsverletzende Berry- Phasen in Atomen In dieser Arbeit entwickeln wir eine nichtrelativistische Theorie zur quantenmechanischen Beschreibung longitudinaler Atomstrahl-Spinecho-Experimente, bei denen ein Strahl neutraler Atome eine Anordnung statischer elektrischer und magnetischer Felder durchquert. Der Ge- samtzustand des Atoms ist die L¨osung der Schr¨odinger-Gleichung mit matrixwertigem Potential und kann als Superposition lokaler (atomarer) Eigenzust¨ande der Potentialmatrix geschrieben werden. Die orts- und zeitabh¨angigen Amplitudenfunktionen jedes Eigenzustands repr¨asentieren die atomaren Wellenpakete und k¨onnen mit der von uns aufgestellten Master-Formel in einer Reihenentwicklung berechnet werden. Die nullte Ordnung dieser Reihenentwicklung beschreibt den adiabatischen Grenzfall, in h¨oheren Ordnungen werden Mischungen der Zust¨ande und der zugeordneten Amplitudenfunktionen berucksichtigt.¨ Wir geben eine Anleitung zur theoretischen Beschreibung eines longitudinalen Atomstrahl-Spinecho-Experiments und des sogenannten Fahr- planmodells an, bei dem die -

2018: Against Worldbuilding Fight the Snob Art of the Social Climbers!
2018: Against Worldbuilding Fight The Snob Art of the Social Climbers! tinymixtapes.com/features/2018-against-worldbuilding By Nick James Scavo · December 13, 2018 Tweet Tech evangelist Robert Scoble taking a shower while wearing now-defunct Google Glass. We celebrate the end of the year the only way we know how: through lists, essays, and mixes. Join us as we explore the music that helped define the year. More from this series In 2018, do we laud our creations enough to call them worlds? As we turn the knob of a Breville BOV650XL toaster oven and scrape strawberry jam over the 1,000 nooks and crannies of an english muffin, are we vain enough to proclaim a new world? Our special individuality suggests that our world is made up of billions of particular worlds. Our bizarre social ingenuity demonstrates that there is a world-network that compartmentalizes, associates, and connects them. All the while, there is an infinite amount of quantum worlds swirling in microcosm beneath the starry sky of an equally infinite macrocosm. Within this reflected infinity, exactly which worlds did we build? Or are we merely at war with an existing world in an effort to proclaim a more profound one — one distinctly of our making? Must we devour the multiplicity of worlds to build even one solitary one? Are we worldeaters or worldbuilders? 1/19 We look up from our world, the planet Earth, and our curiosity bores into the expanse of non- living worlds circling around us. Yet, even our centuries of research and recent astronautics can’t seem to reveal a single discovery other than a plentitude of dead worlds. -

Informatik 1, WS 2019/20 Universität Tübingen
Informatik 1, WS 2019/20 Universität Tübingen Prof. Dr. Klaus Ostermann February 11, 2020 mit Beiträgen von Jonathan Brachthäuser, Yufei Cai, Yi Dai und Tillmann Rendel Große Teile dieses Skripts basieren auf dem Buch "How To Design Programs" von M. Felleisen, R.B. Findler, M. Flatt und S. Krishnamurthi. 1 Contents 1 Programmieren mit Ausdrücken 7 1.1 Programmieren mit arithmetischen Ausdrücken . 7 1.2 Arithmetik mit nicht-numerischen Werten . 9 1.3 Auftreten und Umgang mit Fehlern . 14 1.4 Kommentare . 15 1.5 Bedeutung von BSL Ausdrücken . 16 2 Programmierer entwerfen Sprachen! 20 2.1 Funktionsdefinitionen . 20 2.2 Funktionen die Bilder produzieren . 21 2.3 Bedeutung von Funktionsdefinitionen . 23 2.4 Konditionale Ausdrücke . 24 2.4.1 Motivation . 24 2.4.2 Bedeutung konditionaler Ausdrücke . 25 2.4.3 Beispiel . 26 2.4.4 Etwas syntaktischer Zucker... 26 2.4.5 Auswertung konditionaler Ausdrücke . 28 2.4.6 In der Kürze liegt die Würze . 29 2.5 Definition von Konstanten . 30 2.6 DRY: Don’t Repeat Yourself! . 30 2.6.1 DRY durch Konstantendefinitionen . 31 2.6.2 DRY Redux . 33 2.7 Bedeutung von Funktions- und Konstantendefinitionen . 34 2.8 Programmieren ist mehr als das Regelverstehen! . 36 3 Systematischer Programmentwurf 37 3.1 Funktionale Dekomposition . 37 3.2 Vom Problem zum Programm . 39 3.3 Systematischer Entwurf mit Entwurfsrezepten . 40 3.3.1 Testen . 41 3.3.2 Informationen und Daten . 42 3.3.3 Entwurfsrezept zur Funktionsdefinition . 44 3.3.4 Programme mit vielen Funktionen . 48 3.4 Information Hiding . 49 4 Batchprogramme und interaktive Programme 51 4.1 Batchprogramme . -
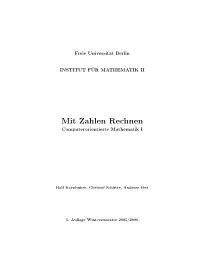
Mit Zahlen Rechnen Computerorientierte Mathematik I
Freie Universit¨at Berlin INSTITUT FUR¨ MATHEMATIK II Mit Zahlen Rechnen Computerorientierte Mathematik I Ralf Kornhuber, Christof Schutte,¨ Andreas Fest 5. Auflage Wintersemester 2005/2006 Stefan Geschke hat wertvolle Literaturhinweise gegeben. Sabrina Nordt hat zwei Bilder bei- gesteuert. Ralf Forster, Carsten Gr¨aser, Maren Hofmann, Katrin Hornburg, Justyna Ko- marnicki, Eike Sommer, Bernhard Streit haben sorgf¨altig Korrektur gelesen und viele gute Ratschl¨age gegeben. Vielen Dank! INHALTSVERZEICHNIS I Inhaltsverzeichnis I Kondition und Stabilit¨at 1 1 Zahlendarstellung und Rundungsfehler 1 1.1 Naturliche¨ Zahlen . 1 1.1.1 Rechnen und Ausrechnen . 1 1.1.2 Ziffernsysteme. 2 1.1.3 Positionssysteme. 2 1.1.4 Dualdarstellung . 4 1.1.5 Praktische Realisierung . 5 1.2 Ganze Zahlen . 7 1.2.1 Konstruktion durch Abschluß von N unter Subtraktion . 7 1.2.2 Zifferndarstellung . 8 1.2.3 Praktische Realisierung . 8 1.3 Rationale Zahlen . 12 1.3.1 Konstruktion durch Abschluß von Z unter Division . 12 1.3.2 Zifferndarstellung . 13 1.3.3 Dezimal- und Dualbruche¨ . 13 1.3.4 Praktische Realisierung . 14 1.4 Reelle Zahlen . 15 1.4.1 Konstruktion durch Vervollst¨andigung von Q . 15 1.4.2 Abz¨ahlbarkeit und Zifferndarstellung . 17 1.4.3 Absoluter und relativer Fehler . 20 1.4.4 Gleitkommazahlen und Rundungsfehler . 20 1.4.5 Praktische Realisierung . 25 2 Gleitkommaarithmetik 29 2.1 Kondition der Grundrechenarten . 29 2.2 Algebraische Eigenschaften . 32 2.3 Gleichheitsabfragen . 33 2.4 Stabilit¨at von Summationsalgorithmen . 35 2.5 Praktische Realisierung . 40 3 Funktionsauswertungen 40 3.1 Einlochen auf ebenem und unebenem Grun¨ . -
GIS-Gestützte Beckenanalyse Am Beispiel Des Französischen Juragebirges
GIS-gestützte Beckenanalyse am Beispiel des Französischen Juragebirges Christian Strobl 2007 1. Gutachter: Prof. Dr. Bernd Lammerer 2. Gutachter: Prof. Dr. Wladyslaw Altermann Tag der mündlichen Prüfung: 22.02.2007 GIS-gestützte Beckenanalyse am Beispiel des Französischen Juragebirges Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften an der Fakultät für Geowissenschaften der Ludwigs-Maximilians-Universität München vorgelegt von Christian Strobl München 2007 Scau ma moi. (Franz Beckenbauer, an der wende zum dritten iahrtausend) Vorwort Die vorliegende Arbeit entstand am Departement für Geo- und Umweltwissenschaften der Lud- wigs-Maximilians-Universität München auf Anregung von Prof. Bernd Lammerer, dem ich an die- ser Stelle für die wissenschaftliche Unterstützung, die unkomplizierte Zusammenarbeit und die freundschaftliche Hilfe in vielfacher Hinsicht herzlichst danken möchte. Darüber hinaus gilt mein Dank allen, die mir bei Fertigstellung dieser Arbeit geholfen haben. Insbe- sondere möchte ich mich bedanken bei: Der Studienstiftung des Deutschen Volkes für die finanzielle Unterstützung dieser Arbeit. Der Firma Petroconsultants SA in Genf für die Bereitstellung der GEOREX-Microfiches und den Daten aus der hauseigenen Bohrlochdatenbank. Der Familie Drevermann für die freundliche Aufnahme bei unseren Genfer Aufenthalten. Der DHYCA (Direction des Hydrocarbures) in Paris für die Bereitstellung der Bohrproben. Der BGR (Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe), insbesondere K. Kuckelkorn, J. Koch und H. Wehner, für die Hilfe bei der Durchführung der geochemischen Untersuchungen. Prof. Valerian Bachtadse für die Rekonstruktion der paläogeographischen Breitenlagen. Beate Sommer und Heide Felske für jahrelange literarische und kartographische Hilfe. Des weiteren bei meinen Freunden und Kollegen, v.a. Oliver Krieger, Martin Drevermann und Pe- ter Blume, die unterschiedlich lange das gleiche Schicksal mit mir ertrugen.