Drucksache 18/5373
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Congressional Taskforce on Terrorism and Unconventional Warfare
CONGRESSIONAL TASKFORCE ON TERRORISM AND UNCONVENTIONAL WARFARE Parliamentary Intelligence-Security Forum September 17 - 19 Washington, DC 2014 Annual Report PARLIAMENTARY INTELLIGENCE SECURITY FORUM 2014 Annual Report The Need for Dialogue As Chairman of the Congressional Taskforce on Terrorism and Unconventional Warfare, I spent many hours discussing the issues of national security and intelligence policy – with colleagues in Congress, security experts, and with foreign diplomats. These conversations all revealed a similar undertone, the need for further dialogue. While in Vienna in December, 2013, I met with Members of the Austrian Parliament who made clear their desire to engage in these discussions with their American counterparts. In June 2014, a delegation of five Austrian Parliamentarians visited Washington, D.C. to do just that. An afternoon of meaningful dialogue ignited the need for a greater, more inclusive forum with European allies in the fight against global terrorism. To this end, we hosted the first Parliamentary Intelligence-Security Forum at the Library of Congress in Washington, D.C. where diplomats from 28 countries spent three days discussing the needs, concerns and realities regarding U.S. – European intelligence efforts. With deep gratitude and respect, we honor the important work of Chairman Mike Rogers with his leadership of the House Permanent Select Committee on Intelligence. Chairman Rogers provided me the opportunity to initiate and lead this Forum with our European allies. His thoughtful analysis of intelligence -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Juni 2014 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4 Entschließungsantrag der Abgeordneten Caren Lay, Eva Bulling-Schröter, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts - Drucksachen 18/1304, 18/1573, 18/1891 und 18/1901 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 575 Nicht abgegebene Stimmen: 56 Ja-Stimmen: 109 Nein-Stimmen: 465 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 27.06.2014 Beginn: 10:58 Ende: 11:01 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Julia Bartz X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

Plenarprotokoll 18/240
Plenarprotokoll 18/240 Deutscher Bundestag Stenografscher Bericht 240. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 22. Juni 2017 Inhalt: Gedenken an Bundeskanzler a. D. Dr. Helmut Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/ Kohl DIE GRÜNEN) ...................... 24489 A Präsident Dr. Norbert Lammert ........... 24479 A Hermann Gröhe, Bundesminister BMG ..... 24491 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Harald Weinberg (DIE LINKE) ........... 24493 A nung. 24530 D Dr. Karl Lauterbach (SPD) ............... 24493 D Absetzung der Tagesordnungspunkte 13, 14 c, 14 d und 15 b. 24484 A Nadine Schön (St. Wendel) (CDU/CSU) .... 24495 A Mechthild Rawert (SPD). 24496 B Zur Geschäftsordnung ................. 24484 B Erich Irlstorfer (CDU/CSU) .............. 24497 A Petra Crone (SPD) ...................... 24498 A Tagesordnungspunkt 7: a) – Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Ent- Tagesordnungspunkt 8: wurfs eines Gesetzes zur Reform der a) Unterrichtung durch die Bundesregie- Pfegeberufe (Pfegeberufereformge- rung: Bericht zur Umsetzung der High- setz – PfBRefG) tech-Strategie – Fortschritt durch For- Drucksachen 18/7823, 18/12847 ..... 24484 C schung und Innovation – Stellungnahme – Bericht des Haushaltsausschusses ge- der Bundesregierung zum Gutachten mäß § 96 der Geschäftsordnung zu Forschung, Innovation und techno- logischer Leistungsfähigkeit Deutsch- Drucksache 18/12848 ............. 24484 C lands 2017 b) Beschlussempfehlung und Bericht des Drucksache 18/11810 ................ 24499 C Ausschusses für Gesundheit zu dem Antrag -

Plenarprotokoll 18/155
Textrahmenoptionen: 16 mm Abstand oben Plenarprotokoll 18/155 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 155. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 18. Februar 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/ neten Dr. Ernst Dieter Rossmann, Bernhard DIE GRÜNEN) ................... 15214 A Schulte-Drüggelte, Dr. Karl Lamers und Christian Petry (SPD) .................. 15215 B Alois Gerig .......................... 15201 A Dr. Frank Steffel (CDU/CSU) ............ 15216 D Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- nung. 15201 B Absetzung der Tagesordnungspunkte 5 und Zusatztagesordnungspunkt 2: 14. 15201 D Antrag der Abgeordneten Monika Lazar, Luise Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 15202 A Amtsberg, Volker Beck (Köln), weiterer Abge- ordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Demokratie stärken – Dem Hass Tagesordnungspunkt 4: keine Chance geben Drucksache 18/7553 ................... 15218 B Erste Beratung des von der Bundesregie- rung eingebrachten Entwurfs eines Ersten Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/ Gesetzes zur Novellierung von Finanz- DIE GRÜNEN) ..................... 15218 B marktvorschriften auf Grund europäischer Marian Wendt (CDU/CSU) .............. 15219 D Rechtsakte (Erstes Finanzmarktnovellie- rungsgesetz – 1. FiMaNoG) Katja Kipping (DIE LINKE) ............ 15221 D Drucksache 18/7482 ................... 15202 C Uli Grötsch (SPD) ..................... 15223 C Dr. Michael Meister, Parl. Staatssekretär Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU) ........... 15224 D BMF ............................ -

Plenarprotokoll 19/229
Plenarprotokoll 19/229 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 229. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. Mai 2021 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Stefan Keuter (AfD) . 29247 C nung . 29225 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 C Absetzung der Tagesordnungspunkte 8, 9, 10, Stefan Keuter (AfD) . 29247 D 16 b, 16 e, 21 b, 33, 36 und 39 . 29230 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 D Ausschussüberweisungen . 29230 D Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 A Feststellung der Tagesordnung . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 B Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 C Zusatzpunkt 1: Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 C Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktio- Christian Dürr (FDP) . 29248 D nen der CDU/CSU und SPD zu den Raketen- angriffen auf Israel und der damit verbun- Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 A denen Eskalation der Gewalt Christian Dürr (FDP) . 29249 B Heiko Maas, Bundesminister AA . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 C Armin-Paulus Hampel (AfD) . 29233 C Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) . 29250 A Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU) . 29234 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 A Alexander Graf Lambsdorff (FDP) . 29235 C Dorothee Martin (SPD) . 29250 B Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) . 29236 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 B Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/ Dorothee Martin (SPD) . 29250 C DIE GRÜNEN) . 29237 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 D Dirk Wiese (SPD) . 29238 C Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 29250 D Dr. Anton Friesen (AfD) . 29239 D Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29251 A Jürgen Hardt (CDU/CSU) . 29240 B Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) . 29251 C Kerstin Griese (SPD) . -

Resultate Auswerten
DJV-NRW Bundestagskandat:innen-Check: Medienpolitische Forderungen und Ziele zur Bundestagswahl 2021 1. Zu Ihrer Person * Anzahl Teilnehmer: 39 1. Spalte Vor- und Nachname - Bärbel Bas - Michaela Engelmeier - Dr. Ulrich Kros - Axel Echeverria - Aaron Spielmanns - Stefan Schwartze - Elvan Korkmaz-Emre - Nadine Heselhaus - Bärbel Bas - Achim Post - Mahmut Özdemir - Andreas, Rimkus - Jan Dieren - Dirk Wiese - Ye-One Rhie - Michael Thews - Brian Nickholz - Ye-One Rhie - Sabine Poschmann - Bettina Lugk - Mahmut Özdemir - Bärbel Bas - Gülistan Yüksel - Zanda Martens - Marion Sollbach - Christian Steinacker - Michael Thews - Michael Gerdes - Dirk Vöpel - Bernhard Daldrup - Sarah Lahrkamp - Timo Schisanowski - Johannes Waldmann - Test Test - Achim Post - Sebastian Fiedler - Udo Schiefner - Markus Töns - Michelle Müntefering Partei - SPD - SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD - SPD Wahlkreis Nr. (Falls Sie keinen Wahlkreis haben, bitte "Landesliste" - 115 eintragen.) - 99 - 136 - 139 - 091 - 133 - 131 - 126 - Borken II - 115 - Minden - 116 - Wahlkreis 107: Düsseldorf II - 114 - 147 - 87 - 145 - 122 - 87 - 143 - 150 - 116 - Wahlkreis115: Duisburg I - 109 - 106 - 094 - 104 - 145 - 125 - 117 - Warendorf 130 - 124 - 138 - 127 - 101 - 134 - 118 - 111 - 123 - 141 2. 1. GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN UND BEZAHLUNG DURCH TARIFBINDUNG? Guter Journalismus ist auf gute Journalist:innen angewiesen. Deshalb muss der Beruf attraktiv bleiben mit guten Arbeitsbedingungen und fairer Bezahlung. Tarifverträge sichern beides. Deshalb ist die Tarifbindung für Medienbetriebe unverzichtbar. * Anzahl Teilnehmer: 34 31 (91.2%): Ich stimme zu. neutral: 8.82% 3 (8.8%): neutral - (0.0%): Ich stimme nicht zu. -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 228. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 7. Mai 2021 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Änderungsantrag der Abgeordneten Christian Kühn (Tübingen), Daniela Wagner, Britta Haßelmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Drs. 19/24838, 19/26023, 19/29396 und 19/29409 Entwurf eines Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) Abgegebene Stimmen insgesamt: 611 Nicht abgegebene Stimmen: 98 Ja-Stimmen: 114 Nein-Stimmen: 431 Enthaltungen: 66 Ungültige: 0 Berlin, den 07.05.2021 Beginn: 12:25 Ende: 12:57 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Dr. Michael von Abercron X Stephan Albani X Norbert Maria Altenkamp X Peter Altmaier X Philipp Amthor X Artur Auernhammer X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Melanie Bernstein X Christoph Bernstiel X Peter Beyer X Marc Biadacz X Steffen Bilger X Peter Bleser X Norbert Brackmann X Michael Brand (Fulda) X Dr. Reinhard Brandl X Dr. Helge Braun X Silvia Breher X Sebastian Brehm X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Dr. Carsten Brodesser X Gitta Connemann X Astrid Damerow X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Thomas Erndl X Dr. Dr. h. c. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Enak Ferlemann X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Thorsten Frei X Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) X Maika Friemann-Jennert X Michael Frieser X Hans-Joachim Fuchtel X Ingo Gädechens X Dr. -
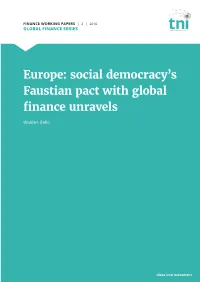
Social Democracy's Faustian Pact with Global
FINANCE WORKING PAPERS | 2 | 2016 GLOBAL FINANCE SERIES Europe: social democracy’s Faustian pact with global finance unravels Walden Bello ideas into movement AUTHOR: Walden Bello EDITOR: Stephanie Ross SERIES: Global Finance: 2/4 Published by Transnational Institute – www.TNI.org Contents of the report may be quoted or reproduced for non-commercial purposes, provided that the source of information is properly cited. TNI would appreciate receiving a copy or link of the text in which this document is used or cited. Please note that for some images the copyright may lie elsewhere and copyright conditions of those images should be based on the copyright terms of the original source. http://www.tni.org/copyright ACKNOWLEDGEMENTS The author would like to express his deep gratitude to Professor Caroline Hau of CSEAS and to Fiona Dove, Pietje Vervest, Brid Brennan, Satoko Kishimoto and Nick Buxton of TNI for facilitating this study. The global financial crisis, in the aftermath of which the world is still mired, erupted in Wall Street but it could very well have begun in Europe. For, as in the United States, the financial systems of a number of European countries were teetering on the abyss of collapse, the ingredients of which were financial overextension or high degrees of indebtedness or leveraging, huge holdings of toxic securities like subprime loans by European banks, the rapid inflation of real estate and stock market bubbles, and lax or virtual absence of regulation of the financial sector. There were, however, certain aspects of the European scene that made the evolution of the financial crisis uniquely devastating, and the most important of this was the adoption, by 2008, of the euro as a common currency by 15 countries in the European Union. -

Master Thesis International Relations - European Union Studies
A FRONT ROW MULTILATERALIST On German parliamentary justifications for a more assertive defence policy Master thesis International Relations - European Union Studies By Jonathan Provoost - s1446185 Supervisor: Dr. M.E.L. David 3 July 2020 Word count: 16136 List of parliamentarians Tobias Pflüger (The Left) Nils Annen (SPD) Eckhard Pols (CDU) Franziska Brandtner (The Greens) Achim Post (SPD) Daniela De Ridder (SPD) Norbert Röttgen (CDU) Marcus Faber (CDU) Karin Stenz (CDU) Fritz Felgentreu (SPD) Thorsten Frei (CDU) List of abbreviations Ingo Gädechens (CDU) AfD Alternative for Germany Wolfgang Gehrcke (The Left) CDU Christian Democratic Union Florian Hahn (CSU) CSU Christian Social Union Heike Hänsel (The Left) CSDP Common Security and Defence Policy Jürgen Hardt (CDU) EDF European Defence Fund Mark Hauptmann (CDU) EEAS European Union External Action Service Martin Hebner (AfD) eFP Enhanced Forward Presence Wolfgang Hellmich (SPD) ESDP European Security and Defence Policy Thomas Hitschler (SPD) EU European Union Alois Karl (CSU) EUGS European Union Global Strategy Roderick Kiesewetter (CDU) FDP Free Democratic Party Günther Krichbaum (CDU) GDR German Democratic Republic Alexander Graf Lambsdorff (FDP) FRG Federal Republic of Germany Karl Lamers (CDU) NATO North Atlantic Treaty Organization Stefan Liebich (The Left) PESCO Permanent Structured Cooperation on Defence Wilfried Lorenz (CDU) QCA Qualitative Content Analysis Rüdiger Lucassen (AfD) SDP Social Democratic Party Elisabeth Motschmann (CDU) US United States (of America) Alexander Neu -

The Ashgate Research Companion to Imperial Germany ASHGATE RESEARCH COMPANION
ASHGATE RESEARCH COMPANION THE ASHGatE RESEarCH COMPANION TO IMPERIAL GERMANY ASHGATE RESEARCH COMPANION The Ashgate Research Companions are designed to offer scholars and graduate students a comprehensive and authoritative state-of-the-art review of current research in a particular area. The companions’ editors bring together a team of respected and experienced experts to write chapters on the key issues in their speciality, providing a comprehensive reference to the field. The Ashgate Research Companion to Imperial Germany Edited by MattHEW JEFFERIES University of Manchester, UK © Matthew Jefferies 2015 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher. Matthew Jefferies has asserted his right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as the editor of this work. Published by Ashgate Publishing Limited Ashgate Publishing Company Wey Court East 110 Cherry Street Union Road Suite 3-1 Farnham Burlington, VT 05401-3818 Surrey, GU9 7PT USA England www.ashgate.com British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The Ashgate research companion to Imperial Germany / edited by Matthew Jefferies. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-4094-3551-8 (hardcover) – ISBN 978-1-4094-3552-5 -

Magazin Fraktion Direkt November 2016
Das Monatsmagazin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion · November 2016 Startups – Wachstumsmotor für Deutschland Abgeordnete der Unionsfraktion auf #startuptour durch Berlin Landleben hat Zukunft Keine Fraktion bekennt sich so sehr zu den ländlichen Regionen wie die Union © Getty Images Inhalt 3 12 19 22 Der Monat Die Themen Die Bilder Die Zahlen Volker Kauder Startups – Wachstumsmotor für Deutschland 20 23 4 Die Fraktion Der Gast Die Meinung 16 Engagierte Parlamentarier Roland Jahn zur Aufarbeitung Michael Grosse-Brömer Das Gespräch für starke Kommunen – der SED-Diktatur Heribert Hirte zum Thema Die AG Kommunalpolitik 5 Glaubensfreiheit im Portrait 23 Die Fakten Impressum 18 21 6 Die Themen Die Antworten 24 Der Brennpunkt Weniger Flüchtlinge Fragen und Antworten zum Das Zitat Gleiche Chancen für die als angenommen Bundesverkehrswegeplan Menschen auf dem Land 2030 6 Keine andere Bundestagsfraktion kümmert sich so sehr um die wirtschaft- liche Zukunft der ländlichen Regionen wie die CDU/CSU-Fraktion. © Getty Images 12 Startups sind ein Wachstumsmotor für Deutschland. Abgeordnete der Unionsfraktion haben eine Reihe von Gründern innovativer © Getty Images Unternehmen besucht. 18 Die Zahl der Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, nimmt ab. Das zeigt, dass die Maß nahmen zur Begrenzung © Picture Alliance © Picture des Zuzugs wirken. Der Monat 3 Liebe Leserinnen und Leser, zentrales Ziel unserer Politik ist es, die Zu- kunftschancen unseres Landes zu sichern. Deutschland muss it bleiben, um sich weiter im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Unser Wohlstand muss immer wieder neu er- arbeitet werden. Der Erfolg von gestern ist kei- ne Garantie für den Erfolg von morgen. Deutschland muss vor allem die Her- ausforderungen der Digitalisierung meistern. -
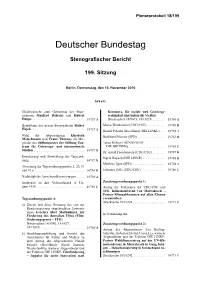
Plenarprotokoll 18/199
Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a)