Die Unterdevonischen Schichten Von Olkenbach
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
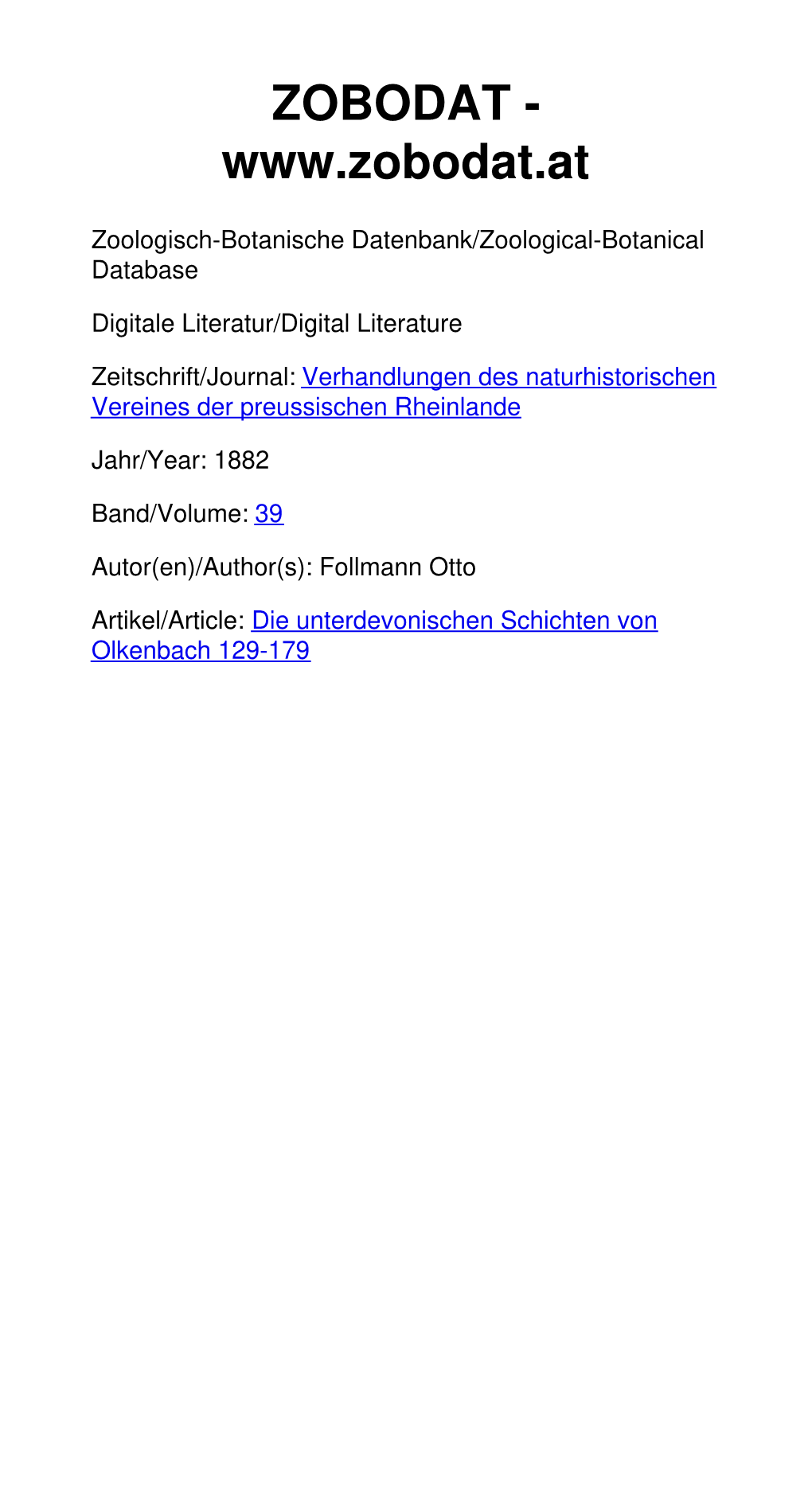
Load more
Recommended publications
-

Funde Und Ausgrabungen Im Bezirk Trier 16, 1984
Die Entersburg bei Hontheim Bei mittelalterlichen Burganlagen treten häufiger auch ältere, römische oder gar vorrömische Siedlungsspuren zutage. Doch nur selten lassen sich, wie im Falle der Entersburg bei Hontheim (Krs. Bemkastel-W ittlich), die Reste mehre rer, zeitlich bis zu sieben Jahrhunderte auseinanderliegender Wehranlagen nach- weisen. Jene haben sich dort nicht zuletzt deshalb erhalten, weil die jeweils jün gere Befestigung nie auf den Mauerresten einer älteren errichtet und der Umfang bzw. die Innenfläche von Mal zu Mal erheblich verkleinert wurde, woraus sich für den Archäologen ein äußerst glücklicher Umstand ergab. Die Entersburg hegt in einem Seitental der Mosel 2 km nordwestlich von Bad Bertrich, noch auf der Gemarkung Hontheim, unmittelbar an der Grenze des Re gierungsbezirkes Trier. Der Platz, ein nahezu unzugänglicher, rund 250 m langer, bis zu 130 m breiter und 60 m hoher Bergsporn bot die idealen Voraussetzungen für eine Wehranlage. Während ihn auf drei Seiten der Üßbach von den angrenzen den Bergen abschnürt, machen an der vierten Seite im Süden, der einzigen Ver bindung mit dem Hontheimer Plateau, ein schmaler, m ehrfach durchbrochener Felsgrat sowie bis zu 35 m hohe Felswände jeden Zugang unmöglich. Obwohl kleinere Untersuchungen schon in der Mitte des letzten Jahrhunderts von Johann Ost durchgeführt wurden, hielt noch Paul Steiner (Trierer Zeitschr. 8, 1938, 137) die Entersburg für ein schönes Beispiel einer mittelalterlichen Dynastenburg und schloß eine römische Besiedlung des Bergspoms ausdrücklich aus. Bei den Grabungen des Rhein. Landesmuseums in den Jahren 1978/79 zeigte sich recht bald, daß die Untersuchungen, die umfangreicheren Raubgra bungen entgegenwirken sollten, über die Gipfelfläche hinaus ausgedehnt werden mußten. -

Kreisnachrichten 25-2020.Indd
Kreisnachrichten Informati onen und öff entliche Bekanntmachungen der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich Ausgabe 25/2020 Kundenorienti ert - Innovati v - Wirtschaft lich Dienstag, 16.06.2020 Merkblatt ruft Geschäft e und Läden zu solidarischem und hilfsbereitem Umgang mit Menschen mit Behinderung auf Menschen mit Behinde- schen mit Hörbehinderungen ter trainiert sind. gibt es umfangreiche Infor- rungen haben ein erhöhtes oder die Einhaltung des Si- Welche Ausnahmen von mati onen auf dem Merkblatt . Diskriminierungsrisiko – das cherheitsabstands für blin- den neuen Maßnahmen und Dieses steht unter www.coro- wird auch in der Corona-Pan- de und sehbehinderte Men- Pfl ichten wegen der Corona- na.bernkastel-witt lich.de zur demie deutlich. Ihnen wer- schen eine Einschränkung Pandemie zulässig sind, dazu Verfügung. den aus Unwissenheit und dar. Darauf müssen wir ge- Sorge vor einem Bußgeld meinsam achten und Dis- das Betreten eines Geschäft s kriminierung sowie Anfein- oder Ladens verwehrt, weil dungen unterlassen. Inklusiv sie keine Maske tragen oder denken und respektvoll han- den Mindestabstand nicht deln ist besonders wichti g in einhalten können. Die Be- unserem neuen Corona-All- schwerden aufgrund von Dis- tag“, so der Appell des Lan- kriminierung wegen einer Be- desbeauft ragten für die Be- hinderung häufen sich. Daher lange behinderter Menschen haben die Landesanti diskri- Matt hias Rösch. minierungsstelle und der Lan- In Rheinland-Pfalz besteht desbeauft ragte für die Be- seit dem 27. April eine lange behinderter Menschen Pfl icht, etwa im Öff entlichen Rheinland-Pfalz ein Merkblatt Personennahverkehr und veröff entlicht, um Ladeninha- beim Einkaufen, sowie auch berinnen und Ladeninhaber bei Wartesituati onen, eine besser zu informieren. -

Anlage X + Gebietsname
Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Kondelwald und Nebentäler der Mosel Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Kondelwald und Nebentäler der Mosel Blick von den Höhen des Kondelwaldes nach Südosten NSG „Wacholdergebiet bei Demerath“ - 1 - Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Kondelwald und Nebentäler der Mosel Ueßbachtal bei der Demerather Mühle Ueßbach mit niedrigem Wasserstand im Frühjahr - 2 - Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Kondelwald und Nebentäler der Mosel Erdenbachtal bei Lutzerath Naturnaher Erdenbach – Lebensraum der Groppe (Cottus gobio) - 3 - Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Kondelwald und Nebentäler der Mosel Alfbach nordöstlich von Bengel (LRT 3260) Ranunculus fluitans im Alfbach nordöstlich von Bengel - 4 - Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Kondelwald und Nebentäler der Mosel Calluna-Heide zwischen Lutzerath und Strotzbüsch (LRT 4030) Heide am Leitzenbacher Berg südwestlich von Lutzerath (LRT 4030) - 5 - Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Kondelwald und Nebentäler der Mosel Wiesen am Hohlberg nordwestlich Bausendorf (LRT 6510) Wiesen am Hohlberg - 6 - Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Kondelwald und Nebentäler der Mosel Wiesen im Ueßbachtal (LRT 6510) Schachbrettfalter (Melanargia galathea) - 7 - Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Kondelwald und Nebentäler der Mosel Im Frühjahr 2011 umgebrochene Wiesen am Hohlberg (2010 als LRT 6510 kartiert) Aufgegebene Weidefläche bei Filz (2007 als LRT 6510 kartiert) - 8 - Anlage 6 – Gebietsimpressionen -
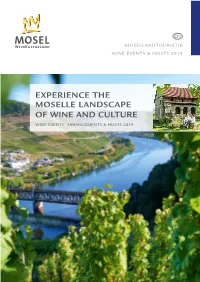
Experience the Moselle Landscape of Wine And
EN MOSELLANDTOURISTIK WINE EVENTS & HOSTS 2019 EXPERIENCE THE MOSELLE LANDSCAPE OF WINE AND CULTURE WINE EVENTS, ARRANGEMENTS & HOSTS 2019 Dear guests and friends of the Moselle region, UNIQUE ORIGINS, we are delighted by your interest in spending your For information on your SEDUCTIVE ENJOYMENT. holiday in our attractive landscape of wine and culture. Moselle vacation contact: This brochure starts off by providing you with a Mosellandtouristik GmbH comprehensive overview of the appealing package Kordelweg 1 · 54470 Bernkastel-Kues offers available for a care-free stay by the Moselle, Saar Telephone +49(0)6531/9733-0 and Ruwer rivers. Thereafter we will introduce our local Fax +49(0)6531/9733-33 hosts, who will gladly spoil you individually with the hospitality that is typical for the Moselle region. [email protected] www. mosellandtouristik.de/en Discover the Moselle region with us – be it on a www.facebook.com/mosellandtouristik short trip or an entire holiday, as a guest in a hotel, a boarding house, in a winery, or in a holiday apartment. Please don’t hesitate to contact us directly if you are Bookinghotline: +49 (0)6531 97330 seeking advice or would like to place a booking. eMail: [email protected] Web: www.mosellandtouristik.de/en, www.facebook.com/Mosellandtouristik Have fun planning your holidays! Your Moselland Tourism EXPERIENCE THE MOSELLE LANDSCAPE OF WINE AND CULTURE Map of the region 4 in the footsteps of the Romans 21 The Mosel – One of the most beautiful Exclusive short trip to the Saarburger Land 22 river landscapes in Europe 6 UNESCO World Heritage treasures in Trier 22 The most beautiful side of country life 8 Discover the city of Trier on the Roman Wine Road 22 Moselle, with body and soul 10 Girls on Tour – Discover. -

Kreisentwicklungs- Konzept
Kreisentwicklungs- konzept Strukturatlas I Präambel Das erste Kreisentwicklungskonzept für den Landkreis Bernkastel-Wittlich wurde 2004 mit den drei Teilen Strukturatlas, Handlungskonzept und Leitbild aufgestellt. Der vorliegende Strukturatlas stellt die IST-Situation des Landkreises Bernkastel-Wittlich im Jahr 2020 dar und wurde aus dem bestehenden Konzept fortgeschrieben und um relevante Themen ergänzt. So ist eine grundlegende Vergleichbarkeit der Konzepte möglich und Veränderungen innerhalb der letzten 15 Jahre lassen sich aufzeigen. Aus Gründen der besseren Darstellbarkeit und Veranschaulichung werden die Themen zusammenfassend dargestellt oder nur in Auszügen präsentiert. Die Formulierungen sollten möglichst verständlich sein und ihre Gültigkeit langfristig behalten. Unschärfen sind dabei unvermeidlich. Weitere detaillierte Ausführungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Fachplanungen werden in den jeweiligen Teilkonzepten ausführlicher beschrieben. Grundlage der Tabellen, Grafiken und Karten sind eigene Erhebungen der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich und veröffentlichte statistische Daten. Die Aufbereitung erfolgte durch den Fachbereich 06 Kreisentwicklung. Da die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ständiger Veränderung unterliegen, ist eine regelmäßige Neujustierung erforderlich. Die weltweiten Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, wie die Liberalisierung des Wirtschaftslebens und der Neo-Dirigismus öffentlicher Aufgaben erfordern neue Rahmensetzungen und die Ermittlung von Handlungskorridoren für die öffentliche -

Landschaftsplanung Verbandsgemeinde Wittlich-Land
Landschaftsplanung Verbandsgemeinde Wittlich-Land Teilfortschreibung Windenergie Erläuterungsbericht Februar 2017 Auftraggeber: Verbandsgemeinde Wittlich-Land Kurfürstenstr. 1 54516 WITTLICH Tel. 06571-107-0 Landschaftsarchitekten bdla | Beratende Ingenieure IKRP Geschäftsführer: Bernhard Gillich, Christoph Heckel | HRB 41337 | AG Wittlich Posthof am Kornmarkt | Fleischstraße 56 -60 | 54290 Trier Fon +49 651 / 145 46-0 | fax +49 651 / 145 46-26 | bghplan.com | [email protected] Inhalt INHALT 1 Einführung .............................................................................................................................................................. 1 1.1 Begründung der Teilfortschreibung ................................................................................................... 1 1.2 Gesetzliche und planerische Vorgaben ............................................................................................. 1 1.3 Verhältnis der Landschaftsplanung zum Umweltrecht ................................................................ 2 1.4 Methodik ....................................................................................................................................................... 2 1.5 Momentaner Zustand und absehbare Entwicklungstendenzen .............................................. 3 2 Beurteilung des Zustandes und mögliche Beeinträchtigungen durch die Windenergie .......... 5 2.1 Boden ............................................................................................................................................................ -

Nahverkehrsplan Landkreis Bernkastel-Wittlich Ergänzung/Fortschreibung Vom 05.04.2017: Linienbündelung Im Landkreis Bernkastel-Wittlich
Nahverkehrsplan Landkreis Bernkastel-Wittlich Ergänzung/Fortschreibung vom 05.04.2017: Linienbündelung im Landkreis Bernkastel-Wittlich Der Landkreis Bernkastel-Wittlich, als Aufgabenträger für kreisinterne Verkehre, hat in seiner Sitzung des Kreistages am 05.04.2017 beschlossen, den lokalen Nahverkehrsplan (NVP) des Landkreises Bernkastel-Wittlich um eine Linienbündelung zu ergänzen. Der ZV VRT, als Aufgabenträger für Verkehre, die die Grenzen zwischen Verbandsmitgliedern überschreiten, hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, den regionalen Nahverkehrsplan um eine Linienbündelung im Landkreis Bernkastel-Wittlich zu ergänzen. Die Durchführung eines gemeinsamen Beteiligungsverfahrens nach § 8 (3) Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz erfolgte durch den ZV VRT. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden sorgfältig geprüft und abgewogen und dokumentiert. Erläuterungen zur Linienbündelung Die Bündelung von Linien erfolgt insbesondere zu dem Zweck, eine dauerhafte, kostengünstige Verkehrsbedienung im Sinne eines wirtschaftlichen Ausgleichs zwischen ertragsstarken und ertragsschwachen Linien zu sichern. Hinsichtlich zukünftiger Genehmigungs- und/oder Ausschreibungswettbewerbe definieren Linienbündel zugleich sinnvolle Lose. Im Vorlauf zu Genehmigungs-/Ausschreibungswettbewerben kann die Bündelung von Linien vor "Rosinenpickerei" schützen, bei der sich Verkehrsunternehmen die Konzessionen für rentable Linien sichern, indem sie Angebote abgeben, diese kommerziell - also eigenwirtschaftlich – zu betreiben, während die verbleibenden, weniger -

2. Römerbatl Bertrich Und Seine Aiten Wege
6 von Veith: 2. Römerbatl Bertrich und seine aiten Wege. Hierzu Tafel II. 1) Das schöne Ber tri eher Thal, welches bei Alf in die Mosel mündet, zog durch seine heilkräftigen warmen Quellen schon vor anderthalb Jahrtausenden die römischen Welteroberer zu festen An- siedlungen in diese Gegend. Von den Höhen der vulkanischen Eifel bei Kelberg (527 m über dem Meeresspiegel) durchströmt der rauschende, von Forellen belebte Uessbach sein oft 200 m tief eingeschnittenes, ge wundenes Felsenbett, und bildet bei Bertrich einen Thalkessel von 1000 m Länge, 200 m Sohlbreite, 150 m über der Nordsee, von 200 m hohen Felshängen umschlossen, dessen Palmberg mit seinen immer grünen Buxbaumbüschen das freundliche Wiesenthal gegen die rauhen Nordwinde des Eifelgebirges schützt. Am Fuss des Palmberges, wo sich im Parkwalde zwischen Kur haus und Bonsbeurer Brücke die scharfen Felsvorsprünge des Thaies enger zusammenschliessen, entspringen dem steilen Hange, an des sen Fuss die Beste eines ehemaligen Lavastroms zwischen den Basalt blöcken des Uessbach erkennbar sind, zwei reiche Mineralquellen von 20° Beaumur, 60 m über dem Moselthal bei Alf. Die warmen Quellen sind von mineralischen Salzen gesättigt, welche für Trink- und Badekur im Sinne eines milderen Carlsbader Sprudel vielen Tausenden gichti schen und nervösen Kranken Gesundheit und körperliche Frische Wieder gaben. Die oft überraschende Wirkung dieser Thermen wird durch die milde schöne Luft des Bertricher Thals erhöht, dessen schattige, abwechselnde Spaziergänge zur lieblichen Elfen-Mühle, zum Wiesenthal des Römerkessel, durch die prachtvollen Hochwaldungen der Försterei Bonsbeuren und zu den wunderbaren Kratern führen, während der gegen etwaige Unbilden des Wetters geschützte freundliche Kurgarten mit seinen Promenaden an den dabei gelegenen guten Hotels Pitz, Kle- rings etc. -

Sommer in Der Eifel En Steck Eefel Fer Desch -Die Apfelbaumpatenschaft Apfelbaumpate Werden Und Das Apfeljahr Im Gesundland Vulkaneifel Hautnah Erleben
Heft 3 · 2020 Jahrgang 115 G 2523 seit 1888 Sommer in der Eifel En Steck Eefel fer desch -Die Apfelbaumpatenschaft Apfelbaumpate werden und das Apfeljahr im GesundLand Vulkaneifel hautnah erleben Streuobstwiesen sind ein besonders schützenswertes Ökosystem für viele Tier- und Pflanzenarten und ein wertvoller Bestandteil einer artenreichen Kulturlandschaft. Doch viele Obstsorten werden inzwischen günstig importiert, wodurch Obst aus deutschem Anbau an Bedeutung verliert – und mit ihm auch die Streuobstwiese. Um diese einzigartige Kulturlandschaft zu erhalten, hat das GesundLand Vulkaneifel eine Apfelbaumpatenschaft ins Leben gerufen. Kooperationspartner ist dabei Leo Lenerz vom Eifeler Scheunencafé in Gillenfeld. Als Apfelbaumpate trägt man aktiv zum Erhalt der Streuobstwiesen in der Eifel bei und kann das Apfeljahr hautnah miter- leben. Wer Apfelbaumpate wird, erhält ein personalisiertes Namensschild am Baum, die GPS-Daten seines Baumes sowie ein persönliches Zertifikat über die Patenschaft. Eine 6er-Kiste Apfelsaft, Viez oder Glühviez aus der regionalen Produktion von Leo Lenerz gibt es obendrauf. Als Pate eines Apfelbaums unterstützt man den extensiven Obstanbau – komplett frei von Pestiziden und Düngemitteln – und sichert unzähligen Tieren und Pflanzen ihren Lebensraum im Vulkanland. Innerhalb der Apfelbaumpatenschaft besteht au- ßerdem die Möglichkeit, mit Leo Lenerz am Apfeljahr teilzuhaben und selbst tatkräf- tig mitzuhelfen. Wer ein bisschen Landluft schnuppern möchte, kann beim Frühjahrs- schnitt, bei der Apfelernte und beim Keltern mit anpacken. Die Apfelbaumpatenschaft ist als außergewöhnliches Geschenk für die Liebsten ge- nauso geeignet wie für Naturliebhaber, denen der Erhalt ihrer Umwelt am Herzen liegt. Ein Stück Eifel für zu Hause! Jetzt Apfelbaumpate werden: www.gesundland-vulkaneifel.de/apfelbaumpatenschaft Tel.: +49 (0)6592 951 370 [email protected] 89,- EUR für die ersten zwei Jahre, jedes weitere Jahr 39,- EUR seit 1888 Heft 3 · Juli/Aug./Sep. -

110-/380-Kv-Höchstspannungsleitung Punkt Metternich - Niederstedem, Bl
ANLAGE 14.11.6 110-/380-kV-Höchstspannungsleitung Punkt Metternich - Niederstedem, Bl. 4225 im Abschnitt Punkt Pillig bis Umspannanlage Wengerohr FFH-Verträglichkeitsstudie für das Gebiet Natura 2000-Gebiet "Wälder zwischen Wittlich und Cochem" (DE-5908-401) FFH-Verträglichkeitsstudie für das Gebiet Natura 2000-Gebiet "Wälder zwischen Wittlich und Cochem" (DE-5908-401) für den Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsleitung Punkt (Pkt.) Metternich - Niederstedem, Bauleitnummer (Bl.) 4225, für den Abschnitt zwi- schen dem Pkt. Pillig und der Umspannanlage (UA) Wengerohr, 2. Genehmigungsabschnitt (2. GA) Auftraggeber : Amprion GmbH Abt. A-AF Rheinlanddamm 24 44139 DORTMUND Auftragnehmer: Bearbeitung: P. Aubry I. Groten N. Rath _________________________________________________________________________ Aufgestellt im Januar 2019 II ANLAGE 14.11.6 : FFH-VERTRÄGLICHKEITSSTUDIE Inhaltsverzeichnis 1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG .......................................................................................... 1 1.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN ......................................................................................................... 2 1.2 ARBEITSMETHODE ............................................................................................................................ 2 2 ÜBERSICHT ÜBER DAS SCHUTZGEBIET UND DIE FÜR DIE ERHALTUNGSZIELE MAßGEBLICHEN BESTANDTEILE ...................................................... 3 2.1 ÜBERSICHT ÜBER DAS SCHUTZGEBIET ...................................................................................... -

Wandern Auf Dem MOSELSTEIG
MOSELSTEIG Wandern auf dem mOSeLSTeIG de eIn W G, mehr zu erLeben. Wandererlebnisse, arrangements, Gastgeber 2016 Wandererlebnis im 1 Eine Landschaft voller Höhepunkte. Was lag näher, als sie zu verbinden? Eigentlich war die Idee ja ganz naheliegend: Da gab es die Mosel, eingebettet in eine der schönsten Kulturlandschaften Europas. Es gab unzählige Zeit- zeugen aus einer mehr als 2000-jährigen Geschichte; dazu Wälder und Wein- berge, wunderbare Ortschaften und natürlich den weltberühmten Wein. Und es gibt immer mehr Menschen, die Freude an erlebnisreichem Wandern haben. Wir haben einen besonders reizvollen Weg gefunden, dies alles mit- einander zu verbinden: Willkommen auf dem moselsteig! INHALTSVERZEICHNIS Übersichtskarte 4-5 Der Moselsteig im Portrait 6-13 Wanderführer und Karten 14 Bequem mit Bus und Bahn erreichbar 15 Die Etappen im Überblick 18-35 Seitensprünge & Traumpfade 36-51 Wander-Arrangements 52-63 Gastgeberverzeichnis 64-76 Reiseanmeldung 77 Reisebedingungen für Pauschalangebote 78 Mehr Mosel? Mehr Erlebnis! 79 2 3 RHEIN Koberner Burgpfad MOSELSTEIG RHEIN MOSEL Schwalberstieg Pyrmonter Bleidenberger Ausblicke MOSELSTEIG Felsensteig Hatzenporter Laysteig Eltzer Burgpanorama Auf 365 kilometern durchs Bergschluchtenpfad Ehrenburg mosel WeinkulturlAnd. Borjer Ortsbachpädche MOSEL MOSELSTEIG Cochemer Ritterrunde Die 24 Etappen im Überblick: Etappe 1: Perl – Palzem, 24 km Etappe 2: Palzem – Nittel, 16,5 km Etappe 3: 22,5 km Nittel – Konz, Felsen. Fässer. Fachwerk. Etappe 4: Konz – Trier, 21 km Etappe 5: Trier – Schweich, 19,5 km -

Leisure and Adventure
PERL-NENNIG 9 KulturGießerei 19 St Paulin 29 Stadtmuseum LONGUICH NEUMAGEN-DHRON 56 Roman Villa ERDEN ZELL (MOSEL) NEEF ROES 99 Kurfürstliches Saarburg The St Paulin parish Simeonstift The Roman villa of Schloss 1 Roman Mosaic The Mabilon bell church is renowned The town museum 38 Villa Urbana 47 Townscapes Wittlich was built 64 Wine press 73 Townscapes 82 Eulenköpfchen 91 Burg Pyrmont Elector Clemens Wen- Measuring ca. 160 foundry was ope- far beyond the city presents around 900 The vineyards of and village scenery between 150 and 200 Partly reconstructed and village scenery with Peterskapelle Burg Pyrmont (first zeslaus had the square metres, this rated as a family limits for its glorious objects: precious Longuich feature a Germany‘s oldest AD and inhabited Roman wine-pressing Home of the famous The Petersberg moun- documented in 1225) palace built in 1777- EN is considered the business from 1770 Baroque architecture. paintings and sculp- partially reconstruct- wine-making village during the heyday facility at the foot of “Zeller-Schwarze- tain with “Eulen- is located in the ro- 1786 in a French largest Roman to 2002. This unique cultural and The ceiling frescoes and sculptures in- tures, fine porcelain and East Asian ed Roman villa which and a place where of the Trierer Land region. All that the vineyards “Erde- Katz” wine location köpfchen” lookout mantic Elzbachtal classicist style. A glorious palace gar- mosaic north of industrial monument has been main- side the church are particularly worth artefacts, but also everyday objects can be visited. Still many unique treas- remains today of one of the largest ner Prälat” and “Er- with Electoral resi- point and late Roman valley.