Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Teilnachlass Max Reinhardt Wienbibliothek Im Rathaus Handschriftensammlung ZPH 989 Bestandssystematik
Teilnachlass Max Reinhardt Wienbibliothek im Rathaus Handschriftensammlung ZPH 989 Bestandssystematik Wienbibliothek im Rathaus/Handschriftensammlung - Teilnachlass Max Reinhardt / ZPH 989 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Biographische Informationen Reinhardt, Max (eigentlich: M. Goldmann): 9. 9. 1873 Baden - 31. 10. 1943 New York; Schauspieler, Regisseur, Theaterleiter; 1938 Emigration über London nach New York; Wien, Berlin, New York. Provenienz des Bestands Der Teilnachlass Max Reinhardt wurde von der Wienbibliothek im Rathaus im Jahr 1998 von einem Antiquariat gekauft. Umfang 16 Archivboxen, 1 Foliobox, 1 Großformatmappe. Information für die Benützung Die in geschwungenen Klammern angeführten Zahlen beziehen sich auf die jeweiligen Nummern in der Publikation: Max Reinhardt. Manuskripte, Briefe, Dokumente. Katalog der Sammlung Dr. Jürgen Stein. Bearbeitet und herausgegeben von Hugo Wetscherek. Für die Ordnungssystematik wurden alle Informationen aus der o.a. Publikation - inklusive Verweise auf angegebene Primär- und Sekundärliteratur - ohne Prüfung auf Richtigkeit mit Zustimmung des Herausgebers verwendet. Die Orthographie der Zitate wurde vereinheitlicht. 2 Wienbibliothek im Rathaus/Handschriftensammlung - Teilnachlass Max Reinhardt / ZPH 989 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Abkürzungsverzeichnis Anm. Anmerkung(en) Beil. Beilage(n) -

German Jews in the United States: a Guide to Archival Collections
GERMAN HISTORICAL INSTITUTE,WASHINGTON,DC REFERENCE GUIDE 24 GERMAN JEWS IN THE UNITED STATES: AGUIDE TO ARCHIVAL COLLECTIONS Contents INTRODUCTION &ACKNOWLEDGMENTS 1 ABOUT THE EDITOR 6 ARCHIVAL COLLECTIONS (arranged alphabetically by state and then city) ALABAMA Montgomery 1. Alabama Department of Archives and History ................................ 7 ARIZONA Phoenix 2. Arizona Jewish Historical Society ........................................................ 8 ARKANSAS Little Rock 3. Arkansas History Commission and State Archives .......................... 9 CALIFORNIA Berkeley 4. University of California, Berkeley: Bancroft Library, Archives .................................................................................................. 10 5. Judah L. Mages Museum: Western Jewish History Center ........... 14 Beverly Hills 6. Acad. of Motion Picture Arts and Sciences: Margaret Herrick Library, Special Coll. ............................................................................ 16 Davis 7. University of California at Davis: Shields Library, Special Collections and Archives ..................................................................... 16 Long Beach 8. California State Library, Long Beach: Special Collections ............. 17 Los Angeles 9. John F. Kennedy Memorial Library: Special Collections ...............18 10. UCLA Film and Television Archive .................................................. 18 11. USC: Doheny Memorial Library, Lion Feuchtwanger Archive ................................................................................................... -
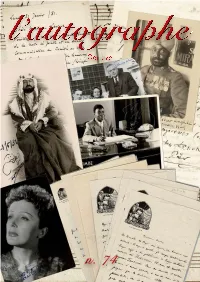
Genève L’Autographe
l’autographe Genève l’autographe L’autographe S.A. 24 rue du Cendrier, CH - 1201 Genève +41 22 510 50 59 (mobile) +41 22 523 58 88 (bureau) web: www.lautographe.com mail: [email protected] All autographs are offered subject to prior sale. Prices are quoted in EURO and do not include postage. All overseas shipments will be sent by air. Orders above € 1000 benefts of free shipping. We accept payments via bank transfer, Paypal and all major credit cards. We do not accept bank checks. Postfnance CCP 61-374302-1 3, rue du Vieux-Collège CH-1204, Genève IBAN: CH 94 0900 0000 9175 1379 1 SWIFT/BIC: POFICHBEXXX paypal.me/lautographe The costs of shipping and insurance are additional. Domestic orders are customarily shipped via La Poste. Foreign orders are shipped via Federal Express on request. Music and theatre p. 4 Miscellaneous p. 38 Signed Pennants p. 98 Music and theatre 1. Julia Bartet (Paris, 1854 - Parigi, 1941) Comédie-Française Autograph letter signed, dated 11 Avril 1901 by the French actress. Bartet comments on a book a gentleman sent her: “...la lecture que je viens de faire ne me laisse qu’un regret, c’est que nous ne possédions pas, pour le Grand Siècle, quelque Traité pareil au vôtre. Nous saurions ainsi comment les gens de goût “les honnêtes gens” prononçaient au juste, la belle langue qu’ils ont créée...”. 2 pp. In fine condition. € 70 2. Philippe Chaperon (Paris, 1823 - Lagny-sur-Marne, 1906) Paris Opera Autograph letter signed, dated Chambéry, le 26 Décembre 1864 by the French scenic designer at the Paris Opera. -

Klimt and the Ringstrasse
— 1 — Klimt and the Ringstrasse Herausgegeben von Agnes Husslein-Arco und Alexander Klee Edited by Agnes Husslein-Arco and Alexander Klee Inhalt Agnes Husslein-Arco 9 Klimt und die Ringstraße Klimt and the Ringstrasse Cornelia Reiter 13 Die Schule von Carl Rahl. Eduard Bitterlichs Kartonzyklus für das Palais Epstein The Viennese School of Carl Rahl. Eduard Bitterlich’s series of cartoons for Palais Epstein Eric Anderson 23 Jakob von Falke und der Geschmack Jakob von Falke and Ringstrasse-era taste Markus Fellinger 35 Klimt, die Künstler-Compagnie und das Theater Klimt, the Künstler Compagnie, and the Theater Walter Krause 49 Europa und die Skulpturen der Wiener Ringstraße Europe and the Sculptures of the Ringstrasse Karlheinz Rossbacher 61 Salons und Salonièren der Ringstraßenzeit Salons and Salonnières of the Ringstrasse-era Gert Selle 77 Thonet Nr. 14 Thonet No. 14 Wiener Zeitung, 28. April 1867 84 Die Möbelexposition aus massiv gebogenem Längenholze der Herren Gebrüder Thonet The exhibition of solid bentwood furniture by Gebrüder Thonet Alexander Klee 87 Kunst begreifen. Die Funktion des Sammelns am Ende des 19. Jahrhunderts in Wien Feeling Art. The role of collecting in the late nineteenth century in Vienna Alexander Klee 93 Anton Oelzelt. Baumagnat und Sammler Anton Oelzelt. Construction magnate and collector Alexander Klee 103 Friedrich Franz Josef Freiherr von Leitenberger. Das kosmopolitische Großbürgertum Baron Friedrich Franz Josef von Leitenberger. The cosmopolitan grande bourgeoisie Alexander Klee 111 Nicolaus Dumba. Philanthrop, -

Nachlass Albin Skoda Autographen
Nachlass Albin Skoda Autographen ABEKEN, Hedwig an Fräulein Schulhoff Berlin, 3. 11. 1901; Hs. [AM 38 802 Sk] ABEKEN, Hedwig an Fräulein Schulhoff o. D.; Hs [AM 38 801 Sk] ABEL, Katharina an Frau Werner Vorderbrühl, 14. 7. o. J.; Visitenkarte, Dr. mit hs. Ergänzung [AM 51 995 Sk] ACHTERBERG, Fritz an Unbekannt Berlin, o. D.; Hs. [AM 38 803 Sk] ADLER, Dr. Friedrich an Unbekannt Prag, 20. 5. 1910; Hs. [AM 38 804 Sk] ADOLPH, Karl an Comitee 21. 1. 1930; Hs. [AM 38 805 Sk] AKNAY, Vilma an Unbekannt Wien, 29. 3. 1923; Fragment, Dr. mit eh. Unterschrift [AM 57 366 Sk] ALBACH-RETTY, Rosa an Unbekannt 1912; Einreichung für Freikarten im Burgtheater, Dr. und Hs. mit eh. Unterschrift [AM 39 179 Sk] ALBACH-RETTY, Rosa an Unbekannt 1912; Einreichung für Freikarten im Burgtheater, Dr. und Hs. mit eh. Unterschrift [AM 39 180 Sk] ALBACH-RETTY, Rosa an Anna Witrofski-Kallina 2. 11. 1931; Hs. Beilage: Briefkuvert; Hs. [AM 38 806 Sk] ALEXANDROWA, Elisabeth 4. 6. o. J.; Bestätigung eines Abkommens mit den Reinhardt-Gastspielen an den Münchener Staatstheatern, Abschrift, Ms. [AM 57 641 Sk] ALXINGER, Johann Baptist an Hofrat Greiner o. D.; Hs. Beilage: K. Bulling an Unbekannt; Leipzig, 17. 7. 1912; Ms. (Durchschlag) [AM 38 807 Sk] ANDERGAST, Liesl an Albin Skoda o. D.; Hs. Beilage: Briefkuvert; Hs. [AM 38 808 Sk] ANDERGAST, Liesl u. a. o. D.; Namensliste zur Vorstellung „Pariserinnen“, Ms. mit eh. Unterschriften u. a. von Liesl Andergast, Pepi Kramer-Glöckner, Gisa Wurm, Elfriede Datzig, Anton Rudolph, Oskar Karlweis, Robert Horky, Martin Berliner, Leopoldine Richter [AM 57 367 Sk] ANDERS, Günther an Albin Skoda 22. -

Max Reinhardt Zim://A/Max Reinhardt.Html
Max_Reinhardt zim://A/Max_Reinhardt.html Max_Reinhardt Max Reinhardt (Baden, 9 settembre 1873 – New York, 31 ottobre 1943) è stato un regista teatrale, attore teatrale, produttore teatrale, drammaturgo e regista cinematografico austriaco naturalizzato statunitense. Biografia Max Reinhardt nacque nel 1873 a Baden, una cittadina termale a pochi chilometri da Vienna, residenza, dei soggiorni termali della famiglia imperiale, con il nome di Maximilian Goldmann in una famiglia ebraica appartenente all'alta borghesia austriaca. I teatri di Berlino Iniziò la sua carriera teatrale come attore ma non eccellendo nell'arte del recitare passò a fare Max Reinhardt il direttore di scena e infine il regista. Essendo passato attraverso l'esperienza del cabaret, quando si trasferì a Berlino, prese in gestione un locale che ben presto divenne famoso in tutta la città, il Cabaret Schall und Rauch. Questo fu il suo trampolino di lancio sulla scena berlinese che di lì a poco lo avrebbe visto diventare uno dei maggiori registi teatrali del Novecento. Divenuto amico di Otto Brahm, il celebre regista del teatro naturalista tedesco, Reinhardt lo affiancò nelle sue produzioni al Deutsches Theater, il più importante teatro berlinese. Reinhardt a Berlino Nel 1905 Reinhardt, essendo tramontato l'astro del naturalismo, fu chiamato ad assumere la conduzione del Deutsches Theater e sotto la sua supervisione nacquero delle produzioni spettacolari e modernissime come sino a quel momento non se ne erano mai viste di simili in Germania. Frequentò ogni genere teatrale privilegiando però le tragedie greche e i repertori shakespeariani. Passarono sotto la sua conduzione i più importanti uomini di teatro tedeschi del primo ventennio del Novecento. -

Vor Dem Vorhang Jahresbericht 2019 Das Jahr 2019 Stand Im Theatermuseum Ganz Im Überdauert Haben
Vor dem Vorhang Jahresbericht 2019 Das Jahr 2019 stand im Theatermuseum ganz im überdauert haben. Zusätzlich wurde eigens für Es ist immer jetzt Zeichen des Tanzes. Mit Alles tanzt. Kosmos Wiener dieses Ausstellungsprojekt ein umfangreiches Be- Tanzmoderne und Die Spitze tanzt. 150 Jahre Ballett gleit- und Vermittlungsprogramm entwickelt. an der Wiener Staatsoper waren gleich zwei Aus- Dazu zählte die abwechslungsreiche Reihe Bits stellungen diesem Thema gewidmet. and Pieces, für die Studierende der Musik und Kunst Privatuniversität (MUK) und TänzerInnen 2015 erfolgte die Übergabe des umfang reichen insgesamt 28 unterschiedliche Performances und schriftlichen Nachlasses der Tänzerin, Choreogra- Vorträge erarbeiteten und in den Schauräumen fin und Pädagogin Rosalia Chladek (Brünn 1905 – wie im Rest des Museums darboten. 1995 Wien) von der Internationalen Gesellschaft Rosalia Chladek an das neu gegründete Tanz-Ar- Parallel zur Tanzmoderne wurde in Kooperation mit chiv der Musik und Kunst Privatuniversität der dem Wiener Staatsballett ab Mai die Jubiläumsaus- Stadt Wien. Dieses Material wird seither unter der stellung Die Spitze tanzt. 150 Jahre Ballett an der Leitung der Tanzwissenschaftlerin und Kuratorin Wiener Staatsoper präsentiert. Dabei wurden in Andrea Amort in Zusammenarbeit mit dem Thea- mehreren Kapiteln Merkmale untersucht und vor- termuseum an der Privatuniversität aufgearbeitet. gestellt, die das Ballett-Ensemble von der Kaiser- Es soll nach dem Abschluss der Tätigkeiten unse- zeit über das 20. Jahrhundert bis zur unmittelbaren rem Haus übergeben werden und bildete schon Gegenwart geprägt haben. Thematisiert wurde jetzt den Ausgangspunkt zur ersten der beiden dabei auch das Schaffen wichtiger Persönlichkei- Ausstellungen, die im März eröffnet wurde. ten wie Josef Haßreiter, Gerhard Brunner, Rudolf Nurejew, Renato Zanella und Manuel Legris. -

SERIES V CRITICISM Box Folder 32 Max Reinhardt Directed Plays 1
SERIES V CRITICISM Box Folder 32 Max Reinhardt directed plays 1 Overview 2 1914 W. Schmidtbonn Kleines Theater, Berlin; 1914 Director: Max Reinhardt 3 Abschied vom Regiment and Angele O. E. Hartleben Kleines Theater, Berlin; 1905 Director: Richard Vallentin 4 Ackermann F. Hollaender and L. Schmidt Kleines Theater (Schall und Rauch); 1902 Director: Richard Vallentin 5 Bunbury. O. Wilde Kleines Theater / Neues Theater, Berlin; 1902/1903 Director: Hans Oberländer see Box 31, Folder 66. Salome 6 Candida G. B. Shaw Neues Theater, Berlin; 1904 Director: Felix Hollaender 7 Don Carlos F. v. Schiller Deutsches Theater, Berlin; 1917 Director: Max Reinhardt 8 Die Doppelgänger-Komödie A. Paul Kleines Theater, Berlin; 1904 Director: Richard Vallentin 9 Doppelselbstmord L. Anzengruber Neues Theater, Berlin; 1903 Director: Richard Vallentin 10 Dorothea Angermann G. Hauptmann Theater in der Josefstadt, Vienna; 1926 Director: Max Reinhardt 11 Einen Jux will er sich machen J. Nestroy Neues Theater, Berlin; 1904 Director: Max Reinhardt 12 Elektra H. v. Hofmannsthal (based on Sophokles) Kleines Theater, Berlin; 1903 Director: Max Reinhardt 13 Erdgeist F. Wedekind Kleines Theater, Berlin; 1902 Director: Richard Vallentin 14 Erdgeist F. Wedekind Neues Theater, Berlin; 1904 Director: Richard Vallentin 15 The Eternal Road F. Werfel Manhattan Opera House, New York; 1937 Director: Max Reinhardt 16 Faust J. W. v. Goethe Salzburg Festival (Festspielhaus); 1933 Director: Max Reinhardt 17 Faust J. W. v. Goethe Pilgrimage Outdoor Theatre, LA; 1938 Director: Max Reinhardt 18 Die Fledermaus J. Strauss Théâtre Pigalle, Paris; 1933 Director: Max Reinhardt 19 Fräulein Julie A. Strindberg Kleines Theater, Berlin; 1904 Director: Richard Vallentin 20 Früchte der Bildung L. -

Guide to the Max Reinhardt Collection
GUIDE TO THE MAX REINHARDT COLLECTION BIOGRAPHICAL NOTE The celebrated theater director Max Reinhardt, recognized in America primarily for his elaborate productions of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream, Franz Werfel’s The Eternal Road, and Karl Vollmoeller’s The Miracle, was born in 1873 at Baden near Vienna, Austria and died in New York City in 1943. Reinhardt’s illustrious career takes on added significance because it coincides with a major shift in the evolution of the modern theater: the ascendancy of the director as the key figure in theatrical production. Reinhardt’s reputation in international theater history is secured by the leading role he played in this transformation, as well as by his innovative use of new theater technology and endless experimentation with theater spaces and locales, which together redefined traditional relationships between actor and audience toward a new participatory theater. Born Maximilian Goldmann into an impecunious lower middle-class merchant family, Reinhardt (initially a stage name) began his career as a struggling young actor in Vienna and Salzburg. In 1894 he was invited to Berlin by Otto Brahm, the renowned director of the Deutsches Theater, where the young actor quickly gained critical acclaim for his convincing portrayals of old men. Eager to escape the gloom and doom of the prevailing Naturalist style, Reinhardt in 1901 co-founded an avant-garde literary cabaret called Sound and Smoke (Schall und Rauch), the allusion being to a poem by Goethe. This cabaret theater perceptively satirized the fashions of current theatrical theory and practice and came to function as an experimental laboratory for the future director. -

'We Have Become Niggers!': Josephine Baker As a Threat To
‘We Have Become Niggers!’: Josephine Baker as a Threat to Viennese Culture By Roman Horak Abstract Early 1928 Josephine Baker, by that time a famous dancer and singer, came to Vienna to be part of a vaudeville show. Even before her arrival the waves went high – her possible presence in Vienna caused a major uproar there. Various commentators constructed an image of Baker that was based on the assumption that she was seriously attacked on the values of traditional European culture and, furthermore, true Viennese culture. In my essay, where I address the Viennese Negerskandal more directly, I ex- plore the various discourses that produced this ‘event’ along the interface of mass culture/avant-garde and high/low culture. It is evident that these events centre on a construction of ‘blackness’ and of ‘black cultural expression’; it goes without say- ing that racism and sexism play a central role. I will, however, try to contextualize the ‘nigger scandal’ in a broader setting: against the background of Vienna in the late 1920s the perceived threat of ‘Amer- icanisation’ will be discussed. Keywords: Blackness, Viennese culture, racism, Josephine Baker, Americanisa- tion. Horak, Roman: “‘We Have Become Niggers’”, Culture Unbound, Volume 5, 2013: 515–530. Hosted by Linköping University Electronic Press: http://www.cultureunbound.ep.liu.se Introduction On Thursday 9 February 1928, Karl Kraus held one of his famous lectures in the Architektenvereinsaal, the hall of the architects’ association in Vienna. Kraus, whose favourite target in those days was still the Chief of Police, Schober, couldn’t resist addressing recent events that had been reported by the National Socialist Deutsch-österreichische Tages-Zeitung under the heading Negerskandal (‘nigger scandal’) (Deutsch-Österreichische Tages-Zeitung 1928). -

(1870-1941) H-767/2005
Wien 1938 – Das Ende zahlreicher Karrieren. Am Beispiel der Übersetzerin Marie Franzos (1870-1941) H-767/2005 Endbericht vorgelegt von Mag. Dr. Susanne Blumesberger Ameisgasse 53/31 1140 Wien Wien, Dezember 2006 2 Abbildung 1 Quelle: Friedländer, Herbert: Hjalmar Söderberg och Marie Franzos. 1953, S. 287 3 Inhaltsverzeichnis 1. Zur Person Marie Franzos............................................................................................................ 4 1.1. Die Familie ............................................................................................................................ 4 2. Das literarische Schaffen von Marie Franzos.............................................................................. 8 2.1. Übersetzte Werke (Auswahl) ................................................................................................ 8 3. Der Nachlass von Marie Franzos............................................................................................... 10 4. Briefbestand in der Österrreichischen Nationalbibliothek......................................................... 12 4.1. KorrespondenzpartnerInnen ................................................................................................ 12 4.2. Ausgewertete Briefe ............................................................................................................ 60 4.3. Zum Inhalt der Briefe ........................................................................................................ 107 4.3.1. Auftragsbeschaffung .................................................................................................. -

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Als Besucher im Theatermuseum“ Verfasserin Josephine Dratwa angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuer: Univ. Prof. Dr. Wolfgang Greisenegger EINLEITUNG........................................................................................... S.5 I. THEORETISCHES IM VORFELD 1. Konzeptentwürfe für Theatermuseen................................................ S.7 1.1 Winfried Klara.…........................................................................... S.7 1.2 Franz Rapp.................................................................................. S.10 1.3 Harald Buhlan.............................................................................. S.12 2. Exkurs: Staging Knowledge - Herbert Lachmayers Ansatz der Inszenierung von Wissensräumen................................................... S.14 3. Musealisierung..................................................................................... S.18 3.1 Kontextveränderung..................................................................... S.18 3.2 Stumme Objekte als Zeichenträger................................................ S.19 3.3 Das Subjekt-Objekt-Verhältnis....................................................... S.20 II. DAS UNTERSUCHUNGSFELD 1. Theatralia als Sammlungsgegenstand..............................................