Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Goodbye Cinema, Hello Cinephilia Other Books by Jonathan Rosenbaum
Goodbye Cinema, Hello Cinephilia Other Books by Jonathan Rosenbaum Rivette: Texts and Interviews (editor, 1977) Orson Welles: A Critical View, by André Bazin (editor and translator, 1978) Moving Places: A Life in the Movies (1980) Film: The Front Line 1983 (1983) Midnight Movies (with J. Hoberman, 1983) Greed (1991) This Is Orson Welles, by Orson Welles and Peter Bogdanovich (editor, 1992) Placing Movies: The Practice of Film Criticism (1995) Movies as Politics (1997) Another Kind of Independence: Joe Dante and the Roger Corman Class of 1970 (coedited with Bill Krohn, 1999) Dead Man (2000) Movie Wars: How Hollywood and the Media Limit What Films We Can See (2000) Abbas Kiarostami (with Mehrmax Saeed-Vafa, 2003) Movie Mutations: The Changing Face of World Cinephilia (coedited with Adrian Martin, 2003) Essential Cinema: On the Necessity of Film Canons (2004) Discovering Orson Welles (2007) The Unquiet American: Trangressive Comedies from the U.S. (2009) Goodbye Cinema, Hello Cinephilia Film Culture in Transition Jonathan Rosenbaum the university of chicago press | chicago and london Jonathan Rosenbaum wrote for many periodicals (including the Village Voice, Sight and Sound, Film Quarterly, and Film Comment) before becoming principal fi lm critic for the Chicago Reader in 1987. Since his retirement from that position in March 2008, he has maintained his own Web site and continued to write for both print and online publications. His many books include four major collections of essays: Placing Movies (California 1995), Movies as Politics (California 1997), Movie Wars (a cappella 2000), and Essential Cinema (Johns Hopkins 2004). The University of Chicago Press, Chicago 60637 The University of Chicago Press, Ltd., London © 2010 by The University of Chicago All rights reserved. -

Film Front Weimar: Representations of the First World War in German Films from the Weimar Period (1919-1933) Kester, Bernadette
www.ssoar.info Film Front Weimar: Representations of the First World War in German Films from the Weimar Period (1919-1933) Kester, Bernadette Veröffentlichungsversion / Published Version Monographie / monograph Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Kester, B. (2002). Film Front Weimar: Representations of the First World War in German Films from the Weimar Period (1919-1933). (Film Culture in Transition). Amsterdam: Amsterdam Univ. Press. https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:0168-ssoar-317059 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-ND Lizenz This document is made available under a CC BY-NC-ND Licence (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung) zur (Attribution-Non Comercial-NoDerivatives). For more Information Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de * pb ‘Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1 The Weimar Republic is widely regarded as a pre- cursor to the Nazi era and as a period in which jazz, achitecture and expressionist films all contributed to FILM FRONT WEIMAR BERNADETTE KESTER a cultural flourishing. The so-called Golden Twenties FFILMILM FILM however was also a decade in which Germany had to deal with the aftermath of the First World War. Film CULTURE CULTURE Front Weimar shows how Germany tried to reconcile IN TRANSITION IN TRANSITION the horrendous experiences of the war through the war films made between 1919 and 1933. -
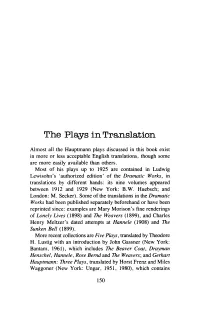
The Plays in Translation
The Plays in Translation Almost all the Hauptmann plays discussed in this book exist in more or less acceptable English translations, though some are more easily available than others. Most of his plays up to 1925 are contained in Ludwig Lewisohn's 'authorized edition' of the Dramatic Works, in translations by different hands: its nine volumes appeared between 1912 and 1929 (New York: B.W. Huebsch; and London: M. Secker). Some of the translations in the Dramatic Works had been published separately beforehand or have been reprinted since: examples are Mary Morison's fine renderings of Lonely Lives (1898) and The Weavers (1899), and Charles Henry Meltzer's dated attempts at Hannele (1908) and The Sunken Bell (1899). More recent collections are Five Plays, translated by Theodore H. Lustig with an introduction by John Gassner (New York: Bantam, 1961), which includes The Beaver Coat, Drayman Henschel, Hannele, Rose Bernd and The Weavers; and Gerhart Hauptmann: Three Plays, translated by Horst Frenz and Miles Waggoner (New York: Ungar, 1951, 1980), which contains 150 The Plays in Translation renderings into not very idiomatic English of The Weavers, Hannele and The Beaver Coat. Recent translations are Peter Bauland's Be/ore Daybreak (Chapel HilI: University of North Carolina Press, 1978), which tends to 'improve' on the original, and Frank Marcus's The Weavers (London: Methuen, 1980, 1983), a straightforward rendering with little or no attempt to convey the linguistic range of the original. Wedekind's Spring Awakening can be read in two lively modem translations, one made by Tom Osbom for the Royal Court Theatre in 1963 (London: Calder and Boyars, 1969, 1977), the other by Edward Bond (London: Methuen, 1980). -

Kino Kultur Haus
HAUS KINO KULTUR OKTOBER 2018 ÖSTERREICH ZWISCHEN 1948 GESTERN UND MORGEN SURVIVING IMAGES Theater, Film, Musik, Oper, Tanz. Leidenschaftliche Kulturberichterstattung, die alle Stücke spielt, täglich im STANDARD und auf derStandard.at. Kultur_allgemein_110x155.indd 1 28.11.17 10:40 METRO KINOKULTURHAUS PROGRAMM VON 4. OKTOBER BIS 8. NOVEMBER er Oktober – beginnt heuer mit 1948, einem Jahr, das eine Dekade nach dem D»Anschluss« für die heimische Filmindustrie eine Zäsur markierte, in dem die Kinoleinwand Projektionsfläche bot für erste (selbst)kritische Reflexionen. Was mit der Shoah beinahe völlig ausgelöscht wurde, sollte in stummen Filmbildern überleben: im Rahmen der diesjährigen Viennale geht das Filmarchiv Austria mit Surviving Images den Spuren jüdischer Lebenswelten nach und präsentiert damit einen neuen Restaurierungs- und Sammlungsschwerpunkt. Exemplarisch dafür steht die restau- rierte Fassung von DIE STADT OHNE JUDEN, für deren musikalische Neuvertonung keine Geringere als Olga Neuwirth zeichnet, die mit der Uraufführung im Wiener Konzerthaus für ein weiteres Highlight sorgt. Was es bedeutet, wenn junge Israelis ausgerechnet in der Heimat des Holocaust ihre Zukunft sehen, zeigt BACK TO THE FATHERLAND, unser Kinostart. Ein Neuanfang, der – wie so oft – mit einer Reise in die Vergangenheit startet. Ernst Kieninger und das Filmarchiv-Team AUSSTELLUNG DIE STADT OHNE | bis 30.12. 02 DIE STADT OHNE JUDEN ON TOUR | 11.10.–7.11. 05 RETROSPEKTIVEN 1948 – ÖSTERREICH ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN 10 4.10.-23.10. V’18: SURVIVING IMAGES | 26.10.–8.11. 28 KINOSTART BACK TO THE FATHERLAND | 12.10.–23.10. 42 FILM | UNIVERSITÄT SELBSTERMÄCHTIGUNG IM ISRAELISCHEN FILM 44 9.10.–16.10. PROGRAMMSCHIENEN SECOND LIFE | 4.10.–23.10. -

Auf Dem Weißen Rößl Zum Alexanderplatz. Camilla Spira Und Ihre Schwester Steffie 2002
Repositorium für die Medienwissenschaft Gaby Styn Auf dem weißen Rößl zum Alexanderplatz. Camilla Spira und ihre Schwester Steffie 2002 https://doi.org/10.25969/mediarep/1539 Veröffentlichungsversion / published version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Styn, Gaby: Auf dem weißen Rößl zum Alexanderplatz. Camilla Spira und ihre Schwester Steffie. In: Augen-Blick. Marburger Hefte zur Medienwissenschaft. Heft 33: Flucht durch Europa. Schauspielerinnen im Exil 1933-1945 (2002), S. 108–130. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/1539. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under a Deposit License (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, non-transferable, individual, and limited right for using this persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses document. This document is solely intended for your personal, Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für non-commercial use. All copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute, or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the conditions of vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder use stated above. -

Märchenkönig Und King of Cool Füssen Des Unesco-Welterbes Monte Der Ich Mich Für Einen Tag Und Eine San Giorgio
Publikation: osso Pagina: 26 Ist-Farben: cmyk0 Publikation: osso Pagina: 26 Ist-Farben: cmyk0 Ressort: so-re Erscheinungstag: 10. 11. 2013 MPS-Planfarben: cmyk Ressort: so-re Erscheinungstag: 10. 11. 2013 MPS-Planfarben: cmyk 10. November 2013 Ostschweiz 26 am Sonntag Reisen Nahverkehr: Brusino Arsizio TI Auf der ruhigen Seite des Sees TEXT UND BILD: BEDA HANIMANN Meist ist die markante gelbe Rund- kirche in Riva S.Vitale das Signal: Bald haben wir die Schweiz geschafft, Chias- so und also Italien sind nicht mehr weit. Diesmal bedeutet der barocke Prunkbau zwischen See und Berg et- was anderes, nämlich: Aussteigen. Wir sind nicht viele, die den Regionalzug in Capolago-Riva S.Vitale verlassen. Die Monte-Generoso-Bahn hat Winterpau- se, da bleiben nicht mehr viele Gründe, um hier auszusteigen. So zu denken ist natürlich Unsinn. Denn statt der Bergbahn ruckelt nach wenigen Minuten ein oranger Bus her- an, nicht das neueste Modell, Halte- stellen-Anzeigen gibt es nicht und auch keine mündlichen Durchsagen. Egal, ich fahre auf Sicht. Es geht dem süd- lichen Ufer des Luganersees entlang nach Porto Ceresio, dem Grenzort auf der italienischen Seite. Nach Piazza Po- jana drücke ich den Halteknopf. Sonntagsidylle im Fischerdorf Schöner und augenscheinlicher können Geographie, Topographie und Verkehrsplanung nicht Entspannung signalisieren. Brusino Arsizio liegt ab- seits, da kommt nicht hin, wer nicht Eine kleine Welt für sich: Brusino Arsizio hat auch im Nebel seinen Reiz. will. Beim Flanieren auf dem Lungola- go sehe ich ennet dem See die Transit- lionen Jahre alten Fossilien Geheim- Bucheckern oder Zigarettenstummel. stränge von Auto- und Eisenbahn, ich nisse über die Entstehung der Erde Ich muss das nachsagen, das Wetter kann Züge und Autos erkennen, pau- preis. -

Carmen Cartellieri
Carmen Cartellieri Also Known As: Franziska Ottilia Cartellieri, Carmen Teschen, Mrs. Emanuel Ziffer Edler von Teschenbruck, Mrs. Mano Ziffer-Teschenbruck Lived: June 28, 1891 - October 17, 1953 Worked as: co-screenwriter, film actress, producer, theatre actress Worked In: Austria, Germany, Hungary by Robert von Dassanowsky Carmen Cartellieri was born Franziska Ottilia Cartellieri in Prossnitz, Austria-Hungary, which is today Prostejov, Czech Republic, but spent her childhood in Innsbruck, Austria. In 1907, at age sixteen, she married the aristocratic artist-turned-director, Emanuel Ziffer Edler von Teschenbruck. Her husband and Cornelius Hintner, a cameraman from South Tyrol who had worked for Pathé in Paris and then as a director in Hungary, helped make her one of the most fashionable stars in German-language film of the 1920s. Using the stage name of Carmen Teschen, she appeared in several Hungarian silent films between 1918 and 1919 and made her Austrian film debut in Hintner’s Die Liebe vom Zigeunerstamme/The Gypsy Girl (1919), which she reportedly cowrote. Political changes in postwar Hungary made her relocate to Vienna where she returned to her exotic surname, suggesting to the press that she was born in Italy, and founded the Cartellieri-Film company in 1920 with her husband and Hintner. The first two Cartellieri-Film productions in Vienna transferred her Hungarian fame into true stardom. Carmen lernt Skifahren/Carmen Learns to Ski (1920), a broad comedy directed by her husband, now known as Mano Ziffer-Teschenbruck, was clearly aimed at gaining Cartellieri wider recognition. Die Würghand/Die Hand des Teufels/The Hand of the Devil (1920), a crime drama set in the mountains and directed by Hintner, was critically praised for its style and narrative effectiveness as well as for Cartellieri’s performance as the femme fatale. -

Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1
* pb ‘Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1 The Weimar Republic is widely regarded as a pre- cursor to the Nazi era and as a period in which jazz, achitecture and expressionist films all contributed to FILM FRONT WEIMAR BERNADETTE KESTER a cultural flourishing. The so-called Golden Twenties FFILMILM FILM however was also a decade in which Germany had to deal with the aftermath of the First World War. Film CULTURE CULTURE Front Weimar shows how Germany tried to reconcile IN TRANSITION IN TRANSITION the horrendous experiences of the war through the war films made between 1919 and 1933. These films shed light on the way Ger- many chose to remember its recent past. A body of twenty-five films is analysed. For insight into the understanding and reception of these films at the time, hundreds of film reviews, censorship re- ports and some popular history books are discussed. This is the first rigorous study of these hitherto unacknowledged war films. The chapters are ordered themati- cally: war documentaries, films on the causes of the war, the front life, the war at sea and the home front. Bernadette Kester is a researcher at the Institute of Military History (RNLA) in the Netherlands and teaches at the International School for Humanities and Social Sciences at the University of Am- sterdam. She received her PhD in History FilmFilm FrontFront of Society at the Erasmus University of Rotterdam. She has regular publications on subjects concerning historical representation. WeimarWeimar Representations of the First World War ISBN 90-5356-597-3 -

DCP - Verleihangebot
Mitglied der Fédération D FF – Deutsches Filminstitut & Tel.: +49 (0)611 / 97 000 10 www.dff.film Wiesbadener Volksbank Internationale des Archives Filmmuseum e.V. Fax: +49 (0)611 / 97 000 15 E-Mail: wessolow [email protected] IBAN: D E45510900000000891703 du Film (FIAF) Filmarchiv BIC: WIBADE5W XXX Friedrich-Bergius-Stra ß e 5 65203 Wiesbaden 08/ 2019 DCP - Verleihangebot Die angegebenen Preise verstehen sich pro Vorführung (zzgl. 7 % MwSt. und Versandkosten) inkl. Lizenzgebühren Erläuterung viragiert = ganze Szenen des Films sind monochrom eingefärbt koloriert = einzelne Teile des Bildes sind farblich bearbeitet ohne Angabe = schwarz/weiß restauriert = die Kopie ist technisch bearbeitet rekonstruiert = der Film ist inhaltlich der ursprünglichen Fassung weitgehend angeglichen eUT = mit englischen Untertiteln Kurz-Spielfilm = kürzer als 60 Minuten Deutsches Filminstitut - DIF DCP-Verleihangebot 08/2019 Zwischen Stummfilm Titel / Land / Jahr Regie / Darsteller Titel / Format Preis € Tonfilm Sprache DIE ABENTEUER DES PRINZEN Regie: Lotte Reiniger ACHMED Stummfilm deutsch DCP 100,-- D 1923 / 26 viragiert | restauriert (1999) ALRAUNE Regie: Arthur Maria Rabenalt BRD 1952 Tonfilm Darsteller: Hildegard Knef, Karlheinz Böhm deutsch DCP 200,-- Erich von Stroheim, Harry Meyen ALVORADA - AUFBRUCH IN Regie: Hugo Niebeling BRASILIEN DCP (Dokumentarfilm) Tonfilm deutsch 200,-- Bluray BRD 1961/62 FARBFILM AUF DER REEPERBAHN Regie: Wolfgang Liebeneiner NACHTS UM HALB EINS Tonfilm Darsteller: Hans Albers Fita Benkhoff deutsch DCP 200,-- BRD 1954 Heinz Rühmann Gustav Knuth AUS EINEM DEUTSCHEN Regie: Theodor Kotulla LEBEN Tonfilm Darsteller: Götz George Elisabeth Schwarz deutsch DCP 200,-- BRD 1976/1977 Kai Taschner Hans Korte Regie: Ernst Lubitsch DIE AUSTERNPRINZESSIN deutsch Stummfilm Darsteller: Ossi Oswalda Victor Janson DCP 130,-- Deutschland 1919 eUT mögl. -

Cinéma Français
la première revue de grand luxe du cinéma français PARIS Prix : 5 ffr. Juin 1929 APPAREIL STANDARD PASSANT LES FILMS SONORES et PARLANTS soit à disques, soit directement synchronisés sur film LIVRÉ AVEC UN CONTRAT RAISONNABLE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim CINÉVOX HAÏK "La voix du Cinéma" 63, Champs-Elysées, 63 - PARIS PREMIÈRE GRANDE PRODUCTION FRANÇAISE DE FILMS PARLANTS avec Les Meilleures Vedettes llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllf ATTENTION!!! NIC/EA-FILMS probubtiohI Le Roi de la Valse a présenté à l'EMPIRE « Ce film est fort intéressant et bien réalisé par Conrad avec le plus grand succès Wiene. La personnalité du personnage principal est for¬ LA DERNIERE RÉALISATION DE tement dégagée par le très bel artiste qu'est Alfred ROBERT PÉGUY A bel. » (Le Courrier Cinématographique.) mmiiimiiiiiimiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiii LES MUFLES D après le roman 'Eugène | avec BARBIER 1 Alfred ABEL avec | SUZANNE BIANCHETTI | g JANINE LIEZER - YVETTE DUBOST - ALICE DESVERGERS - TEROFF g « Dollq Davis interprète avec une grâce touchante le rôle de la jeune fille. » (Le Courrier Cinématographique.) | = PIERRE STEPHEN = | g E. HARDOUX - Henry HOURY - Lino MANZONI g g Edy DEBRAY - DUTERTRE - MATRAT g Boulevards = Tragédie d'Amour Opér. : BRUN et STUCKER - Décor. - Assistant : BONNEFOI — « Elvira Codeanu en Mimi est gracieuse et sensible. Oskar Beregi (le ban¬ quier) a grande allure. » (La Cinématographie Française.) Illllllllflillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll -

DCP – Film Distribution 09/2018
DCP – Film distribution 09/2018 Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Murnaustraße 6 65189 Wiesbaden Film distribution Patricia Heckert phone.: +49 (0) 611 / 9 77 08 - 45 Fax: +49 (0) 611 / 9 77 08 - 19 [email protected] Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Film distribution (DCP) 09/2018 Film title / Year Silent film / Music Type Credits Languages / Length Subtitles Abschied sound film directed by: Robert Siodmak german 77'25" DE 1930 cast: Brigitte Horney, Aribert Mog, Emilie alternate ending on DCP Unda Akrobat Schö-ö-ö-n sound film directed by: Wolfgang Staudte german 84'06'' DE 1943 cast: Charlie Rivell, Clara Tabody, Karl Schönböck, Fritz Kampers Als ich tot war music: Aljoscha Zimmermann silent film directed by: Ernst Lubitsch german intertitles 37'43" DE 1915 arrangement: Sabrina Hausmann cast: Ernst Lubitsch, Helene Voß tinted ensemble: Sabrina Hausmann, Mark Pogolski Amphitryon sound film directed by: Reinhold Schünzel german 103'11" DE 1935 cast: Willy Fritsch, Paul Kemp, Lilian Harvey Anna Boleyn music: Javier Pérez de Azpeitia silent film directed by: Ernst Lubitsch german intertitles 123'47" DE 1920 cast: Emil Jannings, Henny Porten, tinted Paul Hartmann restoration 1998 Apachen von Paris, Die without music silent film director: Nikolai Malikoff german intertitles 108'08'' DE 1927 cast: Jaque Catelain, Lia Eibenschütz, Olga Limburg Asphalt music: Karl-Ernst Sasse without mus directed by: Joe May german intertitles 94'14'' DE 1929 recording: Brandenburgische Philharmonie cast: Betty Amann, Gustav Fröhlich, Albert restoration -

Wir Über Uns Selbst (1928)
B R ARY Tl-IE MüSr.üM OF fVlOD^KN ART Raoeivadt ERSTER BAND DER AUTOBIOGRAPHIENSAMMLUNG WIR ÜBER UNS SELBST r Digitized by the Internet Archive in 2015 https://archive.org/details/filmknstlerwirb1928film_1 DR. HERMANN TREUNER FILMKÜNSTLER WIR ÜBER UNS SELBST HERAUSGEGEBEN VON DR. HERMANN TREUNER 19 2 8 SIBYLLEN' VERLAG / BERLIN 270 ganzseitige Porträts / 269 Autobiographien Dieses Budi wurde gedrudit und gebunden bei Herrose 'S) Ziemsen, Wittenberg (Bez. Halle) Die Klisdheeherstellung besorgte die Firma Sinsel 'S) Co., Leipzig Copyright 1928 by Sibyllen -Verlag, Berlin / Printed in Germany Alle Redite vorbehalten, insbesondere auch das Redit der Übersetzung in fremde Sprachen FILMKÜNSTLER WIR ÜBER UNS SELBST Ein Querschnitt durdi das unfaßbare, unbegrenzbare Neuland der Filmkunst soll dieses Buch sein. Eine neue Kunst im Spiegel ihrer Künstler. Sidier ist das Bild, das uns dieser Spiegel zeigt, nodi nicht ab^ geschlossen. Aber schließlich ist ja der Film nodi im Werden, und die Schwierigkeiten, die tausend einzelnen Steinchen aus der ganzen Welt zu einem einzigen Gesamtbild zusammenzufassen, sind unendlich. Trotzdem aber werden die einzelnen Reflexe aus den Seiten dieses Buclies den Begriff »Filmkunst« in ebenso reizvoller wie mannig^ facher Weise von den versAiedensten Seiten her beleuchten und hoffentlich dazu beitragen, dem Film und denen, die unter Ein^^ Setzung all ihres Könnens und Wollens an seiner Entwid^lung arbeiten, neue Freunde zu werben. Truus van Aalten Meine Wiege stand in Holland, und zwar in Arnheim. Meine Familie ist so unkünstlerisch wie nur möglich, was auch schon darin seinen Aus- druck findet, daß mein Vater eine Drogerie besaß. Ich selbst hatte dafür schon als kleines Mädel eine ungeheure Sehnsucht nach dem Film.