Irrgeister-2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Versorgungsangebote Für Palliativ-Patientinnen Und Patienten Im Hochsauerlandkreis
Versorgungsangebote für Palliativ-Patientinnen und Patienten im Hochsauerlandkreis Für die Versorgung von Menschen mit schweren Erkrankungen in ihrer letzten Lebens- phase steht im Hochsauerlandkreis ein qualifiziertes Versorgungs- und Hilfe-Angebot zur Verfügung, dass von den Ersatzkassen vergütet wird. Palliativ-Pflegedienste Die Organisation der allgemeinen Palliativversorgung erfolgt über einen der besonders qualifizierten Pflegedienste. Dieser kooperiert mit einem Palliativmediziner und mit einem ambulanten Hospizdienst. In der nachstehenden Tabelle finden Sie die besonders für die Palliativversorgung qualifi- zierten Pflegedienste. Name der PLZ Ort Strasse Telefon Pflegeeinrichtung Caritas-Sozialstation 59872 Meschede Steinstr. 12 0291/4527 Meschede Amb. Palliativpflegerischer 59955 Winterberg Am Waltenberg 23 02981/6345 Dienst der Caritas APO-CARE Häusl. Alten- 57392 Schmallen- Bahnhofstr. 7 02972/47555 und Krankenpflege berg 02972/47395 PROVITA 59755 Arnsberg Herbeckeweg 6 02932/8991186 Ambulanter Palliativ- 59759 Arnsberg Marktstr. 27 02932/ 53001 Pflegedienst Ambulante Hospizdienste Möchten Sie sich lieber direkt an einen Hospizdienst wenden, stehen Ihnen die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten ambulanten Hospizdienste zur Verfügung. Beachten Sie bitte: ambulante Hospizdienste erbringen ausschließlich psychosoziale Be- treuung. Sie übernehmen keine pflegerischen Aufgaben. Name des PLZ Ort Strasse Telefon Hospizdienstes Katholischer Hospizverein 34431 Marsberg Wickenhof 1 02992/8845 Marsberg e.V. Ambulanter Hospizdienst -
Experience Grimmheimat Nordhessen
EXPERIENCE GRIMMHEIMAT NORDHESSEN FREE LEISURE FUN WITH INCLUDING ALL LEISURE TIME ACTIVITIES 2020 FREE TRAVEL BY BUS AND TRAIN www.MeineCardPlus.de EXPERIENCE GRIMMHEIMAT NORDHESSEN CONTENT Welcome to Grimms ´home North Hesse About MeineCardPlus 4 North Hesse is the home of the Brothers Grimm. Jacob and Wilhelm Grimm spent most of their lives Map of leisure activities 6 here, in this picture postcard landscape, where they also collected and wrote down their world-famous fairy tales. The Brothers Grimm enjoyed their travels, The for keen swimmers 8 which took them all over the region; numerous diary entries and letters prove how much they loved living here. for underground Follow in their footsteps and discover the Grimms´ The 28 adventures home North Hesse. Your personalised visitor pass MeineCardPlus gives you unrestricted access to this unique region. Experience more than 140 leisure time activities free of charge during your holiday here. The for nature lovers 31 From water park fun to outstanding museums, a chilling ride on a summer toboggan run to a hike in the mountains or remarkable guided city tours. You for leisure time The 37 even travel for free on the region‘s public transport activities system. Refer to this brochure for more detailed information. We hope you have a fun-filled holiday in our fairy tale The for culture 53 region; enjoy your stay and please, tell everyone you know what a magical time you had! Regards, The for mobility 82 your holiday team from the Grimms´ home North Hesse FREE LEISURE FUN WITH MEINE Eintrittskarte ins Urlaubsvergnügen MEIN Fahrschein für Bus & Bahn MEINE Eintrittskarte ins Urlaubsvergnügen MEIN Fahrschein für Bus & Bahn ABOUT MeineCardPlus is your free pass to North Hesse‘s world of Most of the participating leisure, facilities are easily reached leisure time activities. -

„Eggeweg“ Rothaarsteig
Entfernungen: 1. Die „Kluskapelle“ Giershagen ist Marsberg – Padberg eine einschiffige, 1682 verlängerte (ab Niedermühle nach Padberg) romanische Kirche der Wüstung ca. 14 km Niederupsprunge, aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Der Hauptaltar von 1690 Marsberg – Nordseite der Diemelsee- und die Kanzel von 1690 – 1700 sind aus Sperrmauer der Bildhauerwerkstatt Papen. Nach der ca. 20 km Verwüstung durch den siebenjährigen Marsberg – nur auf der Raute, Krieg zogen die letzten Bürger 1761 nach je minus 1 km Giershagen (Oberupsprunge). 948 erste Helminghausen – Bontkirchen – Brilon urkundliche Erwähnung durch Schenkung ca. 17 km des Gutes Upspringum durch König Otto I. an den Grafen Habold. Helminghausen – Messinghausen – Brilon Wanderung ca. 16 km vom 2. Padberg liegt nordöstlich des Diemel- Erwandere das Mittelgebirge! sees an einem steilen Bergkegel. Erste Erwandere deine Heimat! Erwähnung des Ortes Padberg 1030. Ab 1120 Ringbefestigung, angelehnt an die „Eggeweg“ Frisch auf! Burg, ein stadtähnliches Gemeinwesen. Die Wehrkirche „St. Petrus“ ist mit ihrer romanischen Nordhälfte vermutlich um zum EGV Stadtmarketing Marsberg e.V. 1057 erbaut worden. Abt. Marsberg Rothaarsteig Wanderkarten: 3. Helminghausen gehörte zur Stadtwanderkarte Marsberg (1:25.000) Herrschaft der Padberger Grafen und von Marsberg nach Brilon und Raubritter, führend im Falkner-Bund 1380 und im Bengler-Bund 1391. Freizeitkarte des in Zusammenarbeit von Landesvermessungsamtes NRW, Blatt 16, „Mittleres Diemeltal, Warburger Börde“ (1:50.000) Euro 7,55 Information: Stadtmarketing Marsberg e. V. erhältlich bei: Bäckerstraße 8 Stadtmarketing Marsberg e. V. 34431 Marsberg Bäckerstraße 8, 34431 Marsberg Tel.: 02992-8200 oder 3388 Tel.: 02992-8200 oder 3388 Fax: 02992-1461 Fax: 02992-1461 [email protected] [email protected] www.marsberg.de www.marsberg.de wo wir auf die Raute „Marsberger Bezirks- Als Variante bietet sich an, am wanderweg“ stoßen. -

Merkblatt Zur Beteiligung Der Bezirksschornsteinfegermeisterin
Merkblatt zur Beteiligung der Bezirksschornsteinfegermeisterin/ des Bezirksschornsteinfegermeisters Stadt Schmallenberg - Untere Bauaufsichtsbehörde - Nach der Vorschrift des § 43 Abs. 7 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) muss die Bauherrin/der Bauherr sich bei der Errichtung oder Änderung von Schornsteinen sowie bei Anschluss von Feuerstätten an Schornsteine oder Abgas- leitung von der Bezirksschornsteinfegermeisterin/dem Bezirksschornsteinfegermeister (BZSM) bescheinigen lassen, dass der Schornstein oder die Abgasanlage sich in ei- nem ordnungsgemäßen Zustand befindet und für die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist. Bei der Errichtung von Schornsteinen soll der/dem BZSM Gelegenheit gegeben werden, vor Erteilung der Bescheinigung auch den Rohbauzustand zu be- sichtigen. Die Bescheinigung braucht der Bauaufsichtsbehörde nicht vorgelegt werden. Sollten Mängel festgestellt werden, wird die oder der BZSM dies der Bauaufsichtsbe- hörde von sich aus mitzuteilen. Mit Erteilung der Baugenehmigung erhält die/der für den Bezirk zuständige BZSM au- tomatisch hierüber eine Information durch die Bauaufsichtsbehörde. Eine Übersicht über die Bezirke und der/des jeweils zuständigen BZSM ist auf der Rückseite abge- druckt und kann jeweils aktuell auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises unter www.hochsauerlandkreis.de (Dienstleistungen A - Z, Schornsteinfegerangelegenhei- ten, Kehrbezirksverzeichnis) abgerufen werden. 04/2011 Bezirke der Bezirksschornsteinfegermeister Kehrbezirk HSK 08 (Eslohe) Bezirksschornsteinfegermeister -

Ortsteil Wohnsitz Männlich Weiblich Gesamt Almert Hauptwohnsitz 7 7
Einwohner in den Stadtteilen der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2016 Ortsteil Wohnsitz männlich weiblich Gesamt Almert Hauptwohnsitz 7 7 14 Altenhof Hauptwohnsitz 8 4 12 Altenilpe Hauptwohnsitz 88 80 168 Arpe Hauptwohnsitz 129 116 245 Bad Fredeburg Hauptwohnsitz 1.960 1.921 3.881 Berghausen Hauptwohnsitz 100 110 210 Berghof Hauptwohnsitz 4 5 9 Bödefeld Hauptwohnsitz 572 531 1.103 Brabecke Hauptwohnsitz 106 96 202 Bracht Hauptwohnsitz 239 243 482 Dorlar Hauptwohnsitz 461 411 872 Dornheim Hauptwohnsitz 18 16 34 Ebbinghof Hauptwohnsitz 17 11 28 Felbecke Hauptwohnsitz 70 83 153 Fleckenberg Hauptwohnsitz 784 779 1.563 Föckinghausen Hauptwohnsitz 6 8 14 Gellinghausen Hauptwohnsitz 74 47 121 Gleidorf Hauptwohnsitz 720 659 1.379 Grafschaft Hauptwohnsitz 509 562 1.071 Grimminghausen Hauptwohnsitz 31 27 58 Hanxleden Hauptwohnsitz 12 5 17 Harbecke Hauptwohnsitz 73 71 144 Hebbecke Hauptwohnsitz 4 4 8 Heiminghausen Hauptwohnsitz 50 51 101 Hengsiepen Hauptwohnsitz 1 3 4 Herschede Hauptwohnsitz 18 16 34 Hiege Hauptwohnsitz 1 2 3 Hoher Knochen Hauptwohnsitz 4 1 5 Holthausen Hauptwohnsitz 272 283 555 Hundesossen Hauptwohnsitz 30 32 62 Huxel Hauptwohnsitz 77 72 149 Inderlenne Hauptwohnsitz 23 20 43 Jagdhaus Hauptwohnsitz 33 32 65 Keppel Hauptwohnsitz 3 3 6 Kirchilpe Hauptwohnsitz 18 16 34 Kirchrarbach Hauptwohnsitz 158 138 296 Kückelheim Hauptwohnsitz 46 44 90 Landenbeckerbruch Hauptwohnsitz 3 3 6 Lanfert Hauptwohnsitz 4 5 9 Latrop Hauptwohnsitz 89 79 168 Lengenbeck Hauptwohnsitz 33 33 66 Lenne Hauptwohnsitz 155 186 341 Mailar Hauptwohnsitz 69 62 131 Menkhausen -

Sauerland- Wandeldorpen
Sauerland- Wandeldorpen Wandel suggesties en kaarten SAUERLAND WANDERDÖRFER sauerland-wanderdoerfer.de Mijn ontdekking – Sauerlandse 2 – Sauerlandse wandeldorpen De Sauerlandse wandeldorpen SAUERLAND WANDERDÖRFER vormen samen een wandelregio met een dicht netwerk van prachtige de Sauerland-Höhenflug, maar vooral en goed bewijzerde wandelroutes het uitgebreide net aan kwalitatief zoals het bijna nergens anders in uitstekende wandelroutes maken de Sau- Duitsland te vinden is. erlandse wandeldorpen zo bijzonder. n en om de plaatsen Brilon, Diemel- Tot de specifieke wandelbelevenissen Isee, Lennestadt & Kirchhundem, over grotendeels natuurwegen met veel Medebach, Olsberg, Schmallenberg landschappelijke en culturele bijzon- & Eslohe, Willingen, Winterberg & Hallenberg vindt u belevenisrijke wandelroutes die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn – of het nu om de gepassioneerde sportwandelaar gaat of om genieters en gezinnen met kinderen. Op de volgende bladzijden vindt u uitgebreide informatie over de Sauerlandse wandeldorpen met daarbij speciale wandeltips. Niet alleen de lange afstandroutes Rot- haarsteig, de Sauerland-Waldroute en 3 www.sauerland-wanderdoerfer.de Van harte welkom in de Sauerlandse wandeldorpen! het beschikbare kaartmateriaal kunt u zich in de wandelregio heel gemakke- lijk oriënteren. Bovendien hebben de Sauerlandse wandeldorpen reeds verschillende kant en klare routes derheden horen vanzelfsprekend de voor u samengesteld. Maar u kunt na- gecertificeerde meerdaagse wandelrou- tuurlijk ook uw eigen route met behulp tes -

Einwohner Nach Stadtteilen
Einwohner in den Stadtteilen der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2011 Stadtteil Wohnsitz männlich weiblich Gesamt Almert Hauptwohnsitz 8 7 15 Altenhof Hauptwohnsitz 14 6 20 Altenilpe Hauptwohnsitz 99 85 184 Arpe Hauptwohnsitz 118 110 228 Bad Fredeburg Hauptwohnsitz 1925 1956 3881 Berghausen Hauptwohnsitz 102 101 203 Berghof Hauptwohnsitz 3 5 8 Bödefeld Hauptwohnsitz 589 535 1124 Brabecke Hauptwohnsitz 112 102 214 Bracht Hauptwohnsitz 249 250 499 Dorlar Hauptwohnsitz 486 418 904 Dornheim Hauptwohnsitz 18 16 34 Ebbinghof Hauptwohnsitz 13 12 25 Felbecke Hauptwohnsitz 80 91 171 Fleckenberg Hauptwohnsitz 774 810 1584 Föckinghausen Hauptwohnsitz 8 8 16 Gellinghausen Hauptwohnsitz 71 45 116 Gleidorf Hauptwohnsitz 713 669 1382 Grafschaft Hauptwohnsitz 477 590 1067 Grimminghausen Hauptwohnsitz 30 30 60 Hanxleden Hauptwohnsitz 12 5 17 Harbecke Hauptwohnsitz 77 73 150 Hebbecke Hauptwohnsitz 4 4 8 Heiminghausen Hauptwohnsitz 52 53 105 Hengsiepen Hauptwohnsitz 2 3 5 Herschede Hauptwohnsitz 17 18 35 Hiege Hauptwohnsitz 1 2 3 Hoher Knochen Hauptwohnsitz 3 1 4 Holthausen Hauptwohnsitz 271 293 564 Hundesossen Hauptwohnsitz 35 29 64 Huxel Hauptwohnsitz 77 73 150 Inderlenne Hauptwohnsitz 27 22 49 Jagdhaus Hauptwohnsitz 36 29 65 Keppel Hauptwohnsitz 2 3 5 Kirchilpe Hauptwohnsitz 25 18 43 Kirchrarbach Hauptwohnsitz 155 127 282 Kückelheim Hauptwohnsitz 43 50 93 Landenbeckerbruch Hauptwohnsitz 4 3 7 Lanfert Hauptwohnsitz 4 5 9 Latrop Hauptwohnsitz 83 78 161 Lengenbeck Hauptwohnsitz 30 28 58 Lenne Hauptwohnsitz 163 175 338 Mailar Hauptwohnsitz 76 66 142 Menkhausen -

Willkommen in Marsberg
Willkommen in Willkommen in Marsberg im Sauerland, in Südwestfalen Überraschend vielseitig Willkommen im Dreiländereck Sauer- land, Waldecker Land, Paderborner Land - einer Region mit einmaligen Landschaften und unzähligen Se- henswürdigkeiten. Die Hansestadt Marsberg bietet zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten: (über-) regionale, zertifizierte (Themen-)Wan- derwege, Qualitätsradroute „Diemel- Entdecken Sie Marsberg radweg“, Hallenbad und Saunaland- • aktiv zu Fuß oder auf dem Rad, schaft, historisches Obermarsberg, Besucherbergwerk Kilianstollen, Kul- • bei verschiedensten tur- und Begegnungszentrum Kloster Freizeitaktivitäten, Bredelar, Ritzenhoff Factory Outlet, • auf historischen Pfaden diverse Museen und Erlebnisorte. Am Diemelsee finden Wassersportler, Ka- • oder ganz besonders. nuten, Wanderer, Naturliebhaber und Angler ein Dorado abseits der übli- Tourist-Info Marsberg chen Touristenpfade. Stadtmarketing Marsberg e.V. Bäckerstraße 8, 34431 Marsberg 02992 8200 oder 3388 [email protected] tourismus-marsberg.de • Einwohnerzahl: ca. 20.000 • Fläche: 182 km² • 17 Ortsteile • Höchster Punkt: Eisenberg (594,6 m) • Bundesland: Nordrhein-Westfalen • Kreis: Hochsauerlandkreis • Regierungsbezirk: Arnsberg • Naturparke: Diemelsee & Teu- toburger Wald/Eggegebirge Schön, dass Sie hier sind Wir für Sie Marsberg - nicht nur die verkehrsgüns- Stadtmarketing und Wirtschafts- tige Lage, die gute städtische Infra- förderung Marsberg e.V. struktur, das breit gefächerte Schul- Bäckerstraße 8, 34431 Marsberg sowie das vielseitige -

Alle Entsorgungsstationen in Deutschland Und Europa
GRATIS-BROSCHÜRE ZUM MITNEHMEN DEUTSCHLAND Von den Experten der Redaktion Stellplatz- Gutscheine im Wert von STELLPLATZFÜHRER 2021 1.000 Euro inklusive WOHNMOBIL 6.800 STELLPLÄTZE Übernachten in DeutschlandAlle Entsorgungsstationen in und EuropaDeutschland und Europa BESSERBrandaktuell PLANENentnommen aus BORDATLAS• von A-Z sortiert 2021 • Übersichtskarten • Ausflugstipps– dem großen Stellplatzführer 50% GEPRÜFTE STELLPLÄTZE Rabatt-Coupon mit GPS-Koordinaten für die Stellplatz-App ALLE ENTSORGUNGSSTATIONEN nach Postleitzahl sortiert www.bordatlas.de BA21_DE_Umschlag.indd 1 22.10.20 14:09 Sie halten einen besonderen Service des Stellplatzführers Bordatlas in den Händen: eine aktuelle Übersicht aller Entsorgungs- stationen in Deutschland und Europa. Heiko Paul Komfortabel sortiert nach PLZ, damit Sie Chefredakteur schnell zu Ihrem Ziel finden. Zur besseren Orientierung haben wir außerdem eine Außerdem finden Sie im vorderen Teil des LESESPASS PLZ-Karte (siehe Seite 5) beigefügt. Bordatlas eine Auflistung aller Stellplätze sowie Diese Broschüre können Sie jederzeit als aller Entsorgungsstationen in Deutschland, sortiert regelmäßig lesen und als Dankeschön nach PLZ. Somit können Sie Ihren Wunschplatz PDF-Dokument downloaden unter: IM ABO ein Geschenk Ihrer Wahl erhalten. nicht nur alphabetisch, sondern parallel auch www.bordatlas.de/entsorgungsstationen nach PLZ suchen. Im hinteren Teil helfen Gut- Hier wird sie wöchentlich aktualisiert! scheine im Gesamtwert von 1.000 Euro auf Ihren Reisen zu sparen. 24 Jahre Topqualität Der Bordatlas Stellplatzführer 2021 ist in Jetzt bestellen + Vorteile sichern: Entnommen haben wir diese Entsorgungsstati- einen Deutschland- und Europa-Band unterteilt onen aus dem Premium-Stellplatzführer und kostet 27,90 Euro. ➜ 10 % Preis-Ersparnis Bordatlas, der mit der 2021er-Ausgabe 24 Jahre Viel Spaß bei Ihren ➜ pünktlich und portofrei nach Hause alt wird, und von der Redaktion von Reisemobil Reisemobiltouren ➜ Keine Ausgabe verpassen International komplett überarbeitet wurde. -

Germany in Perspective Geography Introduction the Federal Republic of Germany Sits in the Heart of Europe
COUNTRY IN PERSPECTIVE GERMANY Schloss Neuschwanstein.Palace in Bavaria Flickr / Kay Gaensler DLIFLC DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE FOREIGN LANGUAGE CENTER COUNTRY IN PERSPECTIVE | GERMANY TABLE OF CONTENT Geography Introduction ................................................................................................................... 5 Geography and Topological Features ...................................................................... 6 Northern German Plain ......................................................................................6 Central Uplands ...................................................................................................6 The Alpen Foreland and the Alps .....................................................................7 Climate ..................................................................................................................7 Bodies of Water ............................................................................................................ 8 Rivers .....................................................................................................................8 Lakes and Seas ...................................................................................................9 Major Cities ..................................................................................................................10 Berlin ....................................................................................................................10 Hamburg ............................................................................................................ -

TOUR 2 Sauerland-Tour Die Große Länge: 251 Km Hochsauerland-Tour Start Und Ziel Der Tour 2 Ist Der Parkplatz Am Kurpark in Winterberg
Sauerland RoadBook Faszination Motorradfahren 10 ausgesuchte Detaillierte Strecken- Übersichtliche 6,90 € Biker-Touren beschreibungen Tourenkarten sauerland.com/motorrad Roadbook_neuesLayout2011.indd 1 06.07.11 16:03 Tour 2 Die große Hoch- TOUR 2 sauerland-Tour Die große Länge: 251 km Hochsauerland-Tour Start und Ziel der Tour 2 ist der Parkplatz am Kurpark in Winterberg. ■ 11 18 31 66 38 53 54 55 56 8413 14 Föckinghausen 15 51 50 16 8 10 Bigge 35 17 8419 20 69 Schwalefeld 68 67 46 Wellering- 92 93 hausen 57 39 87 Deifeld 21 22 23 Ruhr- 37 usen quelle 40 61 Obersorpe 84 85 86 Start 35 36 Holthausen Ziel 60 - 39 40 Tour 2 h 59 8471 Wink- 8488 hausen 41 8489 90 91 94 95 96 38 58 Liesen Schanze 62 70 5772 73 6074 5975 5676 77 29 30 5578 6079 5980 5981 5782 5783 28 Braunshausen 14 Roadbook_neuesLayout2011.indd 14 06.07.11 16:04 Winterberg - Schmallenberg Marsberg - Willingen Sauerland RoadBook Tour 2 Start und Ziel der Tour 2 ist der Parkplatz am wird die Stadt Marsberg erreicht (alte histo- Kurpark in Winterberg. Tipp: Abstecher zum rische Grenzfeste mit 1200-jähriger Geschich- Kahlen Asten (841 m). Dann kurvig wieder te, Besucherbergwerk Kilianstollen und eine runter vom Berg Richtung Schmallenberg. Kurz Glashütte). Über Adorf (Grube Christiane) und davor im Örtchen Winkhausen (Golfplatz) rechts Schloss Padberg zurück zum Diemelsee und ab über kleine Nebenstraßen durch das Sorpe- dann in den Tourismusort Willingen (zahlreiche tal bis Siedlinghausen. Von dort nach Ramsbeck touristische Angebote, Stop lohnt!). Von dort (Tipp: Besucherbergwerk und Museum; Freizeit- durch Usseln und in einer Schleife über schö- park Fort Fun) und über Bruchhausen (Tipp: ne Nebenstraßen ins Korbacher Land und zu- Naturdenkmal und Ausfl ugsziel Bruchhausener rück Richtung Winterberg über Küstelberg vor- Steine) Richtung Brilon. -
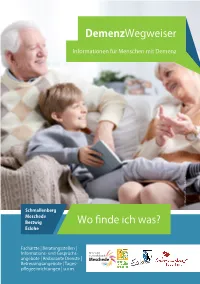
Demenzwegweiser Wo Finde Ich Was?
DemenzWegweiser Informationen für Menschen mit Demenz Fotolia.com © Photographee.eu Schmallenberg Meschede Bestwig Wo fi nde ich was? Eslohe Fachärzte | Beratungsstellen | Kreis- und Informations- und Gesprächs- Hochschulstadt angebote | Ambulante Dienste | Betreuungsangebote | Tages- pfl egeeinrichtungen | u.v.m. Arnsberg Brilon Marsberg Meschede Olsberg Sundern Bestwig Hochsauerlandkreis Eslohe Winterberg Medebach Schmallenberg Unterstützt durch: Hallenberg Gemeinde Bestwig Rathausplatz 1 59909 Bestwig Tel. 02904 987-0 [email protected] www.bestwig.de Gemeinde Eslohe (Sauerland) Schultheißstr. 2 59889 Eslohe Tel. 02973 800-0 [email protected] Ein Wort zuvor – Keiner kannʼs allein ... www.eslohe.de Die Pfl ege und Betreuung eines Menschen mit Demenz stellt Angehörige und Kreis- und Hochschulstadt Meschede Begleitpersonen vor eine große Herausforderung. Viele Fragen und Unsicherheiten Kreis- und Franz-Stahlmecke-Platz 2 Hochschulstadt treten auf, wenn sich ein nahestehender Mensch zunehmend verändert und mehr 59872 Meschede Tel. 0291 205 - 0 und mehr Hilfe bei der Bewältigung des Alltags benötigt. Auch wenn es trotz der [email protected] Demenzerkrankung weiterhin viele schöne Momente gibt, werden Fragen nach dem www.meschede.de Umgang mit dem manchmal befremdlichen Verhalten drängender. Es ist belastend, das Gefühl zu haben, immer da sein zu müssen und nicht zu wissen, wie es mit dem Stadt Schmallenberg Miteinander weiter geht. Unterm Werth 1 57392 Schmallenberg Tel. 02972 980-0 Keiner kann auf Dauer die Pfl ege eines Menschen mit Demenz alleine bewältigen, [email protected] diese Aufgabe muss auf mehrere Schultern verteilt werden, um für alle Beteiligten www.schmallenberg.de Lebensqualität zu wahren. Hochsauerlandkreis Steinstr. 27 Die vorliegende Broschüre versteht sich als Wegweiser für Angehörige und Begleit- 59872 Meschede personen von Menschen mit Demenz.