Magisterarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Schnelle Hilfe Durch D2
11 N /A- B i N ^ *c B R L N E R M O R G E N N G DER TAGESSPIEGEL COGNOSCERE Aus -1 rv\ * Berlin und / 1 ~n rvn f " / Ndl. 2,45 hfl / Frankr. 7,80 KP / Ital. 2925 L / Schweiz 2,45 str / . rr~~ « BERLIN, MONTAG, 17. OKTOBER 1994 / 50. Jahrgang / Nr. 15 064 1 UM Brandenburg / 1,31) 1JJV1 wärts / Ösrerr. 14 öS / Span. 200 Pias / Großbr. 140 p / Luxembg. 25 fr / AbOZZA BERLIN SPORT KULTUR Nichts ist unmöglich Das Bundesarchiy Michael Schumacher hat das Fragen an die deutsche VON GERD APPENZELLER zieht in die einstigen Formel-1 -Rennen in Jerez Geschichte - eine Ausstellung ie Wähler haben gestern, wenn Andrews-Barracks seiteio gewonnen seiteis zieht um SEHE 21 auch hauchdünn, die bisherige DRegierungskoalition bestätigt. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontinui- tät wog schwerer als der Wunsch nach Veränderung, wenn auch bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es sich dei Kanzler gewünscht hätte. Dennoch: Hel- Hauchdünne Mehrheit für Kohl und Kinkel mut Kohl kann vermutlich im Amt blei- ben. Den Willen dazu hat er gestern Vorsprung schmolz im Lauf des Abends bis auf zwei Sitze / Gysi, Heym, Luft und Müller gewinnen PDS-Direktmandate in Berlin / FDP bei abend unmißverständlich bekundet. Sei- ne Feststellung, er verfüge über eine re- über sechs Prozent / Geringe Wahlbeteiligung / SPD in Berlin stärkste Partei / Liberale bei Landtagswahlen gescheitert / SPD im Saarland vorn gierungsfähige Mehrheit ist richtig, wenn der liberale Partner bei der Stange Tsp. BONN/BERLIN. Die Koalition von Union und FDP kann in Bonn voraussicht- bleibt. Diesem blieb die Verbannung aus lich mit der hauchdünnen Mehrheit von zwei Sitzen weiterregieren. -

Der Imagewandel Von Helmut Kohl, Gerhard Schröder Und Angela Merkel Vom Kanzlerkandidaten Zum Kanzler - Ein Schauspiel in Zwei Akten
Forschungsgsgruppe Deutschland Februar 2008 Working Paper Sybille Klormann, Britta Udelhoven Der Imagewandel von Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel Vom Kanzlerkandidaten zum Kanzler - Ein Schauspiel in zwei Akten Inszenierung und Management von Machtwechseln in Deutschland 02/2008 Diese Veröffentlichung entstand im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes des Geschwister-Scholl-Instituts für Politische Wissenschaft unter Leitung von Dr. Manuela Glaab, Forschungsgruppe Deutschland am Centrum für angewandte Politikforschung. Weitere Informationen unter: www.forschungsgruppe-deutschland.de Inhaltsverzeichnis: 1. Die Bedeutung und Bewertung von Politiker – Images 3 2. Helmut Kohl: „Ich werde einmal der erste Mann in diesem Lande!“ 7 2.1 Gut Ding will Weile haben. Der „Lange“ Weg ins Kanzleramt 7 2.2 Groß und stolz: Ein Pfälzer erschüttert die Bonner Bühne 11 2.3 Der richtige Mann zur richtigen Zeit: Der Mann der deutschen Mitte 13 2.4 Der Bauherr der Macht 14 2.5 Kohl: Keine Richtung, keine Linie, keine Kompetenz 16 3. Gerhard Schröder: „Ich will hier rein!“ 18 3.1 „Hoppla, jetzt komm ich!“ Schröders Weg ins Bundeskanzleramt 18 3.2 „Wetten ... dass?“ – Regieren macht Spass 22 3.3 Robin Hood oder Genosse der Bosse? Wofür steht Schröder? 24 3.4 Wo ist Schröder? Vom „Gernekanzler“ zum „Chaoskanzler“ 26 3.5 Von Saumagen, Viel-Sagen und Reformvorhaben 28 4. Angela Merkel: „Ich will Deutschland dienen.“ 29 4.1 Fremd, unscheinbar und unterschätzt – Merkels leiser Aufstieg 29 4.2 Die drei P’s der Merkel: Physikerin, Politikerin und doch Phantom 33 4.3 Zwischen Darwin und Deutschland, Kanzleramt und Küche 35 4.4 „Angela Bangbüx“ : Versetzung akut gefährdet 37 4.5 Brutto: Aus einem Guss – Netto: Zuckerguss 39 5. -

User Roles in Online Political Discussion: a Typology Based on Twitter Data from the German Federal Election 2017
User Roles in Online Political Discussion: A Typology based on Twitter Data from the German Federal Election 2017 by Henner Gimpel, Florian Haamann, Manfred Schoch, Marcel Wittich In: Proceedings of the 26th European Conference on Information Systems (ECIS), Portsmouth, UK, June 2018, 8 University of Augsburg, D-86135 Augsburg Visitors: Universitätsstr. 12, 86159 Augsburg Phone: +49 821 598-4801 (Fax: -4899) 743 University of Bayreuth, D-95440 Bayreuth - I Visitors: Wittelsbacherring 10, 95444 Bayreuth W Phone: +49 921 55-4710 (Fax: -844710) www.fim-rc.de USER ROLES IN ONLINE POLITICAL DISCUSSIONS: A TYPOLOGY BASED ON TWITTER DATA FROM THE GERMAN FEDERAL ELECTION 2017 Research paper Gimpel, Henner, FIM Research Center, University of Augsburg, Augsburg, Germany, [email protected] Haamann, Florian, FIM Research Center, University of Augsburg, Augsburg, Germany, [email protected] Schoch, Manfred, FIM Research Center, University of Augsburg, Augsburg, Germany, [email protected] Wittich, Marcel, FIM Research Center, University of Augsburg, Augsburg, Germany, [email protected] Abstract Twitter is well recognized as a microblogging site, an online social network (OSN), and increasingly as a digital news platform. With the changing media usage behavior over the past decade, political actors have now recognized the need to enrich their election campaign efforts by including social media strat- egies. However, previous research has shown that users behave heterogeneously in online political dis- cussions. To better understand how users behave and interact in such debates, we conduct an explora- tory study to identify emergent user roles from Twitter data. We develop a dynamic selection query to collect a representative data set on the German federal election of 2017. -

J Ahresbericht 2 0
O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 7 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2018 Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 11 2.1 Radio ................................................................................................................................... 11 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 12 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 16 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 21 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 23 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 24 2.1.6 Radio Kärnten ......................................................................................................................... 27 2.1.7 Radio Niederösterreich ........................................................................................................... 30 2.1.8 Radio Oberösterreich ............................................................................................................ -
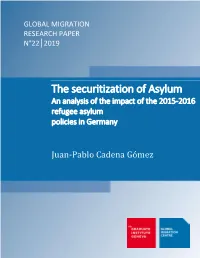
The Securitization of Asylum an Analysis of the Impact of the 2015-2016 Refugee Asylum Policies in Germany
GLOBAL MIGRATION RESEARCH PAPER N°22│2019 The securitization of Asylum An analysis of the impact of the 2015-2016 refugee asylum policies in Germany Juan-Pablo Cadena Gómez Juan-Pablo Cadena Gómez The securitization of asylum. An analysis of the impact of the 2015-2016 refugee crisis in asylum policies in Germany ISBN 978-2-8399-2900-4 The Global Migration Research Paper Series – N° 22, 2019 The Global Migration Research Paper Series (ISSN 2296-9810) is published by the Global Migration Centre (GMC). Located in Geneva, the world capital of migration, the GMC offers a unique interface between academia and the international community. The GMC conducts advanced research, policy-relevant expertise and training on the multifaceted causes, patterns and consequences of global migration. Email: [email protected] Website: http://graduateinstitute.ch/gmc The views expressed in the Global Migration Research Paper Series are those of the author and do not represent the views of the Graduate Institute of International and Development Studies. © Global Migration Centre Graduate Institute of International and Development Studies ii Global Migration Research Paper – 2019 N° 22 ABOUT THE AUTHOR Juan Pablo Cadena Gómez (Quito, Ecuador, 1981) is a political analyst and former diplomat with a B.A. in International Business and Trade from the Pontificia Universidad Católica del Ecuador, an M.A. in International Negotiations and Conflict Management from the Universidad Andina Simón Bolívar - UASB- (2008), and an M.A. in International Relations/Political Science from the Graduate Institute of International and Development Studies of Geneva (2019). He worked at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Ecuador between 2009 and 2018, where he was appointed Head of the Department of Political Analysis (2012-2013), First Secretary at the Permanent Mission of Ecuador to the United Nations Office in Geneva (2013- 2017), and Chief of Staff to the Minister of Foreign Affairs (2017-2018). -

Digital Watermarking for Verification of Perception-Based Integrity of Audio
Digital Watermarking for Verification of Perception-based Integrity of Audio Data Digitale Wasserzeichen zur Verifikation der wahrnehmungsbasierten Integrität von Audiodaten Zur Erlangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) genehmigte Dissertation von Sascha Zmudzinski, Diplom-Physiker, geb. in Berlin (West) Tag der Einreichung: 20. April 2017, Tag der Prüfung: 9. Juni 2017 Darmstadt 2017 D 17 1. Gutachten: Prof. Dr. rer. nat. Michael Waidner 2. Gutachten: Prof. Dr.-Ing. Martin Steinebach Fachbereich Informatik Lehrstuhl für Sicherheit in der Informationstechnik Digital Watermarking for Verification of Perception-based Integrity of Audio Data Digitale Wasserzeichen zur Verifikation der wahrnehmungsbasierten Integrität von Audiodaten Genehmigte Dissertation von Sascha Zmudzinski, Diplom-Physiker, geb. in Berlin (West) – gekürzte Fassung – 1. Gutachten: Prof. Dr. rer. nat. Michael Waidner 2. Gutachten: Prof. Dr.-Ing. Martin Steinebach Tag der Einreichung: 20. April 2017 Tag der Prüfung: 9. Juni 2017 Darmstadt 2017 D 17 Bitte zitieren Sie dieses Dokument als: URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-63114 URL: http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6311 Dieses Dokument wird bereitgestellt von tuprints, E-Publishing-Service der TU Darmstadt http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de [email protected] Die Veröffentlichung steht unter folgender Creative Commons Lizenz: Namensnennung – keine kommerzielle Nutzung (CC-BY-NC 4.0 International) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 Erklärung zur Dissertation Hiermit versichere ich, die vorliegende Dissertation ohne Hilfe Dritter nur mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln angefertigt zu haben. Alle Stellen, die aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. -

Die Fernsehduelle Der Spitzenkandidaten Von SPD Und CDU/CSU Im Bundestagswahlkampf 2002
Die Fernsehduelle der Spitzenkandidaten von SPD und CDU/CSU im Bundestagswahlkampf 2002 Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn vorgelegt von Thomas Breuer aus 52 146 Würselen Bonn 2006 Gedruckt mit Genehmigung der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn 1. Berichterstatter: Prof. Dr. Karlheinz Niclauß 2. Berichterstatter: Prof. Dr. Wolfgang Bergsdorf Tag der mündlichen Prüfung: 12. Januar 2006 Diese Dissertation ist auf dem Hochschulschriftenserver der ULB Bonn http://hss.ulb.uni-bonn.de/diss_online elektronisch publiziert 3 Inhaltsverzeichnis: I Einleitung S. 5 II Die These der Amerikanisierung des deutschen Wahlkampfs S. 9 III Wahlkampfführung und Massenmedien a) Medien und Demokratie S. 14 b) Die Rolle der Massenmedien im modernen Wahlkampf S. 24 c) Wahlkampftaktik und Wählerverhalten in der Mediengesellschaft S. 28 d) Die Funktion politischer Diskussionen im Fernsehen S. 40 IV Vorbilder für die TV-Duelle a) Die Presidential Debates in den USA S. 45 b) Die Elefantenrunden in der Bundesrepublik Deutschland S. 54 V Die TV-Duelle im Bundestagswahlkampf 2002 a) Die Planungen und Vorbereitungen der beiden TV-Duelle S. 63 b) Die politische Ausgangssituation vor den TV-Duellen S. 74 c) Der Verlauf des ersten TV-Duells bei RTL und SAT 1 S. 81 d) Die Diskussionen und Entwicklungen zwischen den beiden TV-Duellen S. 89 e) Der Verlauf des zweiten TV-Duells bei ARD und ZDF S. 95 VI Die Nachberichterstattung über die TV-Duelle im Fernsehen und den Printmedien a) Die Bedeutung der veröffentlichten Bewertungen und Kommentare S. 104 b) Die Berichterstattung über die TV-Duelle in den deutschen Medien S. -

Gemeinwohl Durch Wettbewerb? De Gruyter
1 Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer Band 69 Gemeinwohl durch Wettbewerb? Anne Peters, Thomas Giegerich Wettbewerb von Rechtsordnungen Armin Hatje, Markus Kotzur Demokratie als Wettbewerbsordnung Michael Potacs, Jens Kersten Herstellung von Wettbewerb als Verwaltungsaufgabe Max-Emanuel Geis, Christian Bumke Universitäten im Wettbewerb Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Graz vom 7. bis 10. Oktober 2009 De Gruyter 2 Redaktion: Prof. Dr. Christoph Engel (Bonn) ISBN 978-3-89949-757-1 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2010 Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York Druck: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen Ü Gedruckt auf säurefreiem Papier Printed in Germany www.degruyter.com 3 Inhalt Jahrestagung 2009 .......................... 5 Gemeinwohl durch Wettbewerb? Erster Beratungsgegenstand Wettbewerb von Rechtsordnungen 1. Bericht von Professorin Dr. Anne Peters ............ 7 Leitsätze der Berichterstatterin ................. 54 2. Bericht von Professor Dr. Thomas Giegerich ......... 57 Leitsätze des Berichterstatters .................. 100 3. Aussprache und Schlussworte .................. 106 Zweiter Beratungsgegenstand Demokratie als Wettbewerbsordnung 1. Bericht von Professor Dr. Armin Hatje ............. 135 Leitsätze des Berichterstatters -

Zur Zukunft Der Volksparteien
ZUR ZUKUNFT DER VOLKSPARTEIEN DAS PARTEIENSYSTEM UNTER DEN BEDINGUNGEN ZUNEHMENDER FRAGMENTIERUNG Ralf Thomas Baus (Hrsg.) ISBN 978-3-940955-42-5 IM IM www.kas.de PLENUM Diese Publikation dokumentiert die Ergebnisse der Tagung „Zukunft INHALT der Volkspartei” der Konrad-Adenauer-Stiftung vom 22. bis 25. Juli 2007. 7 | VORWORT 9 | PARTEIENSYSTEM IM WANDEL HERAUSFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVEN Ralf Thomas Baus 17 | teIL I: ZUM aktUELLEN StaND Der VOLksParteIEN IN DeUtsCHLAND 19 | DIE CDU IN DER GROSSEN KOALITION ZWISCHEN REDAKTION: 2005 UND 2007 Melanie Haas Tobias Montag 33 | DIE SPD UNTER KURT BECK TRAGISCHES SCHEITERN AN DER SOZIAL- DEMOKRATISIERUNG DER BUNDESREPUBLIK? Christoph Strünck 45 | DIE CSU VOR DEM INNERPARTEILICHEN MACHTWECHSEL Matthias F. Lill 57 | TEIL II: VOLksParteIEN IM EUROPÄISCheN UND INterNatIONALEN VerGLEICH 59 | DIE KONSERVATIVE PARTEI IN DER BÜRGERLICHEN „ALLIANZ FÜR SCHWEDEN” EINE NEUE VOLKSPARTEI? © 2009, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin Sven Jochem Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, allein mit Zustimmung der Konrad-Adenauer- Stiftung. 75 | DIE NEUAUFLAGE DER GROSSEN KOALITION Gestaltung: SWITSCH Kommunikationsdesign, Köln. IN ÖSTERREICH Druck: Druckerei Franz Paffenholz GmbH, Bornheim. Christian Moser | Ilse Simma Printed in Germany. Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland. 87 | WAHLENTWICKLUNGEN IN DEN NIEDERLANDEN ISBN 978-3-940955-42-5 VOLKSPARTEIEN IN DER KRISE Ton Nijhuis 101 | REGIEREN WIE GOTT IN FRANKREICH? 223 | „POLITIK 2.0” DIE KONSERVATIV-LIBERALE -
INTRODUCTION Eric Langenbacher Liminal Germany
INTRODUCTION Merkeldämmerung Eric Langenbacher Government, Georgetown University Abstract: The elections for the German Bundestag on 24 September 2017 saw heavy losses for the two governing parties—the Christian Democratic Union (CDU) and the Social Democratic Party (SPD)—and the rise of the right- populist Alternative for Germany (AfD). It took almost six months for a new grand coalition to be formed in light of the extremely fragmented parliament. Despite the good economic situation and relative calm domestically and inter- nationally, much change is occurring under the surface. Most importantly, the country is preparing for the end of Chancellor Angela Merkel’s long tenure. Who and what will come next? Can the surging AfD be contained? Will Ger- many step up into the leadership role for which so many have called? Keywords: 2017 Bundestag election, Alternative for Germany (AfD), Angela Merkel, Christian Democratic Union (CDU) German Parliament, political parties, Social Democratic Party of Germany (SPD) Liminal Germany I was recently re-watching the last Harry Potter film and was struck by the scene where Harry speaks with Dumbledore in a kind of purgatory, having to decide to die or go back to the living to try to defeat evil Lord Voldemort once and for all. (Spoiler alert: He chose the latter and was successful). This depiction of that space in-between life and death seems to be a fitting metaphor for German politics right now—seemingly immobile, in a weird kind of transitional stasis, a liminal state, with everything on hold, caught in-between one reality and another. On the surface, everything looks placid—there were even internet memes circulating about how there was no new government in Berlin for almost half a year, but no one noticed. -

Die Flüchtlingswelle Und Die Schnecken-Regierung: How Nature Metaphors Have Shaped Conservative German Immigration Discourse on Social Media Since 2015
Die Flüchtlingswelle und die Schnecken-Regierung: How Nature Metaphors Have Shaped Conservative German Immigration Discourse on Social Media since 2015 Undergraduate Research Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for graduation “with Research Distinction in German” in the undergraduate colleges of The Ohio State University By Elena Akers The Ohio State University April 2020 Project Advisor: Professor Matthew Birkhold, Department of Germanic Languages and Literatures 2 Abstract In 2015, when Chancellor Angela Merkel declared the German borders open to refugees from the Middle East and Africa, politicians and laypeople alike began to widely discuss immigration. Using discourse analysis, this thesis examines the rhetoric used by three conservative German political parties on Twitter. The Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Alternative für Deutschland (AfD), and Patriotishe Europäer gegen des Islamisierung des Abendlands (PEGIDA), represent three different, yet overlapping, political environments, from center-right mainstream politics to extremist grassroots movement. The immigration rhetoric of these three groups is analyzed through their official immigration platforms as well as their Tweets following the 2015 opening of borders and subsequent New Year's Eve sexual assaults. I focus on metaphors as the primary rhetorical device due to their importance in Germany's political history, especially the National Socialist time period, and their ability to influence perceptions of reality. Each party utilizes metaphors in different ways, though some metaphorical themes, such as those associated with nature, permeate through each discourse environment. We know from Germany's past and research on National Socialist language that dehumanization propaganda can lead to violence. This paper hopes to shed light on metaphors used to dehumanize refugees and bring about awareness of the negative effects to which this discourse can lead. -

O R F – J a H R E S B E R I C H T 2 0
III-198 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument 1 von 207 O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 9 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2020 www.parlament.gv.at 2 von 207 III-198 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 11 2.1 Radio ................................................................................................................................... 11 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 12 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 17 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 22 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 24 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 25 2.1.6 Radio Kärnten ......................................................................................................................... 29 2.1.7 Radio Niederösterreich