Das Projekt «Flora Aargau»
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Militär Und Bevölkerungsschutz Koordination Zivilschutz PLZ
DEPARTEMENT GESUNDHEIT UND SOZIALES Militär und Bevölkerungsschutz Koordination Zivilschutz GEMEINDEN MIT IHREN ZIVILSCHUTZORGANISATIONEN 2020 PLZ Gemeinde ZSO 5000 Aarau Aare Region 4663 Aarburg Wartburg 5646 Abtwil Freiamt 5600 Ammerswil Lenzburg Region 5628 Aristau Freiamt 8905 Arni Freiamt 5105 Auenstein Lenzburg Region 5644 Auw Freiamt 5400 Baden Baden (Region) 5330 Bad Zurzach Zurzibiet 5333 Baldingen Zurzibiet 5712 Beinwil am See aargauSüd 5637 Beinwil (Freiamt) Freiamt 5454 Bellikon Aargau Ost 8962 Bergdietikon Wettingen-Limmattal 8965 Berikon Aargau Ost 5627 Besenbüren Freiamt 5618 Bettwil Seetal 5023 Biberstein Aare Region 5413 Birmenstorf Baden (Region) 5242 Birr Brugg Region 5244 Birrhard Brugg Region 5708 Birrwil aargauSüd 5334 Böbikon Zurzibiet 5706 Boniswil Seetal 5623 Boswil Freiamt 4814 Bottenwil Suhrental-Uerkental 5315 Böttstein Zurzibiet 5076 Bözen Oberes Fricktal 5225 Bözberg Brugg Region 5620 Bremgarten Aargau Ost 4805 Brittnau Zofingen (Region) 5200 Brugg Brugg Region 5505 Brunegg Lenzburg Region 5033 Buchs Aare Region 5624 Bünzen Freiamt 5736 Burg aargauSüd 5619 Büttikon Aargau Ost 5632 Buttwil Freiamt Seite 1 PLZ Gemeinde ZSO 5026 Densbüren Oberes Fricktal 6042 Dietwil Freiamt 5606 Dintikon Aargau Ost 5605 Dottikon Aargau Ost 5312 Döttingen Zurzibiet 5724 Dürrenäsch Seetal 5078 Effingen Oberes Fricktal 5445 Eggenwil Aargau Ost 5704 Egliswil Seetal 5420 Ehrendingen Baden (Region) 5074 Eiken Unteres Fricktal 5077 Elfingen Oberes Fricktal 5304 Endingen Zurzibiet 5408 Ennetbaden Baden (Region) 5018 Erlinsbach AG Aare -

Merkblatt "Mobilität in Obersiggenthal"
Gemeinde Obersiggenthal Verkehrskommission MOBILITÄT IN OBERSIGGENTHAL Eine Information der Verkehrskommission Liebe Neuzuzügerin, lieber Neuzuzüger Herzlich willkommen in Obersiggenthal! Damit Sie sich in Ihrer neuen Wohngemeinde schnell zu Recht finden, bietet Ihnen dieses Informationsblatt einen Überblick über die Möglichkeiten zur Fortbewegung in und um Obersiggenthal. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Die Ortsteile Nussbaumen, Rieden und Kirchdorf sind durch die Linien 2 und 6 der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen RVBW im 7½- bis 15-Minuten-Takt erschlossen. Genaue In- formationen über Fahrpläne und Haltestellen können Sie dem „Willkommenspaket“ der RVBW entnehmen. Darin finden Sie auch zwei Tageskarten für das gesamte Streckennetz. Mit dem Bus erreichen Sie innert kürzester Zeit den Bahnhof Baden mit direkten Anschlüssen nach Zürich HB, Zürich-Flughafen sowie Richtung Aarau, Bern und Basel. Fahrplanauskünfte er- halten Sie unter www.sbb.ch oder www.rvbw.ch. Abonnemente sind an den Automaten der Haltestellen, direkt im Bus sowie am Kiosk neben der Post im Zentrum Markthof erhältlich. Zu Fuss: In Obersiggenthal können Sie alle Einrichtungen von öffentlichem Interesse bequem und auf sicheren Wegen zu Fuss erreichen. Schulwege entlang von Strassen ausserhalb der Tempo 30- Zonen sind durch Trottoirs und Fussgängerstreifen gesichert. Innerhalb des Einkaufszentrums Markthof besteht eine Fussgängerzone. Sämtliche Fussgängerstreifen über verkehrsreiche Stras- sen wurden auf Ihre Sicherheit hin überprüft und an die Erfordernisse der BfU angepasst. Nebst den Strassenverbindungen steht Ihnen in Obersiggenthal ein ausgebreitetes, gut unter- haltenes Netz an Fusswegen zur Verfügung - an Hanglagen teilweise als Treppenwege - wo- durch Abkürzungen ermöglicht werden. Die grossen Naherholungsgebiete am Siggenberg und an der Limmat laden zu weitläufigen Spaziergängen, sportlicher Betätigung und Freizeitgestaltung ein. Mit dem Velo: Obersiggenthal verfügt über ein gut ausgebautes, sicheres Radwegnetz. -

Jahresbericht 2019
Jahresbericht 2019 Schulhausweg 10, Postfach 100, 5442 Fislisbach, Tel. 056 483 00 69, Fax 056 483 00 70, [email protected], www.baden-regio.ch - 2 - I. Organisation Mitgliedsgemeinden Baden Regio gehören folgende 26 Gemeinden an: Baden Mägenwil Stetten Bergdietikon Mellingen Tägerig Birmenstorf Neuenhof Turgi Ehrendingen Niederrohrdorf Untersiggenthal Ennetbaden Oberrohrdorf Wettingen Fislisbach Obersiggenthal Wohlenschwil Freienwil Remetschwil Würenlingen Gebenstorf Schneisingen Würenlos Killwangen Spreitenbach Zwei Gemeinden haben ihre Mitgliedschaft bei Baden Regio satzungskonform gekündigt: Tägerig per 31.12.2020 und Schneisingen per 31.12.2021. Die beiden Gemeinden wollen sich künftig ver- mehrt Richtung Mutschellen-Rohrdorferberg-Reusstal resp. Zurzibiet ausrichten. Vorstand seit Präsident Roland Kuster, Gemeindeammann, Grossrat, Wettingen 2017 Vizepräsident Markus Schneider, Stadtammann, Baden 2018 Vertreter der Gemeinden Baden Markus Schneider, Stadtammann 2018 Rolf Wegmann, Leiter Entwicklungsplanung 1996 Stv.: Regula Dell'Anno, Vizeammann, Grossrätin 2018 Stv.: Wladimir Gorko, Entwicklungsplanung 2006 Bergdietikon Ralf Dörig, Gemeindeammann 2018 Stv.: Urs Emch, Vizeammann 2018 Birmenstorf Marianne Stänz, Gemeindeammann 2018 Stv.: Urs Rothlin, Gemeinderat 2017 Ehrendingen Urs Burkhard, Gemeindeammann 2018 Stv.: Markus Frauchiger, Vizeammann 2018 Ennetbaden Pius Graf, Gemeindeammann 2010 Stv.: Jürg Braga, Vizeammann 2010 Fislisbach Peter Huber, Gemeindeammann 2018 Stv.: Hanspeter Zaugg, Vizeammann 2018 Freienwil Robert A. Müller, -
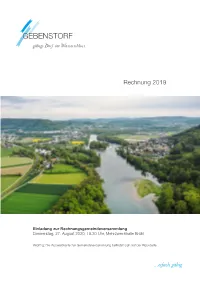
2020-08-27.Pdf
GEBENSTORF gäbigs Dorf im Wasserschloss Rechnung 2019 Einladung zur Rechnungsgemeindeversammlung Donnerstag, 27. August 2020, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Brühl Wichtig: Die Ausweiskarte zur Gemeindeversammlung befindet sich auf der Rückseite. ...eifach gäbig Inhaltsverzeichnis » Traktandenliste 3 » Editorial Gemeindeammann Fabian Keller 5 » Protokoll der Budgetgemeindeversammlung vom 28. November 2019 6 » Geschäftsbericht 2019 7 » Gemeinderechnungen 2019 8 » Kreditantrag von Fr. 550’000 für die technische Umrüstung der öffentlichen Strassenbeleuchtung 14 » Gemeindevertrag über den Regionalen Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz der Gemeinden Baden, Birmenstorf, Ehrendingen, Ennetbaden, Freienwil, Gebenstorf, Obersiggenthal, Turgi, Untersiggenthal und Würenlingen 16 » Kreditabrechnungen 21 a) Sanierung gemeindeeigenes Teilstück der Staldenstrasse 21 b) Sanierung Sandstrasse 21 c) Projektierung Pausenareal Brühl 21 » Verschiedenes, Termine und Umfrage 22 » Allgemeine Rechte der Stimmbürger 23 Einladung zur Rechnungsgemeindeversammlung am Donnerstag, 27. August 2020, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Brühl Werte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Wir freuen uns, Sie zur Rechnungsgemeindeversammlung einzuladen. Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen im Voraus bestens. Gerne unterbreiten wir Ihnen folgende Traktanden und Anträge 1. Protokoll der Budgetgemeindeversammlung vom 28. November 2019 Fabian Keller 2. Geschäftsbericht 2019 Fabian Keller 3. Gemeinderechnungen 2019 Fabian Keller 4. Kreditantrag von Fr. 550’000 für die technische -

Perimeter Control in the Swiss City of Baden: Evaluation of Different Scenarios
Perimeter Control in the Swiss City of Baden: Evaluation of Different Scenarios Author: Flurin Weber Supervisor: Alexander Genser Co-Supervisor: Dr. Mehdi Keyvan-Ekbatani (University of Canterbury, New Zealand) Professor: Dr. Anastasios Kouvelas Master Thesis January 2020 Perimeter Control in the Swiss City of Baden: Evaluation of Different Scenarios January 2020 Acknowledgements I would like to extend my deepest gratitude to my supervisors Alexander Genser and Dr. Anastasios Kouvelas from ETH Zürich. Without your knowledge, support and advice, be it via e-mail, Skype, or in personal conversation, I would not have been able to complete this thesis. Furthermore, my thanks go to my co-supervisor Mehdi Keyvan-Ekbatani from University of Canterbury (New Zealand), who took the time for regular skype meetings and supported me via e-mail. I could absolutely benefit from your knowledge of perimeter control. I also would like to thank Richard de Witt and Franziska Baumgartner from the Departement für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) of Kanton Aargau for the meetings and interesting inputs from a more practical point of view, as well as for providing the access to the traffic management computers. Also, my thanks are extended to Manuel Kalt, who gave me valuable inputs about different kinds of signal control logic. i Perimeter Control in the Swiss City of Baden: Evaluation of Different Scenarios January 2020 Master Thesis, handed in on 27th of January 2020 Perimeter Control in the Swiss City of Baden: Evaluation of Different Scenarios Flurin Weber IVT ETH Zurich Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland Phone: +41 79 684 48 24 E-Mail: [email protected] Abstract Nowadays, congestion in urban networks is abundant. -

Er Sieht Die Krise Als Neue Chance Mittwoch Ist Nicht Mehr
AZ 5200 Brugg •Nr. 2–14. Januar 2021 Aktuelles lesen Sie auch im Das Amtsblatt der Gemeinden Birmenstorf, Ehrendingen, Freienwil, Gebenstorf, Obersiggenthal, Turgi, Untersiggenthal viel mehr als Druck. Die Regionalzeitung fürEndingen, Lengnau, Schneisingen, Tegerfelden, Würenlingen (Ausgabe Nord) Aargovia TAXI DIESEWOCHE Rollstuhltaxi NOVUM Erstmals in der 94-jähri- 056 288 22 22 gen Firmengeschichte produziert Künzli keinen Schuh, sonderneine Gerne jederzeit für Sie da! High-End-Schutzmaske. Seite6 115070 RSP ALBUM Zu seiner Pensiongestaltet qps-stellenvermittlung.ch derBruggerFotografMax Gessler einBest-of-Buch mitFotos aus 75 Jahren. Seite7 Profijobs für DATUM Jobprofis DieEhrendinger können bereitsam13. Juni den Gemeinde- ratwählen –sofrühwie keinean- dereGemeinde der Region. Seite9 MITTEILUNGEN AUS DENGEMEINDEN qualitypersonal serviceag ab Seite8 Döttingerstrasse 8 5303 Würenlingen 056 290 07 71 ZITAT DER WOCHE 114644 RSN «EineFusion schafftaucheine FÜR EN neue gemeinsame HAB ET. Identität.» WIR FN GEÖF Jean-ClaudeKleiner berätBaden undTurgi SIE beim geplanten Zusammenschluss. Seite4 115163 RSK Er siehtdie Kriseals neue Chance RUNDSCHAUNORD Das PERSÖNLICHSTE Mutig, mutig: Mitten in der Corona-Krise übernimmt der führte. Das Gastro-Konzept «Trinity –Dreifaltigkeit des guten Effingermedien AG IVerlag 42-jährigeChristian Schübert aus Ehrendingen das Traditions- Geschmacks» mit den Königsdisziplinen Wiener Schnitzel, Bahnhofplatz 11 ·5201 Brugg Babyfachgeschäft Telefon 056 460 77 88 (Inserate) Gasthaus Bären in Veltheim. «Bei einem Besuch -

Freiwilligen-Fahrdienst 056 511 23 47
www.mia-obersiggenthal.ch Freiwilligen-Fahrdienst Fahrzeiten Fahrtenbestellung 07.30 bis 18.00 Uhr jeweils von Die Fahrtenbestellung muss Suchen Sie eine Fahrgelegenheit Montag bis Freitag (ohne allgemeine Feiertage). mindestens 1 Tag für den Einkauf? Möchten Sie gerne vor der geplanten Fahrt erfolgen. einen Besuch machen? Kosten Benötigen Sie Unterstützung, um zu Die Fahrpreise sind nach Zonen eingeteilt Fahrtenbestellungen können aus Ihrem Hausarzt oder ins Spital zu gemäss Angaben auf der Rückseite. organisatorischen Gründen nur kommen? telefonisch erfolgen. Fahrer Die Koordinationsstelle MiA nimmt Freiwillige, geschulte Fahrerinnen und diese gerne entgegen unter: Für die Gemeinde Obersiggenthal wird Fahrer holen Sie zu Hause ab und bringen seit November 2013 ein Freiwilligen- Sie wieder zurück. Fahrgäste und Fahrer 056 511 23 47 Fahrdienst angeboten. sind durch den Verein versichert. Die primäre Zielgruppe sind Senioren über 60 Jahre aus Obersiggenthal. Trägerschaft Montag-Freitag jeweils Dieses Angebot gilt auch für jüngere, Der Freiwilligen-Fahrdienst ist ein Angebot 09:00 - 11:00 und 14:00 - 17:00 Uhr. mobilitätseingeschränkte Personen aus des Vereins MiA Obersiggenthal und wird unserer Gemeinde. von der Gemeinde unterstützt. Weitere Informationen: Rollstühle können nicht transportiert Der Fahrgast ist verpflichtet, dem Verein www.mia-obersiggenthal.ch werden. als Mitglied beizutreten. Der Mitglieder- Kinder unter 12 Jahren in Begleitung beitrag beträgt pro Kalenderjahr Fr. 20.00 [email protected] Erwachsener fahren gratis. Der Fahrgast für Einzelmitglieder, bzw. Fr. 30.00 für muss den Kindersitz selber bereit stellen. Ehepaare. Mobil im Alter Obersiggenthal 5416 Kirchdorf AG Aargauische Kantonalbank Aarau IBAN CH65 0076 1504 4562 3200 1 I Döttingen Fahrpreise und Zonenplan • Endingen • • Zone 1 Würenlingen Fr. -

Eich Freienwil
Eich Freienwil ZWEI MEHRFAMILIENHÄUSER Inhaltsübersicht 02 INHALTSÜBERSICHT 09 TIEFGARAGE 04 LAGEPLAN 11 GRUNDRISSE HAUS A 05 GEMEINDE 14 GRUNDRISSE HAUS B 06 SITUATION 17 BAUBESCHRIEB 07 PROJEKT 19 ALLGEMEINE INFORMATIONEN InhalT 02 Sich Wohlfühlen. Zuhause sein. LASSEN SIE SICH BEGEISTERN VON IHREM NEUEN ZUHAUSE. OB DURCH DIE SCHÖNE ARCHITEKTUR, DIE HELLEN RÄUME ODER DIE LAUSCHIGEN LOGGIAS, HOHER WOHNKOMFORT IST GARANTIERT. In dem familienfreundlichen und ruhig gelegenen Freienwil entstehen an der HOHER KOMFORT Der thermische Komfort in Bauten mit gut gedämmten und kaum befahrenen Eichstrasse, an zentraler sonniger Südwesthanglage zwei dichten Aussenwänden, Böden und Dach flächen ist höher. Der Grund: Die inne- Mehrfamilienhäuser mit 13 Wohnungen. Zur Überbauung «Eich» gehören zudem ren Oberflächen der Bauhülle sind wärmer, keine Kältestrahlung und keine Zugs drei Einfamilien- und drei Reihenhäuser an der Eichstrasse sowie drei Reihenhäu- erscheinungen. Diese Eigenschaften wirken sich auch während sommerlichen ser am Rebhaldenweg. Mit dem vielfältigen Wohnungsmix bietet die neue Sied Hitzetagen aus: Das Gebäude ist vor Über temperaturen besser geschützt. lung für alle etwas, ob jung oder alt. FRISCHE LUFT Durch die Komfortlüftung ist die Luft im Haus sauberer und so- HAUS A Eichstrasse 10 mit auch gut geeignet für Allergiker. Jeder Raum wird mit der optimalen vortem- HAUS B Eichstrasse 8 perierten Luftmenge versorgt. Schadstoffe und Gerüche werden abgeführt. Der Betrieb ist vollautomatisch und das Gerät einfach zu bedienen. Zudem werden Die in der Dorfzone gelegenen Mehrfamilienhäuser sind gut in das ge schütz te, bei geschlossenen Fenstern ein erhöhter Lärmschutz und eine höhere Einbruch- wertvolle Ortsbild und die Landschaft integriert. Mit der wunderschönen Umge- sicherheit bei gleichzeitig gutem Raumklima erreicht. -
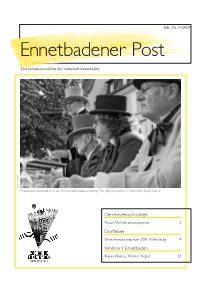
Ennetbadener Post
Juli, Nr. 3/2019 Ennetbadener Post Das Informationsblatt der Gemeinde Ennetbaden Bild: Alex Alex Spichale Bild: Ennetbadener Gemeinderat an der Sommer-Gemeindeversammlung: Zum 200-Jahr-Jubiläum im historischen Outfit (Seite 4). Gemeindenachrichten Neues Verkehrsmanagement 3 Dorfleben Grenzwanderung zum 200. Geburtstag 9 Wohnort Ennetbaden Bijaya Bhatta, Heimat Nepal 12 Editorial Krippenpool Im Juni 2016 hat das Aargauer darin neben einem volkswirtschaftlichen vor Stimmvolk ein Kinderbetreuungs allem auch einen sozialen Nutzen. gesetz verabschiedet, das die Ver einbarkeit von Beruf und Familie Die Koordination und strategische Führung und die Integration und Chancen der Vorschulbetreuung erfolgt über den Steu gleichheit von Kindern nachhaltig erungsausschuss mit je einem Mitglied aus verbessert. Das Gesetz schreibt vor, dem Gemeinderat, der vier Poolgemeinden so dass künftig alle Gemeinden ein be wie einer Geschäftsstelle, die der Verwaltung darfsgerechtes Betreuungsangebot der Stadt Baden angeschlossen ist. Der Krip von Kindern bis zum Abschluss der penpool arbeitet mit dem Zweck, durch eine Dominik Kramer, Primarschule sicherstellen müssen. einheitliche Subventionspraxis der Vertrags Gemeinderat Gleichzeitig sind sie dazu verpflich gemeinden die familienergänzende Kinderbe tet, sich an den Kosten der Kinder treuung von Vorschulkindern zu koordinieren. betreuung zu beteiligen. Er gibt den Rahmen für Betreuungsangebote, Qualitätsstandards und Tarife vor und entlas Ein gutes Angebot an familienergän tet dadurch die Verwaltungen der Gemeinden. zender Kinderbetreuung fördert die Standortattraktivität einer Gemein Die Zahlen sprechen für sich: Die vier Gemein de. In Ennetbaden erleben wird dies den gingen 2002 davon aus, dass bis im Jahr 1:1. Immer häufiger ziehen Famili 2020 eine Nachfrage nach zirka 500 Kinder en auch wegen des guten und um betreuungsplätzen bestehen wird. -
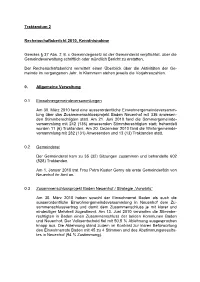
Traktandum 2
Traktandum 2 Rechenschaftsbericht 2010, Kenntnisnahme Gemäss § 37 Abs. 2 lit. c Gemeindegesetz ist der Gemeinderat verpflichtet, über die Gemeindeverwaltung schriftlich oder mündlich Bericht zu erstatten. Der Rechenschaftsbericht vermittelt einen Überblick über die Aktivitäten der Ge- meinde im vergangenen Jahr. In Klammern stehen jeweils die Vorjahreszahlen. 0. Allgemeine Verwaltung 0.1 Einwohnergemeindeversammlungen Am 30. März 2010 fand eine ausserordentliche Einwohnergemeindeversamm- lung über das Zusammenschlussprojekt Baden Neuenhof mit 336 anwesen- den Stimmberechtigten statt. Am 21. Juni 2010 fand die Sommergemeinde- versammlung mit 242 (136) anwesenden Stimmberechtigten statt; behandelt wurden 11 (6) Traktanden. Am 20. Dezember 2010 fand die Wintergemeinde- versammlung mit 282 (131) Anwesenden und 13 (13) Traktanden statt. 0.2 Gemeinderat Der Gemeinderat kam zu 35 (32) Sitzungen zusammen und behandelte 602 (528) Traktanden. Am 1. Januar 2010 trat Frau Petra Kuster Gerny als erste Gemeinderätin von Neuenhof ihr Amt an. 0.3 Zusammenschlussprojekt Baden Neuenhof / Strategie „Vorwärts“ Am 30. März 2010 haben sowohl der Einwohnerrat Baden als auch die ausserordentliche Einwohnergemeindeversammlung in Neuenhof dem Zu- sammenschlussvertrag und damit dem Zusammenschluss je mit klarer und eindeutiger Mehrheit zugestimmt. Am 13. Juni 2010 verwarfen die Stimmbe- rechtigten in Baden einen Zusammenschluss der beiden Kommunen Baden und Neuenhof. Der Volksentscheid fiel mit 50,5 % Ablehnung ausgesprochen knapp aus. Die Ablehnung stand zudem im Kontrast zur klaren Befürwortung des Einwohnerrats Baden mit 45 zu 4 Stimmen und des Abstimmungsresulta- tes in Neuenhof (94 % Zustimmung). Nach der Ablehnung des Zusammenschlussprojektes Baden Neuenhof durch die Stadt Baden am 13. Juni 2010 arbeitete der Gemeinderat die Strategie „Vorwärts“ aus, mit dem Ziel, die Finanzlage der Gemeinde Neuenhof weiter nachhaltig zu verbessern und damit verbesserte Voraussetzungen für allfällige neue Fusionsverhandlungen zu schaffen. -

Freienwil Aktuell
FREI EN WIL AKTUELL Nummer 1 1/2018 vom 26. Juli 2018 deshalb gebeten, mit dem Trinkwasser Informationen aus dem sparsam umzugehen und insbesondere Gemeinderat auf das Bewässern von Rasen und das WaschenvonAutosundHausplätzenzu Tagesstrukturen Freienwil verzichten. Wir empfehlen beim DerMittagstischwirdabdemneuenSchuljahr Bewässern von Pflanzen statt eines in der Kita Pop e Poppa im Weissen Wind Schlauchs, eine Giesskanne zu stattfinden. Die Gemeinde unterzeichnete verwenden.DerGemeinderatbeobachtet eine entsprechende Zusammenarbeits- dieSituationundwirdgegebenenfallsals vereinbarung. Dank des Kita- und Hort- Massnahme in naher Zukunft die Angebots von Pop e Poppa entsteht in Laufbrunnen in Freienwil abschalten Freienwil ein umfassendes Betreuungs- lassen. angebot, wie es normalerweise nur in grösseren Gemeinden möglich ist. Pop e Waldbrandsituation Poppa bietet ein modular kombinierbares Seitdem24.07.2018herrschtimKanton Angebot für kleine und grössere Kinder von Aargau erhebliche Waldbrandgefahr Montag bis Freitag von 6.30 bis 18 Uhr (bei (Stufe 3 von 5). Gemäss der Medien- Bedarfvon6bis21Uhr)an. mitteilung, welche auch auf der Die Gemeinde subventioniert dieses Angebot Gemeindehomepage www.freienwil.ch (wie auch den Mittagstisch und andere aufgeschaltet wurde, dürfen keine anerkannte Betreuungsinstitutionen) gemäss brennenden Raucherwaren und demneuenKinderbetreuungsreglement. Zündhölzer weggeworfen werden. Im Wald ist Feuer nur noch in festen Höhenfeuer am 1. August Feuerstellen erlaubt und darf nie Aufgrund der aktuellen Trockenheit -

Energiespeicher Made in Baden Neue Ideen Sind Immer Gefragt
AZ 5200 Brugg •Nr. 45 –7.November 2019 auch im lesen Sie Aktuelles Die Regionalzeitung fürBaden, Ennetbaden, Fislisbach, Killwangen, Neuenhof,Spreitenbach, Wettingen und Würenlos (Ausgabe Süd) viel mehr als Druck. Aargovia TAXI DIESEWOCHE Rollstuhltaxi EINZIGARTIG MariaKaegi zeigt 056 288 22 22 ihre Werkeineiner Ausstellungmit 107908 dem Titel«MALMAL»im«Pop up» Gerne jederzeit für Sie da! RSP am SchlossbergplatzBaden. Seite3 MONUMENTAL DieSinfonia Baden Wärmeanlage beginnt den Jahreszyklusmit Wer- erneuern kenvon Balzer,Casanova, Böhme undRaffimTrafo Baden. Seite4 VIEL DISKUTIERT DerKanton informierte im BBB Martinsberg über dasGesamtverkehrskonzept Seite7 Jetzt profitieren Ostaargau. 056 200 22 22 regionalwerke.ch RSP ZITAT DER WOCHE 109558B «Wir versuchen nicht, besonders originelloderlustig zu sein.» «Freischwimmerin»MarianneBarth glaubt EnergiespeichermadeinBaden an Situationskomik. Seite13 107492 RUNDSCHAUSÜD Effingermedien AG IVerlag RSS ABB fertigt in einer neuen ProduktionsstätteinBaden Trolleybussen in mehreren Schweizer Städten. Energiespei- Energiespeichersysteme fürBahnen, Elektro- und Trolleybus- chersysteme sind eine Schlüsseltechnologie fürdie Zukunft Storchengasse 15 ·5201 Brugg Telefon 056 460 77 88 (Inserate) se sowie Elektro-LKW. Die Energiespeicher tragen zur der nachhaltigen Mobilität.Sie spielen eine wichtigeRolle bei Redaktion 056 460 77 98 Reduktion vonEmissionen und zurSteigerung der Energieeffi- der Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Strassen- und [email protected] zienz bei. Verwendetwerden sie