Basisinformationen Zum „Neuen Geistlichen Lied” (Ngl)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
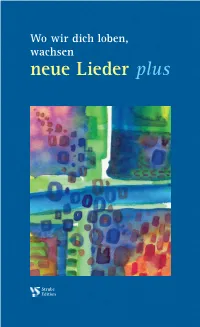
Neue Lieder Plus
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus Strube Edition ALPHABETISCHES VERZEICHNIS Accorde-nous la paix .............. 202 Christe, der du trägst Adieu larmes, peines .............. 207 die Sünd der Welt .................. 110 Aimer, c’est vivre .................... 176 Christ, ô toi qui portes Allein aus Glauben ................. 101 nos faiblesses ........................ 110 Allein deine Gnade genügt ....102 Christ, ô toi visage de Dieu .... 111 Alléluia, Venez chantons ........ 174 Christus, Antlitz Gottes ........... 111 Alles, was atmet .................... 197 Christus, dein Licht .................. 11 Amazing love ......................... 103 Christus, Gottes Lamm ............ 12 Amen (K) ............................... 104 Christus, höre uns .................... 13 An den Strömen von Babylon (K) ... 1 Christ, whose bruises An dunklen, kalten Tagen ....... 107 heal our wounds ................... 111 Anker in der Zeit ...................... 36 Con alegria, Atme in uns, Heiliger Geist ..... 105 chantons sans barrières ......... 112 Aube nouvelle dans notre nuit .. 82 Con alegria lasst uns singen ... 112 Auf, Seele, Gott zu loben ........ 106 Courir contre le vent ................. 40 Aus den Dörfern und aus Städten .. 2 Croix que je regarde ............... 170 Aus der Armut eines Stalles ........ 3 Danke für die Sonne .............. 113 Aus der Tiefe rufe ich zu dir ........ 4 Danke, Vater, für das Leben .... 114 Avec le Christ ........................... 70 Dans la nuit Bashana haba’a ..................... 183 la parole de Dieu (C) .............. 147 Behüte, Herr, Dans nos obscurités ................. 59 die ich dir anbefehle .............. 109 Das Leben braucht Erkenntnis .. 14 Bei Gott bin ich geborgen .......... 5 Dass die Sonne jeden Tag ......... 15 Beten .................................... 60 Das Wasser der Erde .............. 115 Bis ans Ende der Welt ................ 6 Da wohnt ein Sehnen Bist du mein Gott ....................... 7 tief in uns .............................. 116 Bist zu uns wie ein Vater ........... -

„Unterwegs“ 4/2011 (Drei Philosophen Auf Der Suche)
B 1964F ISSN 0930-1313 Nr. 4/2011 Die Mitgliederzeitung des Deutschen Katecheten-Vereins e.V. des steinernen Podestes entspannt niederge- Um den Fels mit seiner Lichtgrotte würdigen Thema lassen. Die Werkzeuge eines Geometers hält er zu können, muss man wissen, dass das Bild untätig in den Händen und blickt nach oben. am linken Rand „stark beschnitten“ ist, der Seine ganze Aufmerksamkeit gilt einer Erschei- zerklüftete Fels ursprünglich also dominanter Drei Philosophen nung im dunklen Felsen über ihm. Dort öffnet gewirkt hat. Damit gewinnt der Betrachtungs- sich eine lichterfüllte Grotte. Ein Licht, das gegenstand des Jüngsten an Bedeutung. auf der Suche nicht von der Sonne erzeugt sein kann, denn die versinkt gerade im Westen am blauen Ho- Ausdeuten rizont hinter den Philosophen. Das geheim- Drei Geistesgrößen unterwegs. Wer sind sie? Könnte es sich bei den drei „Weisen“ um nisvolle Licht in der östlichen Felsgrotte muss die „Heiligen Drei Könige“ des Evangeliums Was suchen sie am Waldrand? In der ersten „ganz anderer“ Art sein... Erwähnung des Giorgione-Gemäldes (1525) (Mt 2,1-12) handeln? Das ist nicht zwingend, wird es „Die drei Philosophen“ benannt, und Hingebungsvoll schaut der junge Mann auf zu aber jedenfalls ist Giorgiones Bild offen auch bei diesem Bildtitel ist es geblieben. Sind dem Phänomen, das sich ihm darbietet. Urbild für diese Deutung. Sie hat bis heute immer historische Vertreter kosmischer Gelehrsam- eines Schülers, dem mitten im Beobachtungs- wieder prominente, seriös argumentierende und Lerngeschäft eine neue Erkenntnis auf- Befürworter gefunden. Als das Gemälde 1932 keit gemeint? Sind die Gestalten allegorisch geht, „in a silent moment of spiritual awake- geröntgt wurde, zeigte sich, dass die erste Ver- zu deuten? „Inhaltliche Deutung umstritten“, ning“, wie man gemeint hat. -

Kirchen Musikalische Mi Eilungen
KIRCHEN MUSIKALISC HE MI EILUN GEN Nr. 143 AP RI L 2 01 8 Stuttgart Leutkirch Ellwangen DIÖZE SE RO ENBURG- STU GART ISSN 143 6- 0276 Inhaltsverzeichnis Liturgie aktuell 2 Gerhard Schneider , Leiter der neu geformten Hauptabteilung Liturgie St. Meinrad-Weg 6 · 72108 Rottenburg (mit Kunst und Kirchenmusik) und Berufungspastoral Telefon (07472) 169 953 Predigt im Pontifikalrequiem für Domkapitular em. Prälat Dr. Werner Groß † 31. Mai 2017 Telefax (07472) 169 955 • Bischof Dr. Gebhard Fürst www.amt-fuer-kirchenmusik.de Bürozeiten Jutta Steck 4 Verordnetes Schweigen oder erfüllte Stille? Vom Klang der Fastenzeit • Tobias Wittmann Mo-Fr: 8.00 – 12.00 Uhr 5 Zur Klanggestalt des Hochgebetes • Walter Hirt Mo: 14.00 – 16.00 Uhr Schwerpunktthema Leiter des Amtes für Kirchenmusik Diözesanmusikdirektor Walter Hirt 13 Teilbibliographie zu Prälat Dr. Werner Groß • Georg Ott-Stelzner e-Mail: [email protected] Stellvertretender Leiter des Amtes Aus der Praxis für Kirchenmusik · Fachstelle für das 18 Chornotenrecherche leicht(er) gemacht!?! • Regionalkantor Thomas Gindele Glockenwesen: Prof. Dr. Hans Schnieders Telefon (07472) 169 952 22 Hallo, Vermittlung? • Reiner Schulte N e-Mail: [email protected] E G N U L I Mitteilungen E Bürozeiten T T I Kirchenmusik: Mo und Do Vormittag M Glockenwesen: Di und Fr Vormittag 23 Amt für Kirchenmusik 30 Diözesancäcilienverband Roman Schmid 34 Pueri cantores Betreuung des Glockenwesens 35 Hochschule für Kirchenmusik Telefon: (07472) 169 956 36 Andere Institutionen e-Mail: [email protected] Bürozeiten: Mo und Di, -

Gottes- Dienst War Ein Zentrales Anliegen Des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65)
Hintergründe ∙ Geschichten ∙ Erklärungen zu einigen Kirchenliedern zusammengestellt von Beat Grögli und illustriert von Sophia Bihler 1 Weisst du auch, was du singst? Kirchenlieder erzählen Geschichten. Sie sind in einem bestimmten Kontext entstanden, sind verbunden mit den kulturellen und gesell- schaftlichen Strömungen ihrer Zeit, haben sich entwickelt und wurden neuen Begebenheiten angepasst. Wer etwas davon weiss, wird sie mit mehr Gewinn singen. In der Apostelgeschichte (8,30) fragt der Apostel Philippus einen Jerusa- lem-Wallfahrer, neben dessen Wagen er hergeht und der im Buch des Propheten Jesaja liest: Weisst du auch, was du liest? Die Erklärungen des Apostels erschliessen dem anderen den Sinn der Heiligen Schrift. Diese kleine Broschüre möchte eine Hilfe sein bei der Frage: Weisst du auch, was du singst? Kirchenlieder sind nicht verstaubt und langweilig, sondern spannend und schön! Die Erklärungen in dieser Broschüre sind kurz. Das hängt damit zusam- men, dass ich sie zuerst für den Anschlagkasten in der Wallfahrtskirche Heiligkreuz verfasste. Mehr als zwei Seiten Text hatten dort nicht Platz! Ich musste mich auf einige wesentliche Punkte konzentrieren. Eine weitere Einschränkung ist die Auswahl der Lieder, die ausschliesslich aus dem Katholischen Gesangbuch (KG) stammen. Die Darstellung folgt der dortigen Nummerierung. Eine grosse Hilfe bei der Zusammenstellung dieser Erläuterungen war mir das Buch Geistliches Wunderhorn. Grosse deutsche Kirchenlieder (im Folgenden abgekürzt mit GW), das 2001 im C.H. Beck-Verlag erschienen ist. Wer sich weiter vertiefen will, ist dort gut bedient. Herzlich danke ich Sophia Bihler aus dem Heiligkreuz für die Illustra- tionen, die sie mit jugendlichem Elan ins Werk gesetzt hat. St. Gallen, am Gedenktag der heiligen Cäcilia, 22. -

Impulse Zum Beten Kleine Pause Start in Den
Da formte Gott, der Herr, den Menschen, Staub vom Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet Erdboden, und blies in seine Nase den Lebensatem. finden; klopft an und es wird euch geöffnet! Denn wer So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer Genesis, 2,7 anklopft, dem wird geöffnet. Matthäus 7, 7-8 Start Start in den Tag Kleine Pause im namen des vaters Beten die welt betrachten indem man atmet die schöpfung die Augen schließt behutsam in die hände nehmen sich verwahrt das staunen üben sich auftut und schaut plant organisiert im namen des sohnes es gut machen will Nacht: Impulse zum Beten die Sache einrenkt die menschen wahrnehmen warmherzig und mit güte weiterdenkt mit ehrlichkeit Beten im Gehen und mit zärtlichkeit auf eigenen Beinen in und mit dieser Welt im namen des heiligen geistes das evangelium leben Arbeit als Gebet kirche lebendig machen die Phantasie und die Hoffnung die zukunft gestalten die Aufmerksamkeit mit vertrauen und freude der innere Ruck Vom Morgen bis zur das Telefongespräch am Schreibtisch Susanne Körber beim coffee to go Beten im Alltag in allem und jedem zu Hause das Glück duesseldorf.de das Glas in der Hand - Umarmung Gebet mit der Haut mit den Fingern der Zunge flingern - Gebet der Zärtlichkeit Beten jeden Tag neu der graue Morgen der Regentag und die Sonne im Herbst Als pdf verfügbar unter: verfügbar Als pdf www.katholisches und ach Gott einfach nur so und doch einfach Vertrauen einfach du Gott nach Lothar Zenetti, Beten durch die Schallmauer, S.25 Zachäus suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch Ich, ich selber werde meine Schafe weiden und ich, ich Er lässt deinen Fuß nicht wanken; er, der dich behütet, er konnte es nicht wegen der Menschenmenge; denn er selber werde sie ruhen lassen - Spruch GOTTES, des schläft nicht. -

19-11-30 Programm SKM 1030 (Fortlaufend)
Der Eintritt zu den Stunden der Kirchenmusik ist frei. Wir bitten Sie herzlich um Ihren großzügigen Beitrag zur Finanzierung der Stunde der Kirchenmusik (Richtwert 10 €). Auch für Spenden sind wir sehr dankbar. Spendenkonto der Kilianskirche Heilbronn Evangelischen Kirchenpflege Heilbronn DE47 6205 0000 0000 0031 62 HEISDE66XXX; Stichwort „Kirchenmusik Kilianskirche Heilbronn“. Spendenquittungen werden zugesandt. Herzliche Einladung zu unseren nächsten Veranstaltungen: 1. Advent, 1. Dezember, 9:30 Uhr - Kantaten-Gottesdienst Stunde der Kirchenmusik Mittwoch, 4. Dezember, 20 Uhr – Gedenkkonzert am 75. Jahrestag der Zerstörung Heilbronns mit dem Philharmonischen Chor HN Samstag, 30. November 2019 Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis (1030) Samstag, 7. Dezember, 18 Uhr – Stunde der Kirchenmusik Kammerchor der Hochschule für Künste Bremen Wie schön leuchtet der Morgenstern Sonntag, 8. Dezember, 2. Advent, 10 Uhr – Gedenk-Gottesdienst Landesbischof Dr. Frank Otfried July, Vokalensemble Heilbronn Sonntag, 8. Dezember, 2. Advent, 17 Uhr – Oratorienkonzert Heinrich-Schütz-Chor Heilbronn – Saint-Saëns: Oratorio de Noël Samstag, 14. Dezember, 18-19 Uhr – Stunde der Kirchenmusik (1032) Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr – Oratorienkonzert Maranatha Bach: Weihnachtsoratorium, Kantaten I-III Bach-Chor Kilianskirche Heilbronn Jugendchor der Kilians- & Friedensgemeinde Orchester Ensemble Operino auf historischen Instrumenten Collegium Musicum Kilianskirche Tabea Schmidt (Sopran), Sigrun Bornträger (Alt), Christian Georg (Tenor), Kai Preußker (Bass), Leitung: KMD Stefan Skobowsky Samstag, 21. Dezember, 18 Uhr – Stunde der Kirchenmusik (1033) - Adventssingen ************ Wir laden ein zur Orgelmusik zur Marktzeit in der Kilianskirche jeden Samstag 11 Uhr bis etwa 11.30 Uhr – Eintritt frei! Sie finden das Programm der Stunde der Kirchenmusik freitags als PDF unter: http://www.kirchenmusik-heilbronn.de/veranstaltungen/stunde-der-kirchenmusik/ Stunde der Kirchenmusik ************ Samstag, 30. -
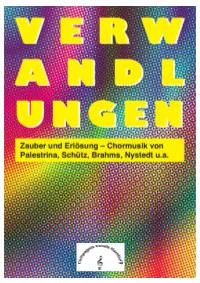
CV Programm 2017.Pdf
- 2 - Inhalt • Programm............................................................................. 4 • Texte mit Übersetzungen........................................................ 5 • Angaben zu den Komponisten............................................... 10 • Informationen zu Chorleiter und Chor..................................... 14 - 3 - Verwandlungen Seit Urzeiten fasziniert den Menschen die Vorstellung der Verwandlung: Der Gläubige hofft auf die geistliche Umwandlung durch Gott; in der Litera- tur, besonders in Sagen und Märchen, begegnen uns Verwandlungen als Fluch und Erlösung, als gerechte Strafe oder Belohnung für unser Tun. Was auch immer wir fürchten oder hoffen: Wir schaffen die Transformation nicht selbst. Es braucht eine besondere Kraft, damit wir anders oder ein an- derer werden – den Glauben an eine höhere Instanz, Zaubertränke, Wun- der. Die Musik selbst ist auf unerklärliche Weise magisch. Sie besitzt die Wirk- macht, uns zu verwandeln, zu verzaubern. Sie dient in unserem Konzert- programm als Medium, um von Verwandlungen zu erzählen und deren in- nere oder äußere Prozesse erlebbar zu machen. - 4 - Programm Giovanni Pierluigi di Palestrina (1525-1594) Sicut cervus Alessandro Scarlatti (1660-1725) Exultate deo Heinrich Schütz (1585-1672) Das ist je gewisslich wahr Rolf Schweizer (1936-2016) Der Herr ist mein Hirte (Psalm 23) Johannes Brahms (1833-1897) Vineta, op.42, 2 Verlorene Jugend, op.104, 4 Knut Nystedt (1915-2014) Die Güte des Herrn Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) Kyrie - Agnus dei aus: Missa in Es (Cantus Missae op.109) für zwei vierstimmige Chöre Ola Gjeilo (geb. 1978) Unicornis captivatur (2001) - 5 - Giovanni Pierluigi di Palestrina Sicut Cervus Sicut cervus desiderat Wie der Hirsch schreit ad fontes aquarum, nach frischem Wasser, ita desiderat anima mea so schreit meine Seele, ad te, Deus. Gott, zu Dir. Alessandro Scarlatti Exultate Deo Exultate Deo, Frohlocket dem Herrn, adiutori nostro. -

Lieder-Liste 140130 Für Geplante Cusic-Mappe Mit Quellen
Inhaltsverzeichnis der geplanten Cusic-Mappe 1-220 (01/2014) Quelle der Vorlage [mit Lied-Nr.] : Kzg. : Kreuzungen [von Martin Müller, Sasbach] E&H : Erdentöne-Himmelsklang [Schwabenv.] SmH : Singt mit Herz [Druck Hartmann, Han.] € pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro …) …) …) …) …) …) …) k+s : kommt und singt [Erzbistum Köln] GL : Neues Gotteslob [Bistümer Deutschlands] LZ : Liederzettel sehr unterschiedlicher Herkunft AnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlder Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen TonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonart : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle KostenKostenKostenKostenKostenKostenKostenKosten(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.- Nr. Liedtitel Quelle Autoren : Text / Musik Copyright ( ggf. Text / Musik ) s = € Bem. Hanna Lam / Wim ter Burg | Verlag G. F. Callenbach, Nijkerk NL | 113 Abraham, Abraham, verlass dein Land k+s 351 1 = dt. Übertr. Diethard Zils Gustav Bosse Verlag, Regensburg 032 Alle Knospen springen auf Kzg 11 Wilhelm Willms / Ludger Edelkötter KIMU Kindermusikverlag GmbH, Pullheim 1 = 143 Amen ! Amen ! Kzg 14 Spiritual 1 4+ 174 Ameni, Amen - All ihr Werke lobt -

Katalog 2019 2 >
Katalog 2019 2 > Wer nicht neugierig ist, singt nichts Neues. Das sind wir > Neue Noten! Digitale Noten! Neugierig? > www.dehm-verlag.de Katalog 2019 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm 3 Das sind wir ... < > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust, und mehr… Der Dehm Verlag ist ein Partner für kreative Köpfe, die ihr musikalisches Schaffen und ihre Ideen in die Öffentlichkeit bringen möchten. Weil uns die Musik am Herzen liegt, weil Musik belebt, verbindet und bewegt, arbeiten wir mit Musiker/innen und Texter/innen stets an neuen Liedern und Chorwerken. Das sind wir > Patrick Dehm Cornelius Dehm Jürgen Kandziora 2019 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm Verleger: Patrick Dehm Dehm Verlag e.K. Rechte & Lizenzen: Cornelius Dehm Auf der Unterheide 40 Notensatz: Jürgen Kandziora 65549 Limburg/Lahn Gestaltung: Ulrike Mahr, Tel. +49 (0) 6431-71905 Mahr Graphic & Performing Arts, Kronach Fax +49 (0) 6431-976016 Preisänderungen, Lieferbarkeit und Irrtümer [email protected] vorbehalten. (Stand: Februar 2019) www.dehm-verlag.de 4 > Das sind wir ... > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust, und mehr… > Notenmaterial und Fortbildung Das ist unser Beitrag, damit sich neue Chöre gründen und bestehende Chöre neue Nahrung finden. Chöre und Kirchengemeinden suchen nach zeitgenössischen Texten und Musik. Das nehmen wir ernst und bieten modernes Notenmaterial an. Das sind wir Um unser Ziel zu erreichen, Chören zu lebendiger Musik und zeitgemäßer Sprache zu > verhelfen, haben wir Seminare mit Tagesworkshops, halbtägigem und ganztägigem offenen Singen und einer einwöchigen Fortbildung entwickelt. Infos zu den Fortbildungen finden sich auf unserer Website www.neuesgeistlicheslied.de. -
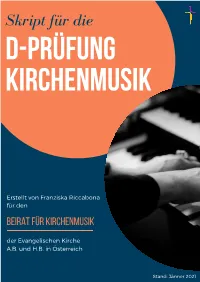
Skript D-Prüfung
Skript für die D-Prüfung Kirchenmusik Erstellt von Franziska Riccabona für den Beirat für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche A.B. und H.B. in Österreich Stand: Jänner 2021 Kirchenmusikalische D-Prüfung der evangelischen Kirche A.B. und H.B. in Österreich ÜBERSICHT PRÜFUNGSFÄCHER: 1. Begleitendes Orgelspiel a) Spielen von Kirchenliedern mit und ohne Pedal nach Choralbuch b) Spielen von liturgischen Stücken c) Auswendigspiel eines Kirchenliedes nach eigener Wahl 2. Selbständiges Orgelspiel a) Spiel einfacher Intonations- und Vorspielliteratur zu Kirchenliedern b) Spiel einfacher freier Orgelliteratur: 2 verschiedenartige Stücke 3. Allgemeine Musikpraxis a) Gehörbildung b) Musiktheorie 4. Theoretische Kenntnisse 4.1 Kenntnis einfacher Orgelliteratur 4.2 Kenntnis des Gesangbuches 4.3 Kenntnis der Gottesdienstordnung 4.4 Elementare Registrierkunde HINWEISE ZU BEWERTUNGSKRITERIEN, FRISTEN & INHALTEN: 1. Begleitendes Orgelspiel Besondere Bewertungskriterien: Tempowahl, Atemführung, Zeilen- und Strophenübergänge. a) Spielen von Kirchenliedern mit und ohne Pedal nach Choralbuch (vorbereitet) Zur Prüfung werden 3 Kirchenlieder mit mindestens zwei Strophen zur Begleitung aufgegeben, darunter ein neues geistliches Lied. Nur in wirklichen Ausnahmefällen kann auf das Pedalspiel gänzlich verzichtet werden. b) Spielen von liturgischen Stücken (vorbereitet). Zur Prüfung werden 4 liturgische Stücke aufgegeben (z.B. Gloria Patri, Heilig, Christe du Lamm Gottes…) c) Auswendigspiel eines Kirchenliedes nach eigener Wahl, ggf. im eigenen Satz. Vorbereitungszeit für a) und b): 1 Woche 2. Selbständiges Orgelspiel a) Spiel einfacher Intonations- und Vorspielliteratur zu Kirchenliedern (vorbereitet). Zu einem der unter Punkt 1.a) aufgegebenen Liedern muss ein Choralvorspiel (= alle Choralzeilen des Chorales werden verarbeitet, länger) erarbeitet werden, zu den beiden anderen je eine Intonation (kürzere Einstimmung auf den Choral, nicht alle Choralzeilen müssen vorkommen). -

Katalog Dehmverlag 2017 DRUCK.Indd
Katalog 2017 2 Neugierig? > Das sind wir ... NEUER Web-Shop! > Chorbücher , Liederbücher, > www.dehm-verlag.de Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, Leselust und mehr… Vielen ist unser breites Verlagsangebot mit modernen Beiträgen zum musika lischen Leben ein Grund, neu oder wieder einzukaufen. Dafür haben wir unseren Onlineshop überarbeitet. Unter www.dehm-verlag.de fi nden sich Notenbeispiele, Inhaltsverzeich- nisse der Bücher, YouTube Videos, Hintergrundinformationen und Rezensionen aus Das sind wir Fachzeitschriften. Wonach gehe ich bei der Auswahl? Immer häufi ger nach Empfehlungen und Kommen- > taren anderer Nutzer. Daher unsere Bitte: Gefällt Ihnen ein Artikel, sagen Sie es wei- ter. Sie helfen damit dem Verlag, den Autoren und unseren gemeinsamen Ideen. Sie fi nden die Buttons für Twitter, Facebook und E-Mail unter jeder Artikelbeschreibung auf unserer Website. Ihre Meinung können Sie auch allen anderen Besucherinnen und Besuchern unseres Web-Shops kundtun. Wenn Sie uns Ihre Rezension zusenden, werden wir diese veröf- Katalog 2017 Katalog fentlichen und Sie erhalten ein Präsent aus unserem Verlagsprogramm. Druckfrisch im neuen Verlagsprogramm sind 10 Neuerscheinungen. Darunter die Messe zum Emmaus-Gang „Feuer im Herzen“ von Helmut Schlegel und Winfried Heurich und die Messe „Lass die Liebe größer werden“ von Elvira und Johann Kreuz- pointner; von Georg Schemberg die Messe „Aus Erde und aus Geist“ und die Gospel- messe „Sing to God“ von Eugen Eckert und Kai Lünnemann. Dehm Verlag Verlag Dehm Ein Chorband zu Hochzeiten und Segnungen der Liebe mit 29 Liedern und Texten unter dem Titel „ Die Segel sind gesetzt“ will entdeckt werden. Neu ist das Pfi ngst-Oratorium„Feuerzungen“ von Eugen Eckert und Peter Reulein und das Oratorium „Laudato si“ von Helmut Schlegel und Peter Reulein sowie eine deutschsprachige mittelalterliche Mottete zum Lied der Liebe „Ich bin eine Blume zu Saron“. -

Und Die Musik Im Gottesdienst? Elemente Musikalischer Gottesdienstgestaltung
Martin Geisz ... und die Musik im Gottesdienst? Elemente musikalischer Gottesdienstgestaltung aus dem Pfarrbrief der Gemeinden St. Michael - Rosbach und St. Jacobus, Ockstadt „Haltepunkt“ 1 2 Inhaltsverzeichnis (1) Der GREGORIANISCHE CHORAL ....................................................................3 (2) Kirchenlieder aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.................................7 (3) nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962-1965): Neues Geistliches Lied.....10 (4) Kompositionen für die Orgel im Gottesdienst aus dem evangelischen Schullehrerseminar und dem Predigerseminar in Friedberg - ein Stück Geschichte aus „500 Jahren Reformation“ aus unserer Region.....................14 (5) J.S. Bach: Matthäuspassion (1727) - Choräle .............................................20 (6) Marianische Antiphonen: Gottesmutter, Mutter der Barmherzigkeit, Maria Himmelskönigin, Meerstern, ...........................................................................22 (7)DOMORGANISTEN KOMPONIEREN FÜR GEMEINDEN - ..............................26 (8) Psalm 23: Der Herr ist mein Hirt - ...............................................................31 (9)Halleluja - ein alter biblischer Jubelruf ....................................35 (10) Nicht nur zu Pfingsten: Lieder zum Heiligen Geist ....................................39 (11) 25 Jahre Orgel in Sankt Michael................................................................43 (12) 50 Jahre Kirchenmusik in Sankt Michael Rosbach ....................................46 (13) Frauen komponieren