Skript D-Prüfung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Music for the Christmas Season by Buxtehude and Friends Musicmusic for for the the Christmas Christmas Season Byby Buxtehude Buxtehude and and Friends Friends
Music for the Christmas season by Buxtehude and friends MusicMusic for for the the Christmas Christmas season byby Buxtehude Buxtehude and and friends friends Else Torp, soprano ET Kate Browton, soprano KB Kristin Mulders, mezzo-soprano KM Mark Chambers, countertenor MC Johan Linderoth, tenor JL Paul Bentley-Angell, tenor PB Jakob Bloch Jespersen, bass JB Steffen Bruun, bass SB Fredrik From, violin Jesenka Balic Zunic, violin Kanerva Juutilainen, viola Judith-Maria Blomsterberg, cello Mattias Frostenson, violone Jane Gower, bassoon Allan Rasmussen, organ Dacapo is supported by the Cover: Fresco from Elmelunde Church, Møn, Denmark. The Twelfth Night scene, painted by the Elmelunde Master around 1500. The Wise Men presenting gifts to the infant Jesus.. THE ANNUNCIATION & ADVENT THE NATIVITY Heinrich Scheidemann (c. 1595–1663) – Preambulum in F major ������������1:25 Dietrich Buxtehude – Das neugeborne Kindelein ������������������������������������6:24 organ solo (chamber organ) ET, MC, PB, JB | violins, viola, bassoon, violone and organ Christian Geist (c. 1640–1711) – Wie schön leuchtet der Morgenstern ������5:35 Franz Tunder (1614–1667) – Ein kleines Kindelein ��������������������������������������4:09 ET | violins, cello and organ KB | violins, viola, cello, violone and organ Johann Christoph Bach (1642–1703) – Merk auf, mein Herz. 10:07 Dietrich Buxtehude – In dulci jubilo ����������������������������������������������������������5:50 ET, MC, JL, JB (Coro I) ET, MC, JB | violins, cello and organ KB, KM, PB, SB (Coro II) | cello, bassoon, violone and organ Heinrich Scheidemann – Preambulum in D minor. .3:38 Dietrich Buxtehude (c. 1637-1707) – Nun komm der Heiden Heiland. .1:53 organ solo (chamber organ) organ solo (main organ) NEW YEAR, EPIPHANY & ANNUNCIATION THE SHEPHERDS Dietrich Buxtehude – Jesu dulcis memoria ����������������������������������������������8:27 Dietrich Buxtehude – Fürchtet euch nicht. -

Gottes- Dienst War Ein Zentrales Anliegen Des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65)
Hintergründe ∙ Geschichten ∙ Erklärungen zu einigen Kirchenliedern zusammengestellt von Beat Grögli und illustriert von Sophia Bihler 1 Weisst du auch, was du singst? Kirchenlieder erzählen Geschichten. Sie sind in einem bestimmten Kontext entstanden, sind verbunden mit den kulturellen und gesell- schaftlichen Strömungen ihrer Zeit, haben sich entwickelt und wurden neuen Begebenheiten angepasst. Wer etwas davon weiss, wird sie mit mehr Gewinn singen. In der Apostelgeschichte (8,30) fragt der Apostel Philippus einen Jerusa- lem-Wallfahrer, neben dessen Wagen er hergeht und der im Buch des Propheten Jesaja liest: Weisst du auch, was du liest? Die Erklärungen des Apostels erschliessen dem anderen den Sinn der Heiligen Schrift. Diese kleine Broschüre möchte eine Hilfe sein bei der Frage: Weisst du auch, was du singst? Kirchenlieder sind nicht verstaubt und langweilig, sondern spannend und schön! Die Erklärungen in dieser Broschüre sind kurz. Das hängt damit zusam- men, dass ich sie zuerst für den Anschlagkasten in der Wallfahrtskirche Heiligkreuz verfasste. Mehr als zwei Seiten Text hatten dort nicht Platz! Ich musste mich auf einige wesentliche Punkte konzentrieren. Eine weitere Einschränkung ist die Auswahl der Lieder, die ausschliesslich aus dem Katholischen Gesangbuch (KG) stammen. Die Darstellung folgt der dortigen Nummerierung. Eine grosse Hilfe bei der Zusammenstellung dieser Erläuterungen war mir das Buch Geistliches Wunderhorn. Grosse deutsche Kirchenlieder (im Folgenden abgekürzt mit GW), das 2001 im C.H. Beck-Verlag erschienen ist. Wer sich weiter vertiefen will, ist dort gut bedient. Herzlich danke ich Sophia Bihler aus dem Heiligkreuz für die Illustra- tionen, die sie mit jugendlichem Elan ins Werk gesetzt hat. St. Gallen, am Gedenktag der heiligen Cäcilia, 22. -
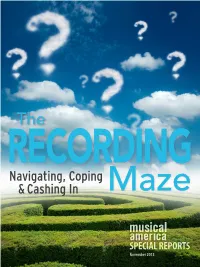
Navigating, Coping & Cashing In
The RECORDING Navigating, Coping & Cashing In Maze November 2013 Introduction Trying to get a handle on where the recording business is headed is a little like trying to nail Jell-O to the wall. No matter what side of the business you may be on— producing, selling, distributing, even buying recordings— there is no longer a “standard operating procedure.” Hence the title of this Special Report, designed as a guide to the abundance of recording and distribution options that seem to be cropping up almost daily thanks to technology’s relentless march forward. And as each new delivery CONTENTS option takes hold—CD, download, streaming, app, flash drive, you name it—it exponentionally accelerates the next. 2 Introduction At the other end of the spectrum sits the artist, overwhelmed with choices: 4 The Distribution Maze: anybody can (and does) make a recording these days, but if an artist is not signed Bring a Compass: Part I with a record label, or doesn’t have the resources to make a vanity recording, is there still a way? As Phil Sommerich points out in his excellent overview of “The 8 The Distribution Maze: Distribution Maze,” Part I and Part II, yes, there is a way, or rather, ways. But which Bring a Compass: Part II one is the right one? Sommerich lets us in on a few of the major players, explains 11 Five Minutes, Five Questions how they each work, and the advantages and disadvantages of each. with Three Top Label Execs In “The Musical America Recording Surveys,” we confirmed that our readers are both consumers and makers of recordings. -

Universi^ International
INFORMATION TO USERS This was produced from a copy of a document sent to us for microfîlming. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the material submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or notations which may appear on this reproduction. 1. The sign or “target” for pages apparently lacking from the document photographed is “Missing Page(s)”. If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the Him along with adjacent pages. This may have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages to assure you of complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a round black mark it is an indication that the film inspector noticed either blurred copy because of movement during exposure, or duplicate copy. Unless we meant to delete copyrighted materials that should not have been filmed, you will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photo graphed the photographer has followed a definite method in “sectioning” the material. It is customary to begin filming at the upper left hand comer of a large sheet and to continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, sectioning is continued again—beginning below the first row and continuing on until complete. 4. For any illustrations that cannot be reproduced satisfactorily by xerography, photographic prints can be purchased at additional cost and tipped into your xerographic copy. -

Buxtehude's Pedaliter Keyboard Works: Organ Or Pedal Clavichord?
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Journals of Faculty of Arts, University of Ljubljana K. J. SNYDER • BUXTEHUDE’S PEDALITER ... UDK 780.8:780.649Buxtehude Kerala J. Snyder Eastman School of Music, University of Rochester Eastmanova akademija za glasbo, Univerza v Rochesterju Buxtehude’s Pedaliter Keyboard Works: Organ or Pedal Clavichord? Buxtehudejeva pedalna dela za instrumente s tipkami: orgle ali pedalni klavikord Prejeto: 13. julij 2011 Received: 13th July 2011 Sprejeto: 9. september 2011 Accepted: 9th September 2011 Ključne besede: Buxtehude, klavikord, orgle, Keywords: Buxtehude, clavichord, organ, peda- izvajanje pedaliter [s pedali] liter [or pedals] performance Iz v l e č e k Ab s t r a c t Članek razpravlja o tem, kako naj bi bil Buxtehude This article explores the questions of how Buxte- uporabljal pedalni klavikord pri pouku, reproduk- hude might have used a pedal clavichord for the ciji in komponiranju, zlasti kar zadeva njegove purposes of teaching, performing, and composing, pedalne (pedaliter) preludije. with special reference to his pedaliter praeludia. On May 23, 1675, Dieterich Buxtehude, organist and Werkmeister of St. Mary’s Church in Lübeck, wrote the following entry into the account book of the church: “Saturday. My highly honored directors, upon my—Dieterich Buxtehude’s— humble request (see Memorial, fol. 75), have graciously granted that a small writing and study room be built onto the Werkhaus, over the steps, facing the church courtyard. And this week [the work] began on it.”1 These two positions, one artistic, the other administrative, had been combined at St. -

Baroque and Classical Style in Selected Organ Works of The
BAROQUE AND CLASSICAL STYLE IN SELECTED ORGAN WORKS OF THE BACHSCHULE by DEAN B. McINTYRE, B.A., M.M. A DISSERTATION IN FINE ARTS Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Approved Chairperson of the Committee Accepted Dearri of the Graduate jSchool December, 1998 © Copyright 1998 Dean B. Mclntyre ACKNOWLEDGMENTS I am grateful for the general guidance and specific suggestions offered by members of my dissertation advisory committee: Dr. Paul Cutter and Dr. Thomas Hughes (Music), Dr. John Stinespring (Art), and Dr. Daniel Nathan (Philosophy). Each offered assistance and insight from his own specific area as well as the general field of Fine Arts. I offer special thanks and appreciation to my committee chairperson Dr. Wayne Hobbs (Music), whose oversight and direction were invaluable. I must also acknowledge those individuals and publishers who have granted permission to include copyrighted musical materials in whole or in part: Concordia Publishing House, Lorenz Corporation, C. F. Peters Corporation, Oliver Ditson/Theodore Presser Company, Oxford University Press, Breitkopf & Hartel, and Dr. David Mulbury of the University of Cincinnati. A final offering of thanks goes to my wife, Karen, and our daughter, Noelle. Their unfailing patience and understanding were equalled by their continual spirit of encouragement. 11 TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS ii ABSTRACT ix LIST OF TABLES xi LIST OF FIGURES xii LIST OF MUSICAL EXAMPLES xiii LIST OF ABBREVIATIONS xvi CHAPTER I. INTRODUCTION 1 11. BAROQUE STYLE 12 Greneral Style Characteristics of the Late Baroque 13 Melody 15 Harmony 15 Rhythm 16 Form 17 Texture 18 Dynamics 19 J. -

Und Die Musik Im Gottesdienst? Elemente Musikalischer Gottesdienstgestaltung
Martin Geisz ... und die Musik im Gottesdienst? Elemente musikalischer Gottesdienstgestaltung aus dem Pfarrbrief der Gemeinden St. Michael - Rosbach und St. Jacobus, Ockstadt „Haltepunkt“ 1 2 Inhaltsverzeichnis (1) Der GREGORIANISCHE CHORAL ....................................................................3 (2) Kirchenlieder aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.................................7 (3) nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962-1965): Neues Geistliches Lied.....10 (4) Kompositionen für die Orgel im Gottesdienst aus dem evangelischen Schullehrerseminar und dem Predigerseminar in Friedberg - ein Stück Geschichte aus „500 Jahren Reformation“ aus unserer Region.....................14 (5) J.S. Bach: Matthäuspassion (1727) - Choräle .............................................20 (6) Marianische Antiphonen: Gottesmutter, Mutter der Barmherzigkeit, Maria Himmelskönigin, Meerstern, ...........................................................................22 (7)DOMORGANISTEN KOMPONIEREN FÜR GEMEINDEN - ..............................26 (8) Psalm 23: Der Herr ist mein Hirt - ...............................................................31 (9)Halleluja - ein alter biblischer Jubelruf ....................................35 (10) Nicht nur zu Pfingsten: Lieder zum Heiligen Geist ....................................39 (11) 25 Jahre Orgel in Sankt Michael................................................................43 (12) 50 Jahre Kirchenmusik in Sankt Michael Rosbach ....................................46 (13) Frauen komponieren -

Pieter Dirksen, Heinrich Scheidemann's Keyboard Music
Pieter Dirksen, Heinrich Scheidemann’s Keyboard Music PIETER DIRKSEN, HEINRICH SCHEIDEMANN’S KEYBOARD MUSIC: TRANSMISSION, STYLE AND CHRONOLOGY (Aldershot: Ashgate, 2007), ISBN 978-0-7546-5441-4, xxiii + 254 pp, £55/ $99.95 During the early years of the seventeenth century, at least twelve German musicians that we know of, including Scheidt, Scheidemann, Jacob Praetorius, Melchior Schildt and Paul Siefert, travelled to Amsterdam to study with Sweelinck, their extant key- board works testifying to the Dutch composer’s influence. In his collection of bio- graphies—the Ehren-Pforte—of 1740, Mattheson famously compared the personalities of two of these Sweelinck pupils, Praetorius and Scheidemann, noting the particular attractiveness of the latter’s character and music, best captured in the phrase ‘Scheide- mannische Liebligkeit’.1 Despite his being a prominent student of the Dutch master and a founding father of the north-German organ school, however, Scheidemann has been largely neglected by scholars hitherto. Pieter Dirksen’s fine study, which appeared during ‘Buxtehudejahr’ and forty years after the publication of Werner Breig’s seminal monograph, Die Orgelwerke von Heinrich Scheidemann, is thus a wel- come addition to the literature on the Hamburg composer whom Dirksen believes to have been ‘Sweelinck’s most independent pupil’.2 A Sweelinck scholar and performer, Dirksen has written much on north-German keyboard music of the Baroque and on J. S. Bach. Having already produced an edition of Scheidemann’s complete harpsichord music in 2000 (Edition Breitkopf 8688), he offers a rich fare to musicologists, organologists and performers in this dense but rewarding volume. Tripartite in structure, the book’s first section (chapters 1–6) examines the transmission of Scheidemann’s keyboard music, presenting an in-depth analysis of each of the manuscript sources, which date from all phases of the composer’s career and even up to 20 years after his death. -

CONVERSATIONS AVEC DIEU MOTETS ET CANTATES DE HAMMERSCHMIDT, TELEMANN, BRUHNS, SCHEIDT… LE CONCERT ÉTRANGER - ITAY JEDLIN Director Label Managers Editorial Assistant
CONVERSATIONS AVEC DIEU MOTETS ET CANTATES DE HAMMERSCHMIDT, TELEMANN, BRUHNS, SCHEIDT… LE CONCERT ÉTRANGER - ITAY JEDLIN Director Label managers Editorial assistant Recorded at Recording producer, recording engineer, editing, mixing & mastering Cover photograph & design Booklet layout Booklet photo credits Printers 1 CONVERSATIONS AVEC DIEU MOTETS ET CANTATES DE HAMMERSCHMIDT, TELEMANN, BRUHNS, SCHEIDT… LE CONCERT ÉTRANGER – ITAY JEDLIN 1 Georg Philipp Telemann (1681-1767) 9’01 Cantate Ach, Herr, straf mich nicht in deinem Zorn. (Psaume 6, TWV 7:3) Pour quatre voix, violons, alto et basse continue. 2 Heinrich Scheidemann (1595-1663) 2’12 Erbarm dich mein, o Herre Gott. Choral pour orgue, verset 1. 3 Andreas Hammerschmidt (1611-1675) 4’54 Psaume 51 Erbarm dich mein, o Herre Gott. Choral pour 2 sopranos, alto, ténor, basse et basse continue – Musikalische Andachten II, 1641. 4 Heinrich Scheidemann 2’57 Erbarm dich mein, o Herre Gott. Choral pour orgue, verset 2. 5 Andreas Hammerschmidt 5’05 Première pavane à 5. 6 Andreas Hammerschmidt 4’46 Ach Gott, warum hast du mein vergessen? Dialogue à 4 voix, un instrument et basse continue – Dialogi, 1645. 7 Johann Rosenmüller (1619-1684) 4’25 Sinfonia XI, pour cordes Sonate da camera e sinfonia, 1667. 2 8 Andreas Hammerschmidt 5’17 Herr, wie lange willst du mein so gar vergessen ? Psaume 13, pour 2 sopranos, alto, ténor et basse – Musikalische Andachten II, 1641. 9 Heinrich Scheidemann 2’39 Praeludium en ré, pour orgue. 10 Andreas Hammerschmidt 4’18 Ergo sit nulla ratio salutis Motet pour soprano et basse continue – Motettae, unius et duarium vocum, 1649. 11 Claudio Monteverdi (1567 – 1643) 1’18 Sinfonia 12 Samuel Scheidt (1587-1654) 6’18 Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn? Motet pour 2 sopranos, alto, 2 ténors, basse et basse continue – Geistliche Concerte II, 1634. -

Inhaltsverzeichnis Nr. Liedtitel Eröffnung 1 Dir Sollen Täler Vor Freude Singen 2 All Meine Quellen Entspringen in Dir 3 Auf Z
Inhaltsverzeichnis Nr. Liedtitel Eröffnung 1 Dir sollen Täler vor Freude singen 2 All meine Quellen entspringen in dir 3 Auf zu neuen Horizonten 4 Aus den Dörfern und Städten 5 Andere Lieder wollen wir singen 6 Wir loben dich, Gott, im Tanzen des Windes 7 begegnung 8 Die Kunst des Lobens 9 caminando va 10 Damit wir Hoffnung haben 11 Wir sind zusammen unterwegs (K) 12 Eines neuen Lebens wert 13 Wo die Liebe wohnt (K) 14 Da findet Kirche statt 15 Jetzt ist die Zeit 16 Komm herein und nimm dir Zeit 17 Der Himmel, der ist 18 Die Zeit zu beginnen 19 Die Sache Jesu braucht Begeisterte 20 Dies Haus aus Stein 21 Dir zu singen, dir zu spielen 22 Unsere Hoffnung bezwingt die schwarze Angst 23 Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt 24 Wisst ihr nicht / Singt mir Lob 25 Wo zwei oder drei 26 Eingeladen zum Fest des Glaubens 27 in gottes gutem namen 28 Gemeinde sein 29 Gott deine Liebe reicht weit 30 Nah bei dir suchen wir ein Zuhaus 31 Einmal werden unsre Träume wahr 32 Halte deine Träume fest 33 Wir sind eingeladen zum Fest 34 Hinter allen Masken 35 Here we are 36 Farbigkeit steckt an 37 Zeit haben – Habe ich ein wenig Zeit 38 Komm, du Quelle des Lebens 39 Ich steh vor dir mit leeren Händen 40 In dieser Welt baust du dein Haus (K) 41 Unser Leben sei ein Fest 42 Wie mit neuen Augen 43 In deinen Händen steht die Zeit 44 Ihr seid Christi Wohlgeruch 45 Ins Wasser fällt ein Stein 46 In unsre Herzen 47 Wir haben Gottes Spuren festgestellt 48 Wir sind willkommen, ihm jetzt nachzufolgen 49 Sei du bei uns 50 Sei gesegnet 51 Was ist dem Menschen heilig? 52 Vor -

Sacred German Music in the Thirty Years'
Musical Offerings Volume 3 Number 1 Spring 2012 Article 1 2012 Sacred German Music in the Thirty Years’ War Brandi Hoffer Cedarville University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.cedarville.edu/musicalofferings Part of the History Commons, and the Musicology Commons DigitalCommons@Cedarville provides a publication platform for fully open access journals, which means that all articles are available on the Internet to all users immediately upon publication. However, the opinions and sentiments expressed by the authors of articles published in our journals do not necessarily indicate the endorsement or reflect the views of DigitalCommons@Cedarville, the Centennial Library, or Cedarville University and its employees. The authors are solely responsible for the content of their work. Please address questions to [email protected]. Recommended Citation Hoffer, Brandi (2012) "Sacred German Music in the Thirty Years’ War," Musical Offerings: Vol. 3 : No. 1 , Article 1. DOI: 10.15385/jmo.2012.3.1.1 Available at: https://digitalcommons.cedarville.edu/musicalofferings/vol3/iss1/1 Sacred German Music in the Thirty Years’ War Document Type Article Abstract The religious and political turmoil of the Thirty Years’ War significantly impacted the performance and preservation of sacred Baroque music in the German lands. Conflict between the Catholics and Protestants created an unstable social environment, which resulted in a myriad of responses from composers and performers. Leading composers including Heinrich Schütz, Michael Praetorius, Thomas Selle, and Heinrich Scheidemann, expressed their values either overtly or implicitly depending upon their occupational, geographical, political, and religious positions. Research indicates that the influences of the Thirty Years’ War created an ideal environment for the flourishing of the following German music in the late Baroque Era. -

Composers for the Pipe Organ from the Renaissance to the 20Th Century
Principal Composers for the Pipe Organ from the Renaissance to the 20th Century Including brief biographical and technical information, with selected references and musical examples Compiled for POPs for KIDs, the Children‘s Pipe Organ Project of the Wichita Chapter of the American Guild of Organists, by Carrol Hassman, FAGO, ChM, Internal Links to Information In this Document Arnolt Schlick César Franck Andrea & Giovanni Gabrieli Johannes Brahms Girolamo Frescobaldi Josef Rheinberger Jean Titelouze Alexandre Guilmant Jan Pieterszoon Sweelinck Charles-Marie Widor Dieterich Buxtehude Louis Vierne Johann Pachelbel Max Reger François Couperin Wilhelm Middelschulte Nicolas de Grigny Marcel Dupré George Fredrick Händel Paul Hindemith Johann Sebastian Bach Jean Langlais Louis-Nicolas Clérambault Jehan Alain John Stanley Olivier Messiaen Haydn, Mozart, & Beethoven Links to information on other 20th century composers for the organ Felix Mendelssohn Young performer links Fanny Mendelssohn Hensel Pipe Organ reference sites Camille Saint-Saëns Credits for Facts and Performances Cited Almost all details in the articles below were gleaned from Wikipedia (and some of their own listed sources). All but a very few of the musical and video examples are drawn from postings on YouTube. The section of J.S. Bach also owes credit to Corliss Arnold’s Organ Literature: a Comprehensive Survey, 3rd ed.1 However, the Italicized interpolations, and many of the texts, are my own. Feedback will be appreciated. — Carrol Hassman, FAGO, ChM, Wichita Chapter AGO Earliest History of the Organ as an Instrument See the Wikipedia article on the Pipe Organ in Antiquity: http://en.wikipedia.org/wiki/Pipe_Organ#Antiquity Earliest Notated Keyboard Music, Late Medieval Period Like early music for the lute, the earliest organ music is notated in Tablature, not in the musical staff notation we know today.