Neueste Geschichte Inauguraldissertation Zur Erlang
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MIP 2015 Parteipolitisierung Der Sächsischen Kommunalpolitik 21
Mitteilungen DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHES UND INTERNATIONALES PARTEIENRECHT UND PARTEIENFORSCHUNG Aus dem Inhalt Dipl.-Pol. Thomas Bathge/Caroline Friedhoff, M.A. Soz./Prof. Dr. Lars Holtkamp Innerfraktionelle Geschlossenheit in bundesdeutschen Kommunalparlamenten Sven Jürgensen Die Nachprüfbarkeit von Parteiausschlussentscheidungen in Verfahren vor staatlichen Gerichten Dr. Johannes Risse Die Entscheidungen des Bundeswahlausschusses zur Bundestagswahl 2013 und zur Europawahl 2014 Sara Y. Ceyhan, M.A. Eine Frage der politischen Ebene? − Parlamentskandidaten mit Migrations- hintergrund auf Bundes- und Landesebene Simon Bogumil Erfolg und Misserfolg der populistischen radikalen Rechten in Deutschland und Europa. Eine Ursachenanalyse Julien Neubert, M.A. Treibender oder getriebener Akteur? Der programmatische Wandel Labours und der SPD in der Opposition Deniz Anan National, liberal, konservativ, populistisch? Die Programmatik der AfD Michael Angenendt, M.A. Kooperation oder Konflikt? Vorzeitige Regierungsbeendigungen und elektorale Performanz in Westeuropa Dipl. Pol. Tobias Fuhrmann, M.A. Kommunale Konkordanzdemokratie in Sachsen. Eine Untersuchung der MIP 2015 Parteipolitisierung der sächsischen Kommunalpolitik 21. Jahrgang Michael Dürr, M.A. ISSN 2192-3833 Same same but different? – Ein Vergleich langjähriger und neueingetretener Parteimitglieder von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg Dr. Andrea De Petris Herausgegeben vom Wieder am Ziel vorbei? Aktueller Stand und neue Entwicklungen der Parteien- Institut für Deutsches finanzierung -

Doktorarbeit Ges. Veröff. Stand 13.06.2017
Die Deutschlandpolitik der CSU Vom Beginn der sozial-liberalen Koalition 1969 bis zum Ende der Zusammenarbeit mit der DSU 1993 Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Fakultät für Philosophie, Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften der Universität Regensburg vorgelegt von Stephan Oetzinger aus Mantel Regensburg 2016 Gutachter (Betreuer): Prof. Dr. Peter Schmid Gutachter: Prof. Dr. Bernhard Löffler Vorwort Die Umsetzung und Abfassung eines Dissertationsprojekts bedarf vielfältiger Unterstützung. Daher ist es mir eine angenehme Pflicht all jenen zu danken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. An erster Stelle gilt mein besonderer Dank Herrn Prof. Dr. Peter Schmid für die kontinuierliche Betreuung und Begleitung der Arbeit durch zahlreiche Anregungen. Ebenso herzlich danke ich Herrn Prof. Dr. Bernhard Löffler für die Übernahme der Zweitkorrektur. Bedanken möchte ich mich bei der Hanns-Seidel-Stiftung für die Gewährung eines Promotionsstipendiums sowie meinen Eltern, Irmgard und Peter Oetzinger, ohne deren finanzielle Unterstützung die Arbeit an diesem Projekt nicht möglich gewesen wäre. Mein Dank gilt weiterhin allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der von mir genutzten Archive für die Betreuung. Kraft und Motivation für die abschließende Fertigstellung des Projekts durfte ich bei meiner Familie schöpfen. Insbesondere für die Ermunterung und ihre Rücksichtnahme möchte ich mich daher bei meiner Frau Barbara und unserem Sohn Franz ganz herzlich bedanken, ohne deren Rückhalt das Projekt nicht zu einem guten Ende hätte kommen können. Diese Unterstützung ist von umso größerer Bedeutung, als dass die Arbeit über den größten Teil des Bearbeitungszeitraums berufsbegleitend entstanden ist. Mantel, im Juni 2017 Stephan Oetzinger Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 7 1.1 Hinführung zum Thema 7 1.2 Vorgehensweise 9 1.3 Forschungsstand 10 1.4 Quellenlage 12 2. -

The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria
P1: JZZ 0521856833pre CUNY200B/Art 0521856833 October 7, 2005 21:45 This page intentionally left blank P1: JZZ 0521856833pre CUNY200B/Art 0521856833 October 7, 2005 21:45 The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria This book argues that Germans and Austrians have dealt with the Nazi past very differently and that these differences have had important con- sequences for political culture and partisan politics in the two countries. Drawing on different literatures in political science, David Art builds a framework for understanding how public deliberation transforms the political environment in which it occurs. The book analyzes how public debates about the “lessons of history” created a culture of contrition in Germany that prevented a resurgent far right from consolidating itself in German politics after unification. By contrast, public debates in Austria nourished a culture of victimization that provided a hospitable environ- ment for the rise of right-wing populism. The argument is supported by evidence from nearly 200 semistructured interviews and an analysis of the German and Austrian print media over a twenty-year period. David Art is an assistant professor of political science at the College of the Holy Cross. He teaches courses in European politics, international relations, and globalization. He received his B.A. from Yale University and his Ph.D. from the Massachusetts Institute of Technology. His cur- rent research focuses on the development of right-wing populist parties in comparative and historical perspective. i P1: -
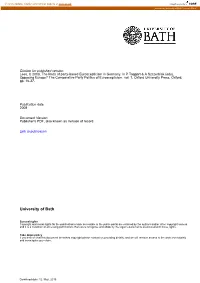
University of Bath Research Portal
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Bath Research Portal Citation for published version: Lees, C 2008, The limits of party-based Euroscepticism in Germany. in P Taggart & A Szczerbiak (eds), Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism. vol. 1, Oxford University Press, Oxford, pp. 16-37. Publication date: 2008 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication University of Bath General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 12. May. 2019 02-Taggart-I-c02 OUP174-Taggart-vol-I (Typeset by spi publisher services, Delhi) 16 of 37 September 12, 2007 9:6 2 The Limits of Party-Based Euroscepticism in Germany Charles Lees 2.1 INTRODUCTION Germany is not renowned for its Euroscepticism—party-based or otherwise. In fact, the Federal Republic has traditionally been considered the Musterknabe (model boy) of the European Union (EU). It has enjoyed a stable elite consensus around the European project, with broad cross-party agreement over the desir- ability of pooled political sovereignty and increased economic interdependence (Paterson 1996; Rheinhardt 1997; Peters 2001). This orthodoxy tended to be bol- stered by a relatively compliant media; a permissive consensus amongst the general public; institutions and norms of governance that are analogous to the EU’s; a strong manufacturing and banking sector that has benefited from the opening up of European markets; and an ingrained reluctance amongst the political class to engage in populist politics on the issue of Europe. -

Wer Steht Zur Wahl?
Parteiprofile Wer steht zur Wahl? bpb.de Parteiprofile: Wer steht zur Wahl? (Erstellt am 05.04.2016) 2 Einleitung Bei Bundestags-, Landtags- und Europawahlen bietet "Wer steht zur Wahl?" eine kompakte Übersicht: Welche Parteien treten an? Welche Positionen zeichnen die Parteien aus? Und was sind die Besonderheiten der einzelnen Parteien? Hier finden Sie die Parteiprofile der vergangenen Wahlen. bpb.de Parteiprofile: Wer steht zur Wahl? (Erstellt am 05.04.2016) 3 Inhaltsverzeichnis 1. Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 12 1.1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 13 1.2 DIE LINKE (DIE LINKE) 15 1.3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 17 1.4 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 19 1.5 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 21 1.6 Freie Demokratische Partei (FDP) 22 1.7 Landesvereinigung FREIE WÄHLER Sachsen-Anhalt (FREIE WÄHLER) 23 1.8 Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) 24 1.9 Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA) 25 1.10 Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) 26 1.11 Alternative für Deutschland (AfD) 27 1.12 DIE RECHTE (DIE RECHTE) 28 1.13 Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM) 29 1.14 Partei fu r Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenfo rderung und basisdemokratische Initiative 30 (Die PARTEI) 1.15 Magdeburger Gartenpartei (MG) 31 1.16 Redaktion 32 2. Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 33 2.1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 34 2.2 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 35 2.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 36 2.4 Freie Demokratische Partei (FDP) 37 2.5 DIE LINKE (DIE LINKE) 38 2.6 FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz (FREIE WÄHLER) 39 2.7 Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) 40 2.8 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 41 2.9 DIE REPUBLIKANER (REP) 42 2.10 Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) 43 bpb.de Parteiprofile: Wer steht zur Wahl? (Erstellt am 05.04.2016) 4 2.11 Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA) 44 2.12 Alternative für Deutschland (AfD) 45 2.13 DER DRITTE WEG (III. -

Zum Findbuch Der CSU-Parteitage 1946-2000
CSU-Parteitage 1946-2000 1946-2000 CSU-Parteitage R E P E R T O R I U M C S U – P A R T E I T A G E 1 9 4 6 – 2 0 0 0 R E P E R T O R I U M bearbeitet von Andreas Bitterhof C S U - L A N D E S V E R S A M M L U N G E N 1946 – 1968 CSU-Landesversammlung 1965 Foto: Slomifoto C S U - L A N D E S P A R T E I T A G E 1955, 1957, 1958, 1965 CSU-Landesparteitag 1958 Einladung C S U - P A R T E I T A G E 1968 - 2000 CSU-Parteitag 2000 Foto: Faces by Frank München, im Juni 2010 V O R B E M E R K U N G Der ursprünglich ca. 30, nach der Bearbeitung 12,5 laufende Meter umfassende Bestand CSU-Landesversammlungen/Parteitage (PT) von 1946 bis 2000 wurde in den Jahren 2009 und 2010 bearbeitet. Die Landesversammlungen/Parteitage bestehen u.a. aus dem Parteivorstand sowie Delegierten der Bezirks- und Kreisverbände, werden ein bis zweimal im Jahr ein- berufen und dauern ein bis drei Tage. Die wichtigsten Aufgaben sind Beratungen und Beschlussfassungen über die Grundlinien der Politik der CSU, über Grund- satzprogramme und Statuten; außerdem wird alle zwei Jahre die Parteiführung gewählt. Nachdem im Jahr 1968 mit einer neuen Satzung der demokratische Or- ganisationsaufbau und das Mitwirkungsrecht der Mitglieder erweitert und ver- stärkt wurden, kam es zur Umbenennung der Landesversammlungen in Parteitage. -

3 2.3 Benennungen Als Strategische Kampfzone: Behandelt Diese Arbeit Einen Rechtsextremen Forschungsgegenstand?
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung .............................................................................................................................................. 2 2. Forschungsüberblick .............................................................................................................................. 8 2.1 Geschichtswissenschaft als politische Arena: Zum aktuellen Forschungsstand .................................. 10 2.2 Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ............................................................................................. 13 2.3 Benennungen als strategische Kampfzone: Behandelt diese Arbeit einen rechtsextremen Forschungsgegenstand? .............................................................................................................................. 16 3. „Gegen-68“: die Geburt der Reaktion aus dem Geist der Revolte .......................................................... 20 3.1 Was ist die Neue Rechte? ...................................................................................................................... 21 3.2 Wer ist die Neue Rechte? ....................................................................................................................... 24 3.3 „Fake French“ – Der Re-Import antidemokratischen Denkens aus Frankreich .................................... 29 4. „Ich verstehe mich als einen der Väter der Neuen Rechten in Deutschland“ – der Publizist Armin Mohler .............................................................................................................................................................. -

Rechtsextremismus, Die Soziale Frage Und Globalisierungskritik – Eine Vergleichende Studie Zu Deutschland Und Großbritannien Seit 1990
Thomas Grumke und Andreas Klärner Rechtsextremismus, die soziale Frage und Globalisierungskritik – Eine vergleichende Studie zu Deutschland und Großbritannien seit 1990 Erstellt im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Berlin Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin 1 Herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Berlin Redaktionelle Bearbeitung: Dr. Dietmar Molthagen Copyright 2006 by Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Berlin Hiroshimastr. 17, 10785 Berlin Umschlaggestaltung: Pellens Kommunikationsdesign, Bonn Satz und Druck: Wagemann Medien GmbH ISBN 3-89892-503-X 2 Inhaltsverzeichnis I Einleitung .................................................................................... 7 Die Studie ...................................................................................13 II Szenen ........................................................................................ 15 1. Rechtsextremismus in Deutschland als soziale Bewegung ........15 2. Deutschland ................................................................................20 2.1 Parteiliches Spektrum (NPD, DVU, REP) .................................22 2.1.1 Der Niedergang der Republikaner in den 1990er Jahren ........... 22 2.1.2 Die Entwicklung der DVU – klassische Protestpartei und „Phantompartei“ der extremen Rechten .....................................24 Volksfront von rechts – Konflikte zwischen „Realos“ und „Fundis“ ......................................................................................25 2.1.3 Die Entwicklung der NPD in den 1990er Jahren -

Beiträge Zur Zeitgeschichte Von Dr
Dienstag, 12. April 2011 Seite 1 Beiträge zur Zeitgeschichte Von Dr. Klaus Rose Ostbayernrunde und Zukunftsrat Genau dreißig Jahre ist es her, dass sich in Bonn erstmals die (bis zu 13) CSU-Bundestagsabgeordneten aus Nieder- bayern und der Oberpfalz in der von ihnen so bezeichneten „Ostbayernrunde“ zusammenfanden. Die Bundestagswahl 1980, mit Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß (CSU), aber weiterhin mit Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), hatte die revierfernen Abgeordneten Ostbayerns zum Handeln gezwungen und nach der Konstituierung des Deutschen Bundes- tags anfangs 1981 erstmals ein gemeinsames Arbeitsprogramm erstellen lassen. Obwohl es noch keinen „Zukunftsrat“ gab, war auch damals „die Provinz“ vergessen, besonders im fernen Bonn am Rhein. er Autor, 1980 erstmals mancher Abgeordneter hat bei tunnelungen braucht es dabei mit dem Passauer Di- der Atomgeschichte bekannt- nicht. Drektmandat im Deut- lich schon Salti vorwärts und „Wir sind nicht schlechter als schen Bundestag versehen, rückwärts geschlagen. Aber: die Metropolen, wir sind nur aber schon seit 1974 im Baye- immer noch besser als ein Sal- anders“. So lautet das selbst- rischen Landtag und ab März to mortale! bewusste Bekenntnis der Pro- 1977 im Bundesparlament tä- vinz. Jetzt muss sich wieder Bringt das Gutachten tig, und zwar im Haushaltsaus- jeder auf die Hinterbeine stel- des Zukunftsrats nur schuss, hatte die Zeichen der len. Das können durchaus Ge- Sorgen? Zeit erkannt. Wenn die CSU- sprächsteilnehmer unterschied- Einen gewaltigen Wirbel ent- Landesgruppe insgesamt bay- licher Parteien sein, auch wenn fachte das in diesem Jahr vor- erische Interessen am Rhein diese sich manchmal schwer gelegte Gutachten des ominö- vertreten wollte, dann sollte die tun, sachlich zu bleiben. Aber sen „Zukunftsrats“. -

Open Ruman Allison Thesis.Pdf
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY SCHREYER HONORS COLLEGE DEPARTMENT OF GERMAN “TEMPERATE BRUTALITY”: THE AfD AND RIGHT-WING EXTREMISM IN POSTWAR GERMANY ALLISON RUMAN SPRING 2020 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for baccalaureate degrees in German, Political Science, and Classics & Ancient Mediterranean Studies with honors in German Reviewed and approved* by the following: Jens-Uwe Guettel Associate Professor in History and Religious Studies Thesis Supervisor and Honors Adviser Gretchen Casper Associate Professor of Political Science and Asian Studies Faculty Reader * Electronic approvals are on file. i ABSTRACT Das Ziel dieser Arbeit ist, die Entwicklung des Rechtextremismus in Nachkriegsdeutschland aufzuzeichnen. Die Arbeit beginnt mit einem Vergleich der von NSDAP Reichstagsabgeordneten benutzten Sprache in den Reichstagsdebatten von 1928 und Reden von AfD-Abgeordneten und anderen höherrangigen AfD-Vertretern seit dem Zusammentreten des jetzigen Bundestages im Jahr 2018. Durch diesen Vergleich werden die rhetorischen Ähnlichkeiten zwischen Vertretern beider Parteien und ihren Überzeugungen deutlich. Der erste Teil dieser Arbeit ist eine Analyse des Rechtextremismus seit dem Ende des zweiten Weltkrieges bis zum Aufkommen der AfD Anfang 2013. Dieser Teil basiert auf Zeitungs- und Sekundärliteraturrecherche und bietet eine umfassende Zusammenfassung des Rechtextremismus in Nachkriegsdeutschland. Nach 1949 hatten mehrere rechtsextreme Parteien kleinere Erfolge in der Bundesrepublik Deutschland, n allerdings wurden keine ihrer Vertreter in den Bundestag gewählt. Die Entwicklung dieser Parteien wurde durch mehrere Geschehnisse beeinflusst, einschließlich der relativ neuen rhetorischen Abgrenzung der „Neuen Rechten“ vom traditionellen „NS Sprech“ und der zumindest teilweise (jedoch nicht in Björn Höckes „Flügel“ der AfD) vorhandenen Bereitschaft, die fortbestehende Verantwortung der Deutschen für die Verbrechen der Nazis anzuerkennen. -

A Contrast to Roe V. Wade West German Abortion Decision: a Contrast to Roe V
UIC Law Review Volume 9 Issue 3 Article 4 Spring 1976 West German Abortion Decision: A Contrast to Roe v. Wade West German Abortion Decision: A Contrast to Roe v. Wade, 9 J. Marshall J. Prac. & Proc. 605 (1976) Robert E. Jonas John D. Gorby Follow this and additional works at: https://repository.law.uic.edu/lawreview Part of the Comparative and Foreign Law Commons, and the Health Law and Policy Commons Recommended Citation Robert E. Jonas, West German Abortion Decision: A Contrast to Roe v. Wade West German Abortion Decision: A Contrast to Roe v. Wade, 9 J. Marshall J. Prac. & Proc. 605 (1976) https://repository.law.uic.edu/lawreview/vol9/iss3/4 This Article is brought to you for free and open access by UIC Law Open Access Repository. It has been accepted for inclusion in UIC Law Review by an authorized administrator of UIC Law Open Access Repository. For more information, please contact [email protected]. WEST GERMAN ABORTION DECISION: A CONTRAST TO ROE v. WADEt Translated by ROBERT E. JONAS* AND JOHN D. GORBY** Guiding Principles applicable to the judgment of the First Senate of the 25th of February, 1975: - 1 F.C.C. 1/74 - - 1 F.C.C. 2/74 - - 1 F.C.C. 3/74 - - 1 F.C.C. 4/74 - - 1 F.C.C. 5/74 - - 1 F.C.C. 6/74 --A 1. The life which is developing itself in the womb of the mother is an independent legal value which enjoys the protec- tion of the constitution (Article 2, Paragraph 2, Sentence 1; Article 1, Paragraph 1 of the Basic Law). -

Ausführlicher Lebenslauf (1915-1988)
Ausführlicher Lebenslauf (1915-1988) 1915 6. September Franz Josef Strauß wurde in München als Kind des Metzgermeisters Franz Josef Strauß und seiner Ehefrau Walpurga, geb. Schießl, geboren. Strauß verbrachte zusammen mit seiner Schwester Maria die Kindheit und Jugend in seinem katholisch geprägten Münchner Elternhaus. 1922-1935 Franz Josef Strauß besuchte bis 1926 die Volksschule an der Amalienstraße in München. 1926 trat er in die Gisela-Realschule, 1927 in das Maximiliansgymnasium in München über. Sein Abiturzeugnis datierte vom 5. April 1935. Als jahrgangsbester Abiturient wurde er am 28. Oktober in die Studienstiftung "Maximilianeum" aufgenommen. 1935 April- September Arbeitsdienst im Lager Schleißheim-Hochbrück 23. Oktober Franz Josef Strauß belegte an der Ludwig-Maximilians-Universität München die Fächer Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften, Klassische Philologie, Geschichte und allgemeine Volkswirtschaftslehre. Er strebte das Staatsexamen für das höhere Lehramt an. Während des Studiums begann er eine Dissertation mit dem Titel "Justins Epitome der Historiae Philippicae des Trogus Pompeius", die 1944 bei einem Luftangriff verbrannte. 1937-1939 Beitritt zum NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrer-Korps), dem er bis zum Juli 1939 angehörte. 1939 31. August Nach acht Semestern an der Universität München Einberufung zur Wehrmacht (schwere Artillerie) nach Landsberg, Versetzung zur II. Abteilung des Artillerieregimentes 43 in der Nähe von Trier November Versetzung zur II Abteilung des Artillerieregiments 43 in die Nähe von Trier 1940 6. März - 15. April Franz Josef Strauß wurde von seinem Truppenteil beurlaubt und legte den ersten Abschnitt der Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Geschichte und Klassische Philologie (Latein und Griechisch) ab. Am 16. April kehrte er zu seinem T r uppenteil zurück 1.