LATIUM Kunst Und Kultur Im Mittelalter
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2682 Allegato1.Pdf
1 Cratere di Castiglione Tipologia Paesaggio geologico Descrizione I coni sono costituiti da materiale scoriaceo e lapilloso in Geosito proposto da: Casto L., Zarlenga F. parte cementato ed in parte incoerente e sono situati lungo il bordo Provincia Roma Pubblicazione Casto L. & Zarlenga F. (1996) – I beni culturali a della caldera Tuscolano-Artemisia, a quote di circa 750 m s.l.m.. Ad 14 Cratere di Valle Marciana Comune Monte Compatri carattere geologico del Lazio – Il distretto vulcanico di Albano. essi si associano colate di lava leucititica, osservabili in affioramento Localizzazione Lat: 4640435,43 N; Long: 310312,66 E ENEA/Regione Lazio. Pp 62-63. all’interno di depressioni morfologiche. Provincia Roma Tipologia Paesaggio geologico Comune Grottaferrata Geosito proposto da: Casto L., Zarlenga F. Descrizione I coni di scorie sono legati al periodo di attività “Tuscolano- Localizzazione Lat: 4629543,19 N; Long: 304371,09 E Pubblicazione Casto L. & Zarlenga F. (1996) – I beni culturali a Artemisio” e sono alti entrambi circa 340 m s.l.m. Il cono di scorie 10 Il Vulcano Laziale dal Tuscolo Tipologia Paesaggio geologico carattere geologico del Lazio – Il distretto vulcanico di Albano. occupato dall’abitato di Colonna presenta alla base colate di lava Geosito proposto da: Casto L., Zarlenga F. ENEA/Regione Lazio. Pp 54-55. mentre l’altro cono è interamente ricoperto da lapilli, legati a fasi di Provincia Roma Pubblicazione Casto L. & Zarlenga F. (1996) – I beni culturali a attività più recenti. Comune Monte Porzio Catone, Grottaferrata carattere geologico del Lazio – Il distretto vulcanico di Albano. Descrizione Cratere eccentrico situato in posizione settentrionale Localizzazione Lat: 4629994,21 N; Long: 310034,46 E ENEA/Regione Lazio. -

S Italy Is a Contracting Party to All of the International Conventions a Threat to Some Wetland Ibas (Figure 3)
Important Bird Areas in Europe – Italy ■ ITALY FABIO CASALE, UMBERTO GALLO-ORSI AND VINCENZO RIZZI Gargano National Park (IBA 129), a mountainous promontory along the Adriatic coast important for breeding raptors and some open- country species. (PHOTO: ALBERTO NARDI/NHPA) GENERAL INTRODUCTION abandonment in marginal areas in recent years (ISTAT 1991). In the lowlands, agriculture is very intensive and devoted mainly to Italy covers a land area of 301,302 km² (including the large islands arable monoculture (maize, wheat and rice being the three major of Sicily and Sardinia), and in 1991 had a population of 56.7 million, crops), while in the hills and mountains traditional, and less resulting in an average density of c.188 persons per km² (ISTAT intensive agriculture is still practised although land abandonment 1991). Plains cover 23% of the country and are mainly concentrated is spreading. in the north (Po valley), along the coasts, and in the Puglia region, A total of 192 Important Bird Areas (IBAs) are listed in the while mountains and hilly areas cover 35% and 41% of the land present inventory (Table 1, Map 1), covering a total area of respectively. 46,270 km², equivalent to c.15% of the national land area. This The climate varies considerably with latitude. In the south it is compares with 140 IBAs identified in Italy in the previous pan- warm temperate, with almost no rain in summer, but the north is European IBA inventory (Grimmett and Jones 1989; LIPU 1992), cool temperate, often experiencing snow and freezing temperatures covering some 35,100 km². -
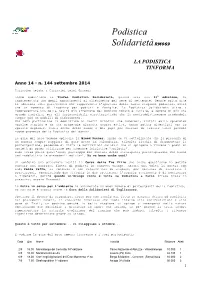
Podistica Solidarietàrm069
Podistica Solidarietà RM069 LA PODISTICA TINFORMA Anno 14 - n. 144 settembre 2014 Carissime amiche e Carissimi amici Orange, anche quest’anno il Trofeo Podistica Solidarietà , giunto alla sua 11 a edizione , ha rappresentato uno degli appuntamenti di riferimento del mese di settembre. Sempre molto alte le adesioni alla gara/evento che rappresenta l’apertura della nuova stagione podistica oltre che un momento di incontro per podisti e famiglie. La Podistica Solidarietà oltre a rappresentare una delle realtà più affermate del podismo romano e laziale, è sempre di più una grande famiglia, per gli irrinunciabili caratteristiche che la contraddistinguono rendendola sempre più un modello di riferimento. Una nota particolare la dedichiamo ai nostri Arancini che numerosi, aiutati dalla splendida cornice storica e da una gradevole giornata ancora estiva, hanno potuto divertirsi con lo spirito migliore. Tanti occhi delle mamme e dei papà per cercare di trovare tante piccole nuove promesse della Podistica del domani. Le gare del mese vedono spiccare la Blood Runner , anche se va sottolineato che la presenza di un numero sempre maggiore di gare messe in calendario, talvolta rischia di frammentare la partecipazione, perdendo di vista le motivazioni solidali che si spingono a vincere i premi di società da poter utilizzare per numerose iniziative “solidali”. Buon terzo posto quest’anno, purtroppo ben lontani dalle straripanti partecipazioni che hanno contraddistinto le precedenti edizioni. Ma va bene anche così! Si conferma una piacevole realtà la Corsa delle Tre Ville che anche quest’anno ha potuto vantare una numerosa flotta di podisti in canotta Orange. Ancora una volta la Nostra Top Lady Paola Patta , si conferma e non finisce mai di stupire, per costanza di risultati e prestazioni, conquistando due vittorie in due settimane; l'augurio ovviamente è di continuare a ripetersi, perché quando un'Orange vince è tutta la Podistica a farlo (frase presa in prestito, grazie Forrest ). -

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Dipartimento Di Studi Umanistici
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Dipartimento di Studi Umanistici Dottorato di ricerca in Storia, territorio e patrimonio culturale XXXII ciclo Tesi di Dottorato TRASFORMAZIONI DELL’USO E DELLA COPERTURA DEL SUOLO, DINAMICHE TERRITORIALI E RICOSTRUZIONI GIS NEI POSSEDIMENTI PONTINI DELLA FAMIGLIA CAETANI (XIX- XXI SECOLO) Dottorando: Diego Gallinelli Tutor: Prof.ssa Carla Masetti Anno Accademico 2019-2020 1 INDICE Introduzione p. 6 1 Approccio teorico-metodologico 1.1 L’analisi geostorica per studiare le trasformazioni del territorio p. 12 1.2 Gli strumenti GIS per la ricostruzione degli assetti territoriali del passato p. 19 1.3 Le fonti d’archivio della Fondazione Camillo Caetani p. 21 2 Aspetti generali della Pianura Pontina 2.1 Inquadramento territoriale p. 25 2.2 Inquadramento storico e politico p. 45 2.3 Il ruolo della famiglia Caetani p. 52 3 Le risorse della palude 3.1 Un ambiente complesso ma ricco di opportunità p. 64 3.2 La pesca nelle acque pontine p. 78 3.3 Le peschiere dei Caetani: il caso di Fogliano p. 92 3.4 I conflitti per la gestione delle acque p. 100 4 Le bonifiche nel corso dei secoli 4.1 I tentativi di bonifica precedenti a Pio VI p. 108 4.2 La bonifica di Pio VI p. 129 4.3 La bonifica del Novecento p. 150 5 Cisterna di Latina: storia ed evoluzione p. 165 2 6 Ricostruzioni GIS dell’uso e della copertura del suolo nell’antico territorio di Cisterna p. 177 6.1 Uso e copertura del suolo attraverso le mappe del Catasto Gregoriano 6.1.1 Le mappe del Catasto Gregoriano p. -

Piano Del Parco Relazione Generale Tomo 3 Indirizzi Ed Azioni
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO PIANO DEL PARCO RELAZIONE GENERALE TOMO 3 INDIRIZZI ED AZIONI SOMMARIO I. INDIRIZZI ED AZIONI DEL PIANO 5 A. Introduzione 5 1. Struttura degli elaborati 6 2. Dimensione strategico-strutturale del Piano 7 B. INDIRIZZI ED AZIONI PER GLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE: Identificazione di grandi aree di naturalità omogenee 8 1. Indirizzi ed Azioni per la conservazione della foresta demaniale (SIC IT6040014 “Foresta Demaniale del Circeo”) 9 2. Indirizzi e azioni per la Conservazione del complesso dei Laghi Costieri (SIC IT6040012 “Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno”) 10 3. indirizzi e azioni per la Conservazione del Lago di Paola (SIC IT6040013 “Lago di Sabaudia” ) 20 4. indirizzi e azioni per la Conservazione del Promontorio del Circeo (SIC IT6040016 “Promontorio del Circeo - Quarto Caldo”, IT6040017 “Promontorio del Circeo - Quarto Freddo”) 21 5. indirizzi e azioni per la Conservazione dell’Isola di Zannone (SIC IT6040020 “Isole di Palmarola e Zannone”) 24 6. Indirizzi e azioni per la conservazione degli ambiti marini limitrofi al Parco Nazionale del Circeo 27 7. indirizzi e azioni per la Conservazione del Sistema Dunale (SIC IT6040018 “Dune del Circeo”) 27 8. Conservazione della rete ecologica sulla rete dei canali, delle frangivento e delle aree agricole 28 9. Indirizzi per le attività di prevenzione incendi e per il Piano Antincendi del Parco 28 10. Indirizzi di gestione ecosistemica per il Piano di Gestione della ZPS (Zona di Protezione Speciale “Parco Nazionale del Circeo”) 28 C. Conservazione di specie ed habitat di interesse nazionale, comunitario ed internazionale 29 1. Reintroduzione del Capriolo italico (e del Gatto selvatico) 29 2. -

Scarica La Guida
Romanesque church Romanesque Trekking Selfies LIVING GRAN SASSO Alla Scoperta del Distretto Turistico del Gran Sasso - Explore the Gran Sasso Tourist District Tourist District Explore the Gran Sasso Turistico del GranSasso Alla ScopertadelDistretto Food&wine Monuments History Scopriamo il Distretto in 10 Itinerari Discover the District in Ten Itineraries l Distretto Turistico del Gran Sasso d’Italia com- Gli itinerari si possono seguire spostandosi con il he Gran Sasso d’Italia Tourist District includes all of Benedictine abbeys and the paths connected to them, Iprende l’intero territorio del Parco Nazionale del proprio mezzo, per decidere in tutta libertà dove e Tthe Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della combined with the discovery of local culinary delicacies. Gran Sasso e Monti della Laga, una delle aree pro- quando fermarsi; possono durare una sola giornata Laga, one of Europe’s largest protected areas, located We can follow the itineraries in our own vehicle, de- tette più grandi d’Europa, nel cuore dell’Appennino; o più giorni, a seconda degli interessi e della dispo- in the heart of the Apennines: a sequence of stunning ciding where and when to stop, and we can spend a un susseguirsi di paesaggi di straordinaria bellezza e nibilità di tempo. landscapes of exceptional environmental and cultural day or several days, depending on our interests and di eccezionale valore ambientale e culturale. Gli itinerari della Laga (5 e 9), in particolare, sono importance. the amount of time available. Questa guida propone 10 itinerari alla scoperta del per viaggiatori appassionati e instancabili, che non This guide proposes 10 itineraries for exploring the The Laga itineraries (5 and 9) are suited to passiona- Distretto e dei 60 comuni che lo costituiscono. -

Annali 22 Pulito
1 Annali del Lazio Meridionale S T O R I A E S T O R I O G R A F I A anno XI, n. 2 – dicembre 2011 Annali editi in due quaderni l’anno. Direttore editoriale: Antonio Di Fazio Semestrale. Ambito territoriale: Lazio e-mail: [email protected] meridionale romano, ciociaro e pontino Comitato di redazione Ambito concettuale-disciplinare: la sto- A. Di Fazio, Giovanni Pesiri, ria e gli svolgimenti culturali del Latium Luigi di Pinto, Giovanni Tasciotti, vetus e adiectum dall’ antichità fino ad Massimiliano Di Fazio, oggi. Sfondo di storia nazionale e Rosario Malizia, Annibale Mansillo meridionale. Ricerca storica e discus- sione. Spazio didattico. Comitato scientifico Luigi Cardi (Geografia storica, Università Si collabora alla rivista solo su invito del Orientale di Napoli) direttore o di un redattore. Sono però Vincenzo Padiglione (Antropologia sociale, libere le rubriche aperte al dibattito. La Università di Roma ‘La Sapienza’) responsabilità giuridica e scientifica Silvana Casmirri (Storia moderna e rimane interamente a carico dell’ autore. contemporanea, Università di Cassino) Dischi, foto e dattiloscritti, se non Giovanni Pesiri (Regione Lazio - Parco pubblicati, possono essere ritirati solo a Naturale ‘Monti Ausoni’) cura degli stessi autori. Massimiliano Di Fazio (Archeologo - Gli articoli vanno consegnati in carta- Università di Pavia) ceo e in formato elettronico (possibil- mente in Word / Times New Roman 11). Casa Editrice Edizioni di Odisseo, via Gli autori hanno diritto a 3 copie del S.S. Appia, km 136 – Itri (LT), tel. 0771- fascicolo per ogni saggio e 2 copie per 727203 le recensioni (3 se più di una). Per gli E-mail: [email protected] estratti si accorderanno con l’editore. -

Mama Box for Your Stay Marca Maceratese in the Marca Maceratese Mama Box Marca Maceratese
A box of ideas MaMa Box for your stay Marca Maceratese in the Marca Maceratese MaMa Box Marca Maceratese A box of ideas for your stay in the Marca Maceratese Lago di Fiastra - photo by Federica Baldi 2 Index Guide to MaMa box ................................ 7 Thematic areas ................................ 8 Marca Maceratese Portal ...............................11 MaMa in blue .............................. 13 The sea ................................. 14 MaMa sea ................................. 20 Water parks ................................. 25 Thermal baths ................................. 26 MaMa’s tips ................................. 27 Web experiences ................................. 28 Gentle hills and ancient villages .............................. 31 The most beautiful villages of Italy ................................. 32 / i"À>}iy>}ð°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{x -«iÃ>`Àiiy>}ð°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{n The ancient villages ................................. 54 Fortresses and towers ................................. 58 MaMa’s tidbits ................................. 64 MaMa’s tips ................................. 69 Web experiences ................................. 70 MaMa mia what a show! .............................. 73 Mountain, parks, sports and active nature .............................. 97 National Park of Sibillini Mountains ................................. 98 Centres of Environmental Education ................................100 Natural reserves ................................102 Lakes ................................104 -

The Case Study of Circeo National Park, Italy
A COMBINED APPROACH BASED ON ECOSYSTEM SERVICES AND ENVIRONMENTAL JUSTICE: THE CASE STUDY OF CIRCEO NATIONAL PARK, ITALY Faculty of Economics Department of Methods and Models for Economy, Territory and Finance (MEMOTEF) PhD programme in Models for the Economics and Finance, XXXII cycle, curriculum in Economic Geography Stefania Benetti Student number 1328291 Supervisor Co-supervisor Professor Davide Marino Dr. Cary Yungmee Hendrickson To Gilberto, my family, and all the people who believed in me and supported my work. “Nature is not a visiting place. It is home.” (Gary Snyder) TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS ........................................................................................................................................... i LIST OF FIGURES ................................................................................................................................................ iv LIST OF TABLES ................................................................................................................................................... v ACKNOWLEDGEMENTS...................................................................................................................................... vi PREFACE ............................................................................................................................................................. 1 CHAPTER 1. INTRODUCTION ......................................................................................................................... 4 -

Passeggiate Nel Tempo Parchi, Castelli, Monasteri Viaggio Tra Storia E Leggende Dell’Entroterra Laziale
REGIONE LAZIO REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TURISMO Passeggiate nel tempo Parchi, castelli, monasteri Viaggio tra storia e leggende dell’entroterra laziale Distribuzione gratuita Passeggiate REGIONE LAZIO nel tempo ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TURISMO Parchi, castelli, monasteri www.regione.lazio.it Viaggio tra storia e leggende Dell’entroterra laziale AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA Realizzazione e coordinamento editoriale: DEL COMUNE DI ROMA Via Parigi, 11 - 00185 Roma Vitesse - Roma Tel. +3906488991 - Fax +39064819316 Per conto dell’APT di Roma Centro Visitatori Via Parigi, 5 - 00185 Roma www.romaturismo.it Progetto grafico e disegni cartografici: AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA Nicola Pietravalle, Silvia Ranalli DELLA PROVINCIA DI ROMA Via XX Settembre, 26 - 00187 Roma Redazione testi: Alessia Petruzzelli Tel. +3906421381 - Fax +390642138211 www.oltreroma.it Nino Martino (schede parchi) AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE Immagini: Simonetta Panzironi; Via Aldo Moro, 465 - 03100 Frosinone Archivio APT Roma. Tel. +39077583381 - Fax +390775833837 Schede parchi: Panda Photo www.apt.frosinone.it AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA Stampa: Tipolitografia C.S.R. - Roma DELLA PROVINCIA DI LATINA Via Duca del Mare, 19 - 04100 Latina Tel. +390773695404 - Fax +390773661266 www.aptlatinaturismo.it AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI RIETI Via Cintia, 87 - 02100 Rieti Tel. +390746201146 - Fax +390746270446 In copertina : Sermoneta, Borgo e www.apt.rieti.it Castello -

Regione Lazio Deliberazione N
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 474 DEL 15/01/2020 Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI STRUTTURA Area: QUALITA' DELL'AMBIENTE PROPONENTE Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Revoca della D.G.R. 15 febbraio 2013 n. 44 e individuazione della nuova rete di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali della Regione Lazio. DL.vo 152/2006 e s.m.i.. ___________________________(PISTONI SILVIA) ___________________________(RODOLICO SILVANA) ___________________________(P. ZANGARA) ___________________________(F. TOSINI) ___________________________ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E PROPONENTE RISORSE NATURALI ___________________________(Onorati Enrica) L'ASSESSORE DI CONCERTO ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni ___________________________ SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 27/02/2020 prot. 89 ISTRUTTORIA: ____________________________________ ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ -

Piano Di Tutela Delle Acque Regionale (Ptar) Aggiornamento
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONALE (PTAR) AGGIORNAMENTO ALLEGATI AL PIANO DICEMBRE 2016 Indice Tabelle Tabella 2-1: Bacini Idrografici Superficiali .......................................................................................... 6 Tabella 2-2: Sottobacini idrografici afferenti ...................................................................................... 8 Tabella 2-3: Sottobacini Idrografici funzionali .................................................................................. 15 Tabella 2-4: Corpi idrici fluviali .......................................................................................................... 17 Tabella 2-5: Corpi idrici lacustri ......................................................................................................... 30 Tabella 2-6: Corpi idrici lacustri ......................................................................................................... 32 Tabella 2-7: Bacini sotterranei ........................................................................................................... 32 Tabella 2-8: Sorgenti con portata media superiore a 50 l/s ............................................................ 36 Tabella 2-9: Siti Con Habitat di Posidonia oceanica; Fonte: MATTM (2015) ................................. 49 Tabella 2-10: Rete Natura provincia di Latina; Fonte: MATTM (2015) .......................................... 49 Tabella 2-11: Rete Natura provincia di Rieti; Fonte: MATTM (2015) ............................................. 51 Tabella 2-12: